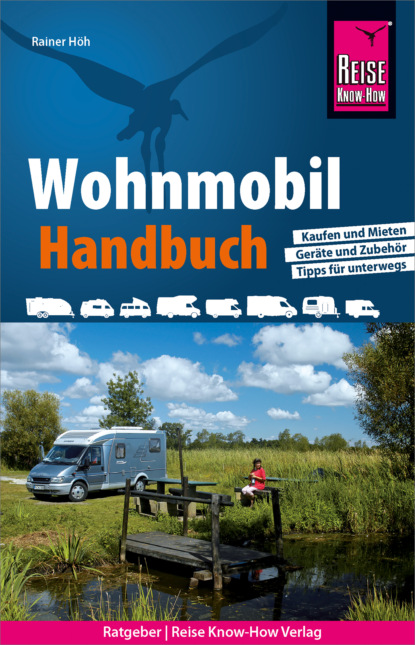- -
- 100%
- +
Meist haben Integrierte zudem eine feste Polstergruppe, eine Nasszelle mit separater Dusche und ein fest eingebautes Heckbett oder ein separates Schlafzimmer (teils erhöht über einem großzügigen Heckstauraum oder einer Garage für Fahrrad, Motorrad oder gar für einen Kleinwagen). Trotz ihrer Größe werden auch die Integrierten gerne als luxuriöse Mobilwohnung für zwei Personen genutzt, es gibt jedoch auch Modelle mit 4–7 Schlafplätzen.
Durch die Bauweise aus einem Guss gibt es keine kritischen Übergänge zwischen Serien-Fahrerhaus und Wohnkabine, die mit der Zeit undicht werden könnten. Zudem ist der Integrierte naturgemäß windschnittiger als der Nasenbär und daher schneller und günstiger im Verbrauch. Die riesige Frontscheibe kann allerdings im Winter Probleme bei der Isolierung bereiten (mit Thermo-Matten oder Rollläden isolieren) und im Sommer zu einer starken Aufheizung führen. Außerdem sind diese Modelle schon durch ihre Bauart ca. 5000–8000 € teurer als vergleichbare Alkovenfahrzeuge. Zudem werden oft teurere Materialien verwendet (z. B. Edelholz und Leder statt Kunststoff) und luxuriösere Ausstattungen eingebaut (Warmwasserheizung, Klimaanlage, Satelliten-TV etc.). Die Preise beginnen bei etwa 65.000 €, für ein gut ausgestattetes Modell der mittleren Preislage muss man um die 80.000 € rechnen und Luxusmodelle auf Omnibus-Chassis (z. B. von Niesmann, Concorde und Morelo) kosten zwischen 150.000 € und 500.000 € oder sogar noch deutlich mehr.

Das Hubbett über dem Fahrerhaus wird zum Schlafen einfach heruntergeklappt (043wh lc)
Pick-up-Camper: vielseitige Exoten
Eine sehr interessante, wenngleich bei uns relativ wenig verbreitete Lösung bietet ein Pick-up oder Pritschenwagen (Heckantrieb oder meist Allrad) mit aufgesetzter Alkoven-Wohnkabine. Diese Kombination erspart den Zweitwagen und bietet vielfältige Möglichkeiten. Sie ist schnell, wendig, kompakt und geländegängig. Und die Kabine lässt sich rasch absetzen, sodass man das Basisfahrzeug zu Hause oder am Zielort separat für Fahrten und Transporte verwenden kann.
Geeignete Basisfahrzeuge sind als Einfach-, Eineinhalb- oder Doppelkabiner zu bekommen (z. B. japanische Pick-ups oder VW-Pritschenwagen) und bieten Platz für zwei bis fünf Personen. Aber Vorsicht: Nicht jeder Pick-up ist dafür geeignet. Vor allem der Hecküberhang macht manchem Fahrzeug sehr zu schaffen, sofern die Stoßdämpfer nicht entsprechend angepasst werden. Mir ist ein Opel Campo (Isuzu) trotz einer TÜV-Abnahme von Aufbau und Federung auf der Straße einfach zerbrochen!
Die Wohnkabinen sind meist für zwei bis vier Personen ausgestattet, allerdings ist das Raumangebot deutlich knapper als in den üblichen Aufbaumobilen. Die Energievorräte und die Tanks sind kleiner und es gibt meist keinen Durchgang zwischen Fahr- und Wohnbereich (allenfalls einen Durchschlupf). Für eine komplett ausgestattete Absetzkabine muss man ca. 20.000 € bis 30.000 € investieren. Außerdem sind auch Leerkabinen zum Selbstausbau erhältlich (–>).
Sondermodelle
Für Reisen abseits befestigter Straßen kann für 2 bis 4 Personen ein Pick-up-Modell ausreichen, sofern unterwegs genügend Versorgungsmöglichkeiten bestehen, denn lange autark ist man damit nicht.
Für Expeditionen, auf denen man mehrere Wochen ohne Nachschub auskommen muss, gibt es robuste und geländegängige Expeditionsmobile auf Mercedes Benz- oder MAN-Basis mit 4, 6 oder gar 8 angetriebenen Rädern, starken Motoren und riesigen Tanks von einigen Hundert Litern Kapazität. Solche Fahrzeuge können dann auch rasch einige Hunderttausend Euro kosten, sind aber gebraucht manchmal zu einem Bruchteil des Neupreises zu bekommen.
Bei uns noch relativ unbekannt, aber zunehmend erhältlich, sind Auflieger-Mobile: Auf der Ladefläche eines Pick-ups wird ein Sattel befestigt, auf dem der Wohnanhänger aufliegt. So entsteht ein langes Gespann, das einem Wohnwagen-Gespann ähnelt und für enge Ortsdurchfahrten weniger geeignet ist. Dafür ist der Auflieger geräumig und lässt sich rasch abkoppeln.
Nicht nur für Reisejournalisten, sondern auch für Außendienst-Mitarbeiter und andere Berufsgruppen, die unterwegs auf einen Schreibtisch angewiesen sind, wäre ein Büromobil interessant – also ein mobiles Büro, das zudem eine Übernachtungsmöglichkeit bieten kann. Solche Fahrzeuge werden beispielsweise von der Firma BVV angeboten.
Um die Eintragung „So.-Kfz Büromobil“ im Fahrzeugbrief (und die entsprechenden Steuervorteile) zu bekommen, muss der Ausbau eine Nutzung als Büro klar erkennen lassen (z. B. Aktenschrank, Computer, mobile Kommunikation). Ein Notebook allein wird nicht ausreichen – schon gar nicht, wenn das Mobil fünf Schlafplätze hat. Erkundigen Sie sich beim TÜV und bei Ihrem Steuerberater.
Basisfahrzeuge
Wie schon der Name verrät, ist das Basisfahrzeug nicht einfach ein Fahrzeug, sondern buchstäblich die Basis, also das Fundament für Ihr mobiles Zuhause. Damit sich Ihr Wohnmobil nicht nur auf dem Campingplatz, sondern auch unterwegs bewährt, sollten Sie auf Kriterien wie Motorisierung, Antriebsart, zulässiges Gesamtgewicht, Nutzlast, Radstand, Bereifung etc. achten.
Aber auch Hersteller und Marktposition können eine Rolle spielen. Denn international starke Hersteller sorgen auch für ein gutes Servicenetz im Ausland, und bei Basisfahrzeugen mit hohem Marktanteil ist es viel einfacher, einen Austauschmotor oder sonstige Austausch- bzw. Ersatzteile zu bekommen, als bei irgendwelchen Exoten.
Den höchsten Marktanteil aller zugelassenen Reisemobile hat derzeit der italienische Fiat Ducato, der zusammen mit seinen weitgehend baugleichen Schwestermodellen Peugeot Boxer und Citroën Jumper als Basisfahrzeug für über 50 % aller Reisemobile dient.
Danach folgen Basisfahrzeuge von VW, Daimler, Ford, Iveco und Renault.Fiat, Peugeot und Citroën verwenden gemeinsam das in Italien produzierte Euro-Chassis. Alle hier genannten Basisfahrzeuge sind mit verschiedenen Turbodieselmotoren erhältlich, Fahrzeuge mit Benzinmotoren werden kaum angeboten. Die Hersteller haben Modelle mit unterschiedlichen Radständen und zulässigem Gesamtgewicht im Programm sowie (je nach zGG) Fahrzeuge mit Front- oder Heckantrieb (beim Transit wahlweise). Einige der Hersteller bieten auch Allrad-Versionen an.
Der Fiat Ducato überzeugt durch hohe Robustheit (zum Beispiel härtere Federung). Serienmäßig sind zahlreiche Sicherheits-Features wie Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und ein mechanischer Bremsassistent (MBA). Optional kann dieses Programm mit der elektronischen Traktionskontrolle (ESP) und zusätzlichen Airbags erweitert werden.
Der Ford Transit bietet serienmäßig Komfort-Features wie eine Klimaanlage und mehrere Airbags. Er ist mit vier verschiedenen TDCi-Dieselmotoren erhältlich – und wahlweise mit Front- oder Heckantrieb. Außerdem gibt es zwei Chassis-Varianten und unterschiedliche Radstände. Das Fahrgestell mit Leiterrahmen, Heckantrieb und Zwillingsbereifung kann auf 3850 kg aufgelastet werden und eignet sich besonders für größere Alkovenmobile. Vor allem für Teilintegrierte interessant ist das Flachbodenchassis mit dem rund 100 Millimeter tiefer liegenden Schwerpunkt. Für die Sicherheit sorgen u. a. ausreichend dimensionierte Scheibenbremsen sowie das serienmäßige elektronische Sicherheits- und Stabilitätsprogramm ESP.
Die größte Reichweite bietet der Renault Master mit einem Tankvolumen von 100 l (bis zu 1000 km mit einer Tankfüllung). Zudem ist die Bremsanlage besonders gut auf das Fahrzeuggewicht abgestimmt.
Die deutschen Modelle Mercedes Sprinter und VW Crafter sind in der Regel etwas teurer. Dafür punkten sie – wie Tests immer wieder beweisen – mit guter Sicherheits- und Komfortausstattung. Vor allem die Lenkung schneidet im Vergleich zu den anderen Fahrzeugen deutlich besser ab.
Außerdem zeichnen sie sich durch hohe Laufleistungen aus. Auch bei einem späteren Wiederverkauf können sich diese Stärken sehr positiv bemerkbar machen. Der Iveco Daily ist mit Preisen ab 37.000 € wohl das teuerste Basisfahrzeug.
Neben den bereits genannten Firmen gibt es auch Wohnaufbauten auf Basisfahrzeugen von MAN, Volvo und amerikanischen Herstellern wie z. B. Chevrolet. Sie spielen allerdings bei uns eine eher geringe Rolle und man findet sie vor allem im oberen Segment der Luxusfahrzeuge. Japanische Basisfahrzeuge hingegen haben im Wohnmobilbau praktisch keine Bedeutung mehr, wenn man von einigen Pick-up-Modellen absieht.
Motorisierung
Die meisten Wohnmobile sind heute mit Dieselmotoren ausgerüstet, um niedrigen Verbrauch, hohe Reichweite und günstige Kilometerkosten zu gewährleisten. Vernünftige Fahrweise vorausgesetzt, verbraucht ein mittelgroßes Mobil dann ca. 10–12 l auf 100 km.
Ottomotoren sind selten und kaum gefragt, aber wer einen Benziner haben möchte, hat den Vorteil, dass sie gebraucht um etwa ein Drittel billiger zu haben sind als vergleichbare Wohnmobile mit Dieselaggregat.
Die Leistung des Motors sollte dem Gesamtgewicht angemessen sein. Als Faustregel gilt: maximal 50 kg pro kW bei Fahrzeugen bis 3,5 t und maximal 75 kg pro kW bei schwereren Reisemobilen. Auch wenn man mit dem Wohnmobil ein gemütliches Tempo bevorzugt, so kann es doch nerven, wenn man an jedem Berg so stark zurückfällt, dass man permanent von Lastzügen überholt wird, die dann kaum mehr als 2 m vor einem wieder einscheren. Außerdem kann es längerfristig günstiger sein, etwas mehr in Hubraum und PS zu investieren, als völlig untermotorisiert zu reisen und das Aggregat ständig zu überfordern, sodass bereits nach wenigen Jahren teure Reparaturen (Zylinderkopf) fällig werden oder gar ein Austauschmotor.

Die Motorisierung sollte dem Gewicht des voll beladenen Fahrzeugs angemessen sein (025wh lc)
Antrieb
Unter den Reisemobilen bis 3,5 t hat sich bei etwa 80 % der Fahrzeuge der Frontantrieb durchgesetzt. Seine Vorteile für eine bessere Raumnutzung liegen auf der Hand:
> Der komplette Antrieb samt Tank liegt vorne.
> Hinter dem Fahrerhaus befindet sich ausschließlich der Wohnbereich.
> Im Fahrerhaus ist kein Motorbuckel.
> Durchgang und Wohnbereich werden nicht durch Kardantunnel behindert.
> Das Fahrzeug lässt sich mit verschiedenen Rahmen kombinieren.
Die Vorteile des Heckantriebs (bessere Traktion auf glattem Grund und am Berg) überwiegen gegenüber dem Raumvorteil erst bei höheren Gewichten. Allerdings sollte man darauf achten, dass man beim Frontantrieb durch Anbauten wie Heckträger und falsches Beladen die Gewichtsverteilung nicht zu negativ beeinflusst. Die Last auf der Vorderachse sollte nicht wesentlich unter 50 % des Gesamtgewichts liegen.
Der Wendekreis von Wohnmobilen mit Frontantrieb muss nicht unbedingt größer sein als bei solchen mit Heckantrieb; er wird stärker durch den Radstand beeinflusst.
Zulässiges Gesamtgewicht (zGG), Nutzlast und Federung
Polizeikontrollen zur Urlaubszeit haben gezeigt, dass ein großer Teil der Wohnmobile überladen ist – manche sogar ganz erheblich. Die Fahrzeuge werden zwar nicht sofort auseinanderbrechen (obwohl ich selbst das schon erlebt habe – sogar ohne Überladung), aber Komfort und Sicherheit leiden erheblich. Fahrzeuggewicht, Motorleistung, Bremskraft, Fahrverhalten und Federung müssen zusammenpassen, da sonst das Risiko schwerer Unfälle drastisch steigt. Leergewicht, zulässiges Gesamtgewicht und die sich daraus ergebende Zuladung (Nutzlast) verdienen daher besondere Beachtung. Achtung: Auch wenn das zulässige Gesamtgewicht eingehalten wird, kann die Belastung einer Achse erheblich überschritten werden. Beachten Sie daher bei der Zuladung unbedingt die Achslasten und wie sich diese beim Beladen verändern.
Heutige Wohnmobile werden meist für mindestens 3,49 t zugelassen und bieten daher mehr Zuladungsreserven als viele ältere Modelle. Da jedoch zunehmend Sonderausstattung eingebaut wird und überdies Sportgeräte und mehr Vorräte mitgenommen werden, sind die Lastreserven trotzdem nicht immer ausreichend. Besonders bei Fahrzeugen unter 3,5 t sollte man die Nutzlast kritisch prüfen. Als minimale Lastreserve für den Familienurlaub gelten 600–700 kg oder 20 % des zulässigen Gesamtgewichts; optimal wären 1000 kg oder 25–30 % des zGG. In jedem Fall ist es besser, ein langsameres Fahrzeug (über 3,5 t zGG) mit höherer Nutzlast zu fahren, als überladen in den Urlaub zu starten und Probleme oder gar einen Unfall zu riskieren. Allerdings ist bei diesen Fahrzeugen zu beachten, dass sie einen entsprechenden Führerschein erfordern.
Federn
Die Basisfahrzeuge der verschiedenen Hersteller sind überwiegend mit Blatt- oder Parabelfedern und Schraubenfedern ausgestattet. Der für diese Federn verwendete Stahl besitzt eine hohe Festigkeit und Elastizität, die er einer speziellen Legierung mit Silizium und einer gleichmäßigen Verteilung von Kohlenstoffmolekülen verdankt. Doch selbst hochwertige Originalfedern verlieren unter Dauerbelastung mit der Zeit an Spannkraft. Zusätzlich neigen Wohnmobile durch den hohen Schwerpunkt des Aufbaus zu erhöhten Wank- und Nickbewegungen. Um Sicherheit und Komfort zu erhöhen, kann man sein Fahrzeug mit verschiedenen Systemen nachbessern. Sie werden entweder zusätzlich zur Originalfeder verbaut oder ersetzen diese komplett. Von größter Wichtigkeit ist dabei, dass man nicht nur die Federung verstärkt, sondern auch die Stoßdämpfer darauf abstimmt. Sonst kann es passieren, dass trotz TÜV-geprüfter Zusatzfederung das Fahrzeug schlicht in zwei Teile zerbricht.
Zusatz-Blattfeder
Die Zusatz-Blattfeder ist eine gute Lösung bei permanent hohen Hecklasten wie zum Beispiel einem Motorradträger. Sie hat allerdings von allen Federsystemen das größte Eigengewicht, was wiederum zur Verringerung der eigentlichen Nutzlast führt. Zudem ermüdet die Zusatz-Blattfeder längerfristig ebenso wie die Hauptfederung. Da die härteren Federkräfte voll auf den Fahrzeugrahmen übertragen werden, leidet zudem der Fahrkomfort, und der Rahmen wird stärker belastet. Zusatz-Blattfedern sind zwar eine einfach zu montierende und günstige Lösung, können aber bauartbedingt nicht einer wechselnden Zuladung angepasst werden und sind daher bei geringerer Belastung zu hart.
Zusatz-Schraubenfeder
Alternativ zur Blattfeder eignen sich als Zusatzfedern für Reisemobile mit hoher Hinterachsbelastung auch Schraubenfedern. Sie können das Absacken des Fahrzeughecks deutlich verringern. Auch die Empfindlichkeit gegen Seitenwind sowie Nick- oder Wankbewegungen werden reduziert. Schraubenfedern entlasten die Originalfedern und verstärken die bestehende Gesamtfederung gleichmäßig. Sie sind günstig, schnell zu montieren und leichter als Blattfedern. Ihr spezieller Vorteil gegenüber der Blattfeder ist die geringere Geräuschentwicklung, da keine Quietschgeräusche durch Reibung entstehen. Für Reisemobile besonders geeignet sind Zusatz-Schraubenfedern mit progressiver Kennung. Diese Schraubenfedern haben eine geringere Anfangsspannung, wodurch sich das Fahrzeug in unbeladenem Zustand weicher und komfortabler fährt. Mit zunehmender Einfederung steigt ihr Widerstand an, um das Fahrzeugheck auch bei wachsender Zuladung zu stabilisieren. Die Zusatzschraubenfeder ist verschleiß- und wartungsfrei. Wegen der Änderung des Fahrwerks sind nach der Montage eine TÜV-Abnahme und ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere notwendig.
Zusatz-Luftfeder
Zusatz-Luftfedern sind variabler als Blatt- oder Schraubenfedern. Sie werden zwischen Fahrzeugrahmen und Achse montiert. Die Original-Stahlfedern übernehmen weiterhin die Hauptlast, die zusätzliche Luftfeder mit variablem Druck sorgt bei jeder Beladung für Komfort und Sicherheit. Da die Originalfederung weiter funktioniert, bleibt das Fahrzeug auch bei Ausfall der Zusatzluftfederung voll betriebsfähig. Bei der Zusatzluftfeder ist der Federdruck nicht konstant, sondern kann in den Luftbälgen mittels eines 12-Volt-Kompressors beliebig variiert werden. Dies erfolgt komfortabel aus dem Fahrerhaus heraus und ist sogar während der Fahrt möglich. Die Luftfederung erlaubt daher eine optimale Anpassung an verschiedene Beladungszustände. Ein Überströmstopp verhindert, dass in Kurven die Luft von einem Balg zum anderen strömt. Das bedeutet auf Knopfdruck bessere Kurvenstabilität und mehr Fahrsicherheit. Das Fahrverhalten wird komfortabler, Wank- und Nickbewegungen werden erheblich reduziert.
Balgen und Federn
Je nach Anforderung werden verschiedene Balgentypen verwendet. Beim Doppelfaltenbalg bestimmt eine Einschnürung in der Mitte die Richtung des Einfederns. Er ist daher komplett zusammengedrückt sogar als Anschlagbegrenzer zugelassen und bietet somit Notlaufeigenschaften selbst ohne Luftdruck. Er ist also besonders robust und betriebssicher.
Beim Kegelbalg hat der untere Teil einen geringeren Durchmesser und taucht daher in den oberen Balg ein, sodass sich der Gummischlauch außen über den Kolben stülpt. Auf diese Weise sind beträchtliche Hübe und sogar Kreisbahnen (AL-KO-Zusatzluftfeder) möglich. Da der Balg über keine Anschlagbegrenzung verfügt, wird der Fahrer bei zu geringem Luftdruck mithilfe eines Niederdruckschalters rechtzeitig gewarnt.
Der Roll- oder Schlauchbalg besteht aus einem gewebeverstärkten Gummischlauch, der an beiden Enden mit einer Kunststoffplatte luftdicht verschlossen ist. Von der Fußplatte ragt ein Kunststoffkonus in den Luftbalg hinein, der sich unter Druck über den Konus stülpt und an dessen Wänden auf und ab „rollt“. Rollbälge sind kostengünstig und bieten hohe Federkräfte bei kleinen Baumaßen.
Zur Druckluftversorgung der Bälge gibt es zwei verschiedene Systeme. Beim Einkreis-Luftfedersystem sind beide Luftbälge miteinander verbunden und werden über eine gemeinsame Leitung befüllt. Dieses System eignet sich für alle Fahrzeuge mit einer gleichmäßigen Gewichtsverteilung auf der Hinterachse.
Für Reisemobile, die durch Frischwassertanks, Gasflaschen, Klimaanlage, Generator usw. einseitig beladen sind, sodass sie nach einer Seite hängen, empfiehlt sich ein Zweikreissystem, bei dem die Luftbälge jeder Seite durch separate Leitungen befüllt werden. Über zwei Manometer im Fahrerhaus kann der Druck dann individuell geregelt werden, um eine leichte Schräglage auszugleichen.
So kann man das Niveau des Fahrzeugs durch Knopfdruck individuell anpassen – z. B. bei schwerer oder einseitiger Beladung. Aber auch bei Auffahrt auf eine Fähre kann durch kurzfristige Erhöhung des Luftdrucks in den Bälgen das Heck angehoben werden, damit es nicht aufsetzt. Ebenso kann man abends auf dem Stellplatz leichte Unebenheiten des Bodens bequem per Knopfdruck ausgleichen, statt mit Auffahrkeilen zu arbeiten.
Weiterhin zeigen Luftfedersysteme im Gegensatz zu Metallfedern keine Ermüdung, sodass sie ihre Federwirkung auch über lange Zeit konstant beibehalten. Das bedeutet Fahrkomfort und Sicherheit bei allen Beladungszuständen.
Wichtig sind Zusatz-Luftfedern für Pick-ups und Pritschenwagen mit Absetzkabine (s. u.), die mit sehr unterschiedlicher Last gefahren werden.
Am stärksten verbreitet sind Zusatz-Luftfedern an der Hinterachse. Es gibt aber auch Zusatz-Luftfedern für die Vorderachse sowie Vollluftfedern für Hinter- und Vorderachse.
Sonderfall: Absetzkabine
Pritschenwagen oder Pick-ups mit absetzbarer Wohnkabine haben den Vorteil großer Vielseitigkeit: Sie sind Personenwagen, Kleinlastwagen und Wohnmobil zugleich, sind durch den Allradantrieb geländegängig und bleiben auch bei viel Schnee im Winter kaum einmal hängen.
Aber sie haben auch eine große Schwäche: die Federung der Hinterachse. Ihre Starrachse mit Blatt- oder Schraubenfedern ist auf eine wechselnde, nicht auf eine andauernd hohe Belastung ausgelegt, sodass die Federn relativ schnell ermüden und das Heck dadurch absinkt. Zudem bezahlen diese Fahrzeuge ihre größere Bodenfreiheit mit einem entsprechend hoch liegenden Schwerpunkt. Verstärkt durch den hohen Wohnaufbau haben sie daher die Tendenz, sich in Kurven stark zur Seite zu neigen. Bei größerem Hecküberhang kann auch das Längswippen beim Überfahren von Bodenwellen erhebliche Probleme bereiten und selbst bei vorsichtiger Fahrweise auf der Straße zu schweren Schäden am Chassis führen.
Zusätzliche Blatt- oder Schraubenfedern sind hier keine wirkliche Lösung. Erstens ermüden sie mit der Zeit ebenfalls und zweitens ist das Fahrzeug dann ohne Last viel zu hart gefedert. Hier ist die flexible Luftfeder in ihrem Element, die sich auf Knopfdruck der unterschiedlichen Belastung anpassen lässt. Sie erhöht sowohl den Komfort als auch die Sicherheit durch eine stabilere Straßenlage ganz spürbar. Zudem kann sie bei Hindernissen kurzzeitig das Heck anheben, als Niveauausgleich dienen und beim Absetzen und Aufnehmen der Kabine sehr hilfreich sein. Dazu einfach bei maximalem Balgendruck die Stützen ausfahren, Halterungen lösen, Druck ganz ablassen und drunter wegfahren. Einziger Nachteil ist die durch den Einbau der Bälge etwas reduzierte Achsverschränkung, die aber nur bei extremen Offroad-Fahrten spürbar wird.
Sehr wichtig ist allerdings, dass man nicht nur die Federung verstärkt, sondern auch die Stoßdämpfer anpasst! Die ungedämpfte Hebelwirkung des Längswippens, selbst bei leichten Bodenwellen, kann sonst sehr rasch das Chassis schädigen. Dann hat das Fahrzeug nur noch Schrottwert und falls es gar während der Fahrt auseinanderbricht, ist ein schwerer Unfall unvermeidlich. Darauf achten bislang leider weder die Hersteller noch der TÜV!
Länge, Last und Fahrverhalten
Beachten Sie, dass Gesamtgewicht, Achslast, Fahrzeuglänge und Radstand das Fahrverhalten spürbar beeinflussen können. Wichtig ist nicht nur, dass das zulässige Gesamtgewicht eingehalten wird, sondern auch, dass der Schwerpunkt möglichst tief und weit vorne liegt. Hecklastigkeit entlastet die Vorderachse und bewirkt eine ungünstigere Straßenlage, zumal die Vorderachse beim Anfahren, Beschleunigen und am Berg zusätzlich entlastet wird. Besonders Fahrzeuge mit weitem Hecküberhang werden leicht hecklastig, wenn sie hinten einen großen Stauraum haben oder man einen Fahrrad-/Motorradträger anbaut. Für die Straßenlage ist daher ein langer Radstand stets günstiger („Länge läuft“!) als ein weiter Hecküberhang, da Hecklastigkeit zudem die Empfindlichkeit gegen Seitenwind und das Wanken spürbar erhöht. Ein längerer Radstand führt zwar zu einem größeren Wendekreis, welcher sich aber nach meinen persönlichen Erfahrungen weniger negativ auswirkt, als man denkt. Meist kann man auch mit kleineren Fahrzeugen nicht einfach auf der Straße wenden, sondern braucht einen Parkplatz oder Seitenweg, in den man rückwärts hineinstoßen kann. Und er fällt allemal weniger negativ ins Gewicht als eine instabile Straßenlage!
Reisemobile mit Frontantrieb können mit einem speziellen Tiefrahmen-Chassis (z. B. von ALKO) kombiniert werden, das den Schwerpunkt tiefer und mehr nach vorn verlegt, mehr Platz schafft und eine höhere Zuladung gestattet.
Was ist das Leergewicht und wie wird die Achslast berechnet?
Nach der StVO gilt als Leergewicht das Fahrzeuggewicht mit gefülltem Kraftstofftank plus 75 kg für den Fahrer. Nach der bestehenden Euronorm für die Angabe des Leergewichts umfasst der Wert das Wohnmobil inkl. Ersatzrad, Kühlwasser, Schmiermittel, Bordwerkzeug, Stromkabel, zu 90 % gefülltem Kraftstofftank, vollem Wassertank und maximalen Gasreserven sowie 75 kg pro eingetragenem Sitzplatz und einem Gepäckgewicht von 10 kg pro Person plus 10 kg pro Meter Fahrzeuglänge.