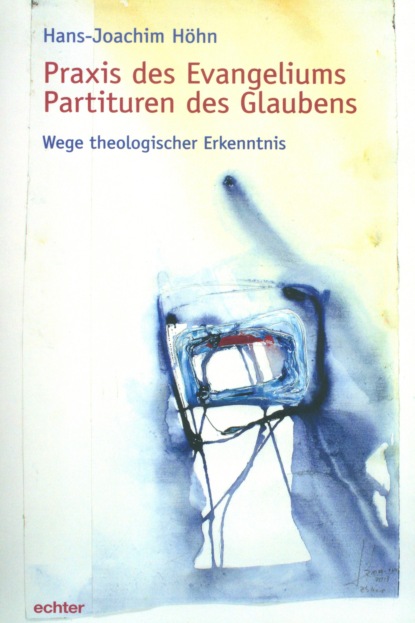- -
- 100%
- +
Die Prüfung, ob eine Botschaft als „Wort Gottes“ verstanden werden kann, hängt ab von der Möglichkeit, sich über ein zeitliches (diachrones) Kontinuum des geschichtlichen Ursprungs dieser Botschaft und ihrer authentischen Vergegenwärtigung vergewissern zu können.
In der katholischen Theologie und Kirche hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass das zeitlich-soziale Kontinuum der Vergegenwärtigung von Gottes Selbstoffenbarung durch die Größen Schrift – Tradition – Lehramt gewährleistet wird. Sie sind Instanzen der Weitergabe des Wortes Gottes (Evangelium) bzw. der Überlieferung und Vermittlung des Glaubens(grundes) zu beständiger Gegenwart.62 Allerdings stellt sich damit erst recht das eingangs bereits angesprochene Legitimationsproblem: Wie lässt sich der Anspruch rechtfertigen, dass diese Größen tatsächlich die authentische Weitergabe des Glaubens sichern können? Gibt es im Blick auf den in der Theologie- und Kirchengeschichte immer wieder aufbrechenden Biblizismus, Traditionalismus und Dogmatismus nicht genügend Gründe für die Annahme, dass diese Größen das Evangelium von der unbedingten Zuwendung Gottes zum Menschen eher entstellt und den Zugang zu ihm verstellt haben? Durchzieht nicht auch die „Heilige“ Schrift ebenso wie die Geschichte der Menschheit eine Blutspur der Gewalt, welche die Behauptung einer Liebe Gottes zu seiner Schöpfung als zynisch erweist? Hat nicht die Berufung auf vermeintlich unhintergehbare Überlieferungen und dogmatische Entscheidungen die Übersetzung des christlichen Kerygmas in neue Entsprechungsverhältnisse immer wieder verhindert? Anhand welcher Kriterien lässt sich erkennen und entscheiden, dass Schrift, Tradition und Lehramt in einer kontraproduktiven Weise für die Weitergabe des Glaubens in Anspruch genommen werden?
Im Rahmen einer theologischen Topologie des christlichen Glaubens werden diese Anfragen in der Regel ignoriert. Stattdessen geht man direkt zur theologischen Legitimation von Schrift, Tradition und Lehramt über. Wie diese Größen eine „äußere“ Beglaubigung der Inhalte des christlichen Glaubens und ihrer Weitergabe leisten (d. h. gleichsam als Bürgen auftreten), so sind sie ihrerseits durch bestimmte äußere Umstände als rechtens verbürgt: Das Neue Testament ist das früheste Zeugnis der Verkündigung Jesu. Als in diesem Sinne Ur-Kunde des Glaubens ist es wegen seiner apostolischen Verfasserschaft zugleich sein ursprüngliches und für alle anderen Vermittlungsweisen maßgebliches Zeugnis. Die Wahrheit dieses Zeugnisses sieht man verbürgt durch die „Inspiration“ der Autoren der neutestamentlichen Schriften. Die Tradition besteht dann in der authentischen Weitergabe dieses ursprünglichen Zeugnisses – beginnend bei den Zeugen der Verkündigung Jesu und über die schriftliche und mündliche Überlieferung dieser Überlieferung sich fortsetzend bis in die Gegenwart. Die Authentizität dieser Überlieferung sieht man wiederum verbürgt durch die „externe“ Instanz des kirchlichen Lehramtes. Dessen Träger sind dazu aufgrund der ihnen im Akt der (Bischofs)Weihe vermittelten Amtsgnade in besonderer Weise bevollmächtigt, was sie in entsprechenden Lehrentscheidungen zum Ausdruck bringen. Diese Lehrentscheidungen halten fest, was von Christen zu glauben ist.63
Die Problematik dieses Ansatzes, dem es primär um die Wahrung der Unversehrtheit der christlichen Botschaft geht, lässt sich durch eine Analogie verdeutlichen: Der Absender eines Briefes will sichergehen, dass seine Nachricht unverfälscht den Empfänger erreicht. Darum hat er sein Schreiben sorgfältig kuvertiert, den Briefumschlag fest verschlossen und bringt ihn als Einschreiben auf den Zustellweg. Damit ist eine lückenlose und als solche überprüfbare Weitergabe seines Briefes sichergestellt, bis er beim Adressaten ankommt. Ähnlich muss man für die Weitergabe des Evangeliums sorgen. Um sicherzugehen, dass der Inhalt des Evangeliums unverfälscht und unverändert, d. h. „original“, tradiert wird, muss man ihn in einem verschlossenen und versiegelten Umschlag weitergeben. Man muss die Boten seiner Weitergabe durch einen besonderen Eid auf ihre treue Dienstausübung verpflichten, ein Überwachungssystem installieren, das die Erfüllung dieses Eides kontrolliert, die Überwacher einem besonders strengen Auswahlverfahren unterziehen etc. Nur eines darf nicht geschehen: dass der Umschlag unterwegs geöffnet wird und in falsche Hände gerät. Und sollte er bei seinem rechtmäßigen Empfänger endlich ankommen, wird dieser gut beraten sein, Brief samt Umschlag angesichts der Bedeutung seines Inhaltes möglichst sicher zu verwahren.
So wenig eine solche extrinsezistische Absicherung der Weitergabe des Evangeliums jemals dazu führt, dass sich die Wahrheit des Evangeliums in seiner Praxis zeigt, so wenig genügt der Nachweis einer ungebrochenen Tradition und ebenso wenig reicht ein dem Inhalt äußerliches formales Kriterium aus, um sich existenziell und materialiter des Glaubensgrundes zu vergewissern. Wer sein Leben auf den Glauben an das Evangelium gründen will, dem kann zur Begründung der Hinweis auf eine geschichtlich niemals abgerissene Weitergabe des Evangeliums nicht genügen. Die Gewissheit einer existenziellen Tragfähigkeit des Glaubens, der Wahrheit seines Gegenstands und der Authentizität seines Ursprungs kann nur gegründet sein in der direkten Begegnung mit einer Botschaft, deren Wahrheit den Glauben zugleich weckt und trägt.
Die klassische Deutung des Zusammenwirkens von Schrift, Tradition und Dogma / Lehramt weist den Konstruktionsfehler auf, dass sie die Authentizität der Weitergabe der christlichen Botschaft primär von der Beachtung formaler Kriterien – wie etwa der apostolischen Sukzession kirchlicher Amtsträger – abhängig macht. Zwar steht dahinter die durchaus zutreffende Annahme: Der Geltungsanspruch der christlichen Verkündigung ist nur dann einlösbar, wenn durch sie die Offenbarung des „Wortes Gottes“ geschichtlich tradierbar und sozio-kulturell jeweils neu antreffbar wird. Für die Sicherung dieser Antreffbarkeit ist es aber nicht hinreichend, dass formale Kriterien erfüllt werden. Vielmehr muss es eine materiale Kontinuität zwischen dem Wirken Jesu von Nazareth und heutiger Verkündigung geben können.64 An sein Wirken ist die gegenwärtige Verkündigung inhaltlich zurückzubinden.
Die Bedeutung kirchlicher Ämter, der liturgischen Tradition und Bekenntnisbildung besteht im Dienst an der Rückbindung gegenwärtiger Verkündigung an den Anfang und Grund des Evangeliums. Dies gilt auch für die Hl. Schrift. Auch sie ist Ausdruck der Tatsache, dass der Glaube der Christen sich der Übersetzung des Evangeliums in jeweils neue und andere Lebensverhältnisse verdankt. Der Glaube entstammt nicht deswegen einem Übersetzungsgeschehen, weil es Schrift, Tradition und Dogma gibt.65 Diese Größen stehen im Dienst dieser Übersetzung, sind aber nicht deren apriorische Bedingung. Als Medien der Weitergabe des Glaubens sind sie zugleich Ausdruck des Umstands, dass das Evangelium darauf angewiesen ist, in jeweils neue Entsprechungsverhältnisse von Gottes Menschenverhältnis übersetzt zu werden!
Für eine angemessene Bestimmung von Funktion und Relevanz der Größen „Schrift – Tradition – Lehramt“ bietet es sich daher an, beim performativen Charakter des „Wortes Gottes“ bzw. der Verkündigung Jesu anzusetzen. Dieser Charakter kennzeichnet die Koinzidenz von Vollzug und Gehalt des Wortes Gottes: Es realisiert, wovon es spricht. Es sagt zu, worüber es redet. Diese Koinzidenz hat kriteriologische Bedeutung für alle bei der geschichtlichen Erschließung und Vermittlung des Evangeliums beteiligten Instanzen.
Die originäre Gegebenheitsweise des „Wortes Gottes“ als performative Zusage unbedingter Zuwendung wird im Prozess der Weitergabe des Evangeliums selbst zum Prüfstein der Übereinstimmung mit seinem Grund und Inhalt. Wer den christlichen Glauben authentisch bezeugen, auslegen und verstehen will, muss sich an der Koinzidenz von Vollzug und Gehalt unbedingter Zuwendung orientieren.
Die Grundfrage einer Topologie des christlichen Glaubens, wie man sich im Modus zeitversetzter Gleichzeitigkeit seines Ursprungs und seines Grundes vergewissern kann, ist vor diesem Hintergrund lösbar, wenn man Jesu Botschaft vom Menschenverhältnis Gottes als Partitur begreift, von der man buchstäblich Gebrauch machen muss. In einer Partitur stecken die Aufforderung und die Anleitung, die Realität und Bedeutung einer Komposition in der Performation der Notenzeichen, d. h. durch den Vollzug einer Handlung („Aufführung“), zu realisieren.66 Eine Partitur macht es möglich, das Werk eines Komponisten über einen großen zeitlichen Abstand hinweg (nahezu) originalgetreu wieder aufzuführen. Wer bei der Uraufführung nicht dabei war, kann gleichwohl zeitversetzt mit dem Geschehen gleichzeitig werden. Anhand einer Partitur lässt sich auch überprüfen, inwieweit spätere Aufführungen in Entsprechung zu einer Komposition stehen. Bei aller gebotenen Werktreue lassen Partituren stets die notwendige Freiheit, hinsichtlich Instrumentierung, Besetzung der Hauptrollen, Aufführungspraxis etc. veränderten Verhältnissen gerecht zu werden. Liegt die Partitur einer Komposition vor, ist es möglich, auf jeweils zeitgemäße Weise dem Anspruch und Gehalt der Komposition zu entsprechen. Eine Partitur wird jedoch um ihren Anspruch und um ihre Wirkung gebracht, wenn ihr Notenbild lediglich unversehrt verwahrt und ihre Verwahrer sorgfältig überwacht werden.
Im Blick auf das performative Verständnis christlicher Verkündigung kann von der Trias „Schrift – Tradition – Lehramt“ gesagt werden, dass sie Konstellationen der performativen Antreffbarkeit des Evangeliums markiert: Die Hl. Schrift bildet die (ursprüngliche) Partitur dieses Geschehens, in der Weitergabe dieser Partitur im Modus ihrer „Aufführung“ in den sich geschichtlich wandelnden Lebensverhältnissen der Glaubenden manifestiert sich der Traditionszusammenhang des Glaubens und die Bedeutung eines Lehramtes macht sich daran fest, die Einheit in der Verschiedenheit unterschiedlicher „Performanzen“ des Evangeliums konsensuell zum Ausdruck zu bringen. Diesen Größen kommt jedoch nur insoweit eine formale Normativität zu, als sie dem performativen Charakter des Evangeliums gerecht werden. Mit diesem performativen Charakter des Ineinsfalls von Zusage und Verwirklichung von Gottes Zuwendung zum Menschen ist die materiale Normativität des Evangeliums verbunden.
Wenn das Verhältnis Gottes zum Menschen als Ereignis unbedingter Zuwendung vergegenwärtigt werden soll, kann dies angemessen nur in der Tradition des Ineinsfalls von Vollzug und Gehalt solcher Zuwendung geschehen. Lediglich in einem instruktionstheoretischen Offenbarungsverständnis (d. h. Offenbarung besteht in einer Mitteilung von Informationen) ist eine andere Lösung möglich. Bei der Vermittlung göttlicher Instruktionen kann der Inhalt des einst Mitgeteilten weitergegeben werden, ohne den ursprünglichen Akt der Mitteilung einer Information wiederholen zu müssen. Hier genügt es, eine originalgetreue Abschrift der ursprünglichen Mitteilung anzufertigen und zu tradieren.67 Wenn aber der Inhalt der Offenbarung mit ihrem Akt koinzidiert, ist es unabdingbar, zum Akt der Offenbarung Zugang zu erhalten. Wenn also Schrift, Tradition und Dogma relevant sein wollen für die Vergegenwärtigung des Glaubensgrundes, dann müssen sie verweisen auf die Reaktualisierung der Einheit von Vollzug und Gehalt der Selbstoffenbarung Gottes.
Schrift, Tradition und Dogma sind nur insoweit normativ für die Weitergabe des Glaubens, als sie selbst der Koinzidenz von Vollzug und Gehalt unbedingter Zuwendung gerecht werden bzw. in deren Dienst stehen.
Die Vermittlung des christlichen Glaubens (fides quae) entspricht also nur dann der Verkündigung Jesu, wenn sie selbst die Verlaufsform unbedingter Zuwendung zum Menschen annimmt. In ihrem Zeugnis muss sie vollziehen, was sie bezeugt. Mehr noch: Wenn die Offenbarung Gottes in Jesus von Nazareth bestimmt ist durch die Koinzidenz von Vollzug und Gehalt unbedingter Zuwendung, dann kann es eine Weitergabe und Vergegenwärtigung dieser Offenbarung nur geben, wenn diese Koinzidenz tradiert werden kann.
3.1. Heilige Schrift: Den Glauben bezeugen
Die bisher in immer neuen Anläufen verdeutlichte Korrespondenz und Koinzidenz von Vollzug und Gehalt bei der Weitergabe des Evangeliums stellt zweifellos eine problemerzeugende Problemlösung dar. Sie gibt eine Antwort auf die Herausforderung einer zeitversetzten Gleichzeitigkeit mit dem Grund-Geschehen des Christentums. Aber sie muss sich auch fragen lassen, ob sie zureichend abgesichert ist und nicht vielleicht eine Reihe von problematischen Sachverhalten unterschlägt. Dies gilt zunächst und vor allem für die Bestimmung von Autorität und Normativität der Hl. Schrift als ursprünglicher Partitur einer Vergegenwärtigung des „Wortes Gottes“. An ihr vorbei ist demnach das „Wort Gottes“, wie es in der Verkündigung Jesu vergegenwärtigt wurde, nicht zugänglich. Sie ist somit nicht in einem beliebigen Sinn autoritativ oder normativ für den Glauben, sondern nur in dem Sinn, in dem es ihr um die Zusage von Gottes Zuwendung zum Menschen geht. Zur Einlösung dieses Anspruchs bedarf es der Praxis ihres Inhaltes, d. h. unbedingter Zuwendung zum Menschen.
Gegen diese These sind gewichtige Einwände denkbar, die es auf den ersten Blick fraglich erscheinen lassen, ob sie tatsächlich Bestand haben kann:
– Ist es statthaft, in der Reflexionsfigur „Koinzidenz von Vollzug und Gehalt unbedingter Zuwendung Gottes zum Menschen“ die Grundaussage nicht bloß des Neuen Testamentes, sondern der ganzen Bibel zusammenzufassen? Lässt sie sich wirklich auf sämtliche „Bücher“ der Bibel beziehen?68 Wie ist mit jenen biblischen Texten umzugehen, die eine ganz andere Geschichte erzählen: die Gottverlassenheit des Menschen, die Erfahrung der Abwendung Gottes von den Menschen, Gottes Zorn über die Abwendung der Menschen von Gott?69
– Verdient das Neue Testament wirklich das ursprüngliche Zeugnis der christlichen Verkündigung genannt zu werden, wenn doch jeder seiner einzelnen Schriften eine Phase der mündlichen Tradition der Jesusbotschaft vorausging und die Zusammenstellung eines Kanons der biblischen Schriften bis zu seiner Endredaktion mehrere Jahrhunderte brauchte?70 Wie kann man sicher sein, dass tatsächlich die ältesten Zeugnisse aus der Ursprungszeit des Christentums erfasst wurden?
– Verdankt das Neue Testament seine Autorität und Normativität wirklich sich selbst und nicht einem Konsens kirchlicher Autoritäten, die einen verbindlichen Schriftkorpus (Kanon) zusammengestellt haben?71 Steht dies nicht im Widerspruch zur Behauptung, die Hl. Schrift sei „norma normans“ der Verkündigung bzw. die Kirche stünde nicht über dem „Wort Gottes“?
Diese Anfragen entstammen theologischen Debatten, die weit über das Feld einer Topologie des christlichen Kerygmas hinausgehen. Zum Teil werden sie von Seiten der Religionskritik immer wieder neu an die Theologie adressiert, wenn es etwa um das Gewaltpotenzial der biblischen Gottesrede geht.72 Zu einem anderen Teil rühren sie an das Verhältnis von Exegese und Dogmatik,73 tangieren Anspruch und Alternativen historisch-kritischer Bibelhermeneutik74 oder erinnern an lang zurückliegende, aber vielleicht noch immer virulente christlich-konfessionelle Differenzen und Kontroversen.75 Auf diese Kontexte kann an dieser Stelle nur hingewiesen werden; im Rahmen einer vorläufigen Antwort auf die oben formulierten Einwände sind sie zudem nur von mittelbarer Bedeutung.76
(1) Zunächst ist festzuhalten, dass nicht das Neue Testament in seiner Schriftgestalt unmittelbarer Ausdruck des „Wortes Gottes“ ist. Zunächst bildet es samt und sonders den schriftlichen Niederschlag menschlicher Erfahrung und Deutung des Wirkens Jesu. Als ein solches Zeugnis ist es selbst „Gottes Wort im Menschenwort“77, indem und insofern es das Leben und Wirken Jesu als „Wort Gottes in Person“ vergegenwärtigt. In ähnlicher Weise ist vom Alten Testament zu sagen, dass es der Niederschlag einer menschlichen Resonanzerfahrung von Gottes Schöpferwort ist. Es erinnert an das bleibende gegenseitige „Im-Wort-Sein“ von Gott und Mensch und es verschweigt jene Situationen nicht, die als Wortbruch Gottes wie des Menschen erlebt werden können. Es macht eindrücklich klar, dass auch dem glaubenden Menschen nichts erspart bleibt an Krankheit, Leid und Gewalt. Auch die Erfahrung der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins hat ihren Ort in den „Resonanzen“, die das Hören auf das Wort Gottes auslöst.
Wenn es überhaupt eine Grundaussage einer gesamtbiblischen Theologie geben kann, dann wird sie den „Wortcharakter“ der Schöpfung bzw. das gegenseitige „Im-Wort-Sein“ von Schöpfer und Geschöpf zum Thema haben müssen.78 Dann aber wird man den performativen Charakter dieses Wortes zu bedenken haben und damit einen hermeneutischen Schlüssel gewinnen, der die unterschiedlichen Texte der Bibel jeweils nach ihrer Eigenart als Zuspruch und Anspruch dieses Wortes deutbar macht, aber auch jenes nicht auslässt, was im Modus des Widerspruchs zu vermeintlich letzten Worten über Mensch und Gott von den Texten selbst artikuliert wird.
Das biblische Reden von Gott ist allerdings so facettenreich, dass es jeder Behauptung „so und nicht anders ist Gott“ widerstreitet. Die Bibel schärft immer wieder ein: „Nicht so, sondern anders ist Gott“. Das gilt auch für die Rede von der Liebe Gottes – es ist eine andere, eine durchkreuzte und gekreuzigte Liebe, in der sich ein Mensch der Erfahrung von Leid und Gewalt zum Trotz geborgen wissen soll. Diese Liebe wird dem Menschen im Modus eines Versprechens zugesagt. Es macht die Eigenart eines Versprechens aus, dass man seine Einlösung unterstellen muss in Situationen, die gegen seine Erfüllung sprechen. Wer ein Versprechen annimmt, muss das Versprochene kontrafaktisch als eingelöst annehmen. Wer ein Versprechen gibt, muss von dem, der es annimmt, bereits als jemand angesehen werden, der es hält – auch wenn die Umstände noch nicht darauf schließen lassen.
Vor allem ist die Bibel auch Ausdruck dafür, dass sich der Mensch von Gott zur Rede stellen lässt. Darum ist sie Ausdruck seiner vielfältigen Antwort auf Gottes Schöpferwort. Diese Antwort umfasst alle Themen und Formen, die auch der betende Mensch kennt und praktiziert: Lob und Dank für den erfahrenen, wohltuenden Unterschied zum eigenen Nichtsein und zu einem „gottverlassenen“ Leben, aber auch Bitte und Klage angesichts des Bedrohtseins vom eigenen Nichtsein und von der Erfahrung bedrängender Gott- und Menschenverlassenheit.
(2) Die Ergebnisse historisch-kritischer Bibelforschung nötigen in der Tat zu einer Präzisierung, was die Priorität und den Primat des Neuen Testamentes für die Weitergabe der christlichen Botschaft betrifft. Sie kann nicht in einem historischen Sinn als deren ursprüngliches Zeugnis, wohl aber als Zeugnis des Ursprungs gelten. Auch das Postulat der apostolischen Verfasserschaft ist im historisch-kritischen Sinn für etliche Schriften des Neuen Testamentes nicht erfüllbar. Dies würde aber nur dann ihre Relevanz und Autorität schmälern, wenn dafür das formale Kriterium der „Anciennität“ ausschlaggebend wäre. Wenn aber gilt, dass formale Kriterien nicht abgelöst von materialen Überlegungen in Stellung gebracht werden dürfen, dann genügt für den kanonischen Status von Texten das Bestehen folgender Testfrage: Haben die zum Zeitpunkt der Kanonisierung ältesten verfügbaren und bis dahin im katechetischen bzw. liturgischen Gebrauch stehenden Texte in ihrer Wirkungsgeschichte gezeigt, dass Menschen durch sie immer wieder an sich selbst den Gehalt der Botschaft Jesu als wahr und wirklich erfahren können?
Im Übrigen setzt die Sorge, durch den frühzeitigen Verlust oder durch die Unterschlagung einer bestimmten Schrift sei unsere Kenntnis von Person und Wirken Jesu unvollständig, in unzulässiger Weise voraus, dass die Botschaft Jesu mit einem Puzzle vergleichbar ist, bei dem sich ein vollständiges Bild erst dann ergibt, wenn alle Puzzlestücke zusammengesetzt wurden.79 Das christliche Kerygma besteht aber nicht aus einer Addition von Textteilen zu einem Gesamttext, sondern aus der Koinzidenz von Vollzug und Gehalt einer unbedingten Selbstzusage Gottes. Wenn diese Koinzidenz im Blick auf die Texte des Neuen Testamentes nicht aufweisbar bzw. performativ nicht darstellbar ist, hilft eine noch so große Sammlung von „kanonischen“ Schriften nicht weiter. In diesem Fall wäre sie aus theologischer Sicht formal und material „unvollständig“.
(3) Die Zusammenstellung des Kanons der neutestamentlichen Schriften stellt aus heutiger Sicht ihrerseits eine problemerzeugende Problemlösung dar. Gelöst werden musste das Problem, dass bereits im 2. Jahrhundert eine Situation der „literarischen Unübersichtlichkeit“ eingetreten war und etliche Texte kirchlich im Umlauf waren, die unter gnostischem Einfluss auf eine Rückbindung an das geschichtliche Ursprungsgeschehen der christlichen Verkündigung kaum mehr Wert legten. Von der Kirche zu leisten war eine Antwort auf die Frage: Anhand welchen Kriteriums lässt sich ermitteln, ob ein Text überhaupt in den Korpus der Heiligen Schrift aufgenommen werden soll? Die Entdeckung eines solchen Kriteriums ist in der Tat die Leistung der Kirche. Dies gilt auch für den Akt der Aufstellung eines Kanons. Hierbei handelt es sich um ein historisch kontingentes Geschehen.80 Woran die Kirche dabei aber Maß nimmt, ist nicht sie selbst. Auch ist nicht der Kanon als solcher maßgebend, sondern in und mit dem Prozess der Kanonbildung findet die Kirche den Maßstab, an dem Maß zu nehmen ist, wenn sie das Maßgebliche des Glaubens ermitteln will. Als Prüfstein gilt die Frage: Enthält ein Text die Wahrheit, die Gott den Menschen um ihres Heils willen mitteilen wollte?81 Ist es eine Wahrheit, auf die ein Mensch sich im Leben und Sterben verlassen kann? Hierbei geht es fraglos nicht um ein Heil, das von der Kirche kommt, und es geht auch nicht um Texte, die allein wegen ihrer apostolischen Verfasserschaft heilsrelevant sind.
Käme es allein auf das Kriterium der Apostolizität an, würde der bestehende Kanon ein Problem erzeugen, das sich angesichts der Ergebnisse historisch-kritischer Forschung verschärft: Zu den 27 Schriften des Neuen Testamentes zählen etliche Paulusbriefe, denen keine apostolische Verfasserschaft zukommt. Es fehlen hingegen Texte, wie etwa der erste Clemensbrief oder der „Hirt des Hermas“, die durchaus in die apostolische Zeit zurückweisen. Stattdessen ist der 2. Petrusbrief aufgenommen worden, dessen Entstehungszeit bereits ins 2. Jahrhundert fällt. Unberücksichtigt bleiben dagegen ein Petrus-, Thomas- und Jakobusevangelium, die möglicherweise authentische Jesusworte enthalten.
Dass es dennoch beim bestehenden Kanon bleiben kann, lässt sich kaum anders rechtfertigen als durch die bereits benannte „regula fidei“: Die kanonisierten Texte sind Partituren für die Tradition der Koinzidenz von Vollzug und Gehalt des christlichen Kerygmas. Dass sie unter dieser Rücksicht ein Bezeugungsort der Heilszusage Gottes ist, macht die Autorität der Hl. Schrift aus. Dass die Kirche diese Autorität anerkennt, begründet die Normativität des Kanons für die Vermittlung des christlichen Glaubens. Aber nicht der Kanon als solcher ist maßgebend für Theologie und Kirche. Seine regulative Bedeutung besteht vielmehr darin, dass er angibt, wo und wie der normative Maßstab für die Übersetzung des christlichen Kerygmas in andere Formen der Verkündigung und Glaubenspraxis zu suchen und zu finden ist.
Nicht zuletzt aus diesem Grunde muss auch die Kategorie der Inspiration einer Revision unterzogen werden. Seitdem sie theologisch eingeführt wurde, musste sie hinsichtlich ihrer supranaturalistischen Annahmen sukzessive abgeschwächt werden. Weder ließ sich die Behauptung der Inspiriertheit des konkreten Wortlautes (Verbalinspiration) aufrechterhalten, noch hatte die Version der Personalinspiration mit Bezug auf die Verfasser der Schrift für längere Zeit Bestand.82 Problematisch an diesen Konzepten ist der Versuch, die herausgehobene Bedeutung der Hl. Schrift durch einen besonderen, äußeren Umstand ihrer Entstehung zu legitimieren. Die „Inspiration“ von Text und Autor wird gedacht im Modus einer Überbietung des menschlichen Anteils am Zustandekommen von Texten durch eine göttliche Zutat oder ein spezielles göttliches Mitwirken. Auf diese Weise wird „Inspiration“ zur Kennzeichnung eines formalen Merkmals der Hl. Schrift oder ihrer Entstehung: Die Verfasser der biblischen Texte wurden von Gott in besonderer Weise dazu autorisiert, so dass diesen Texten eine besondere Autorität zukommt.