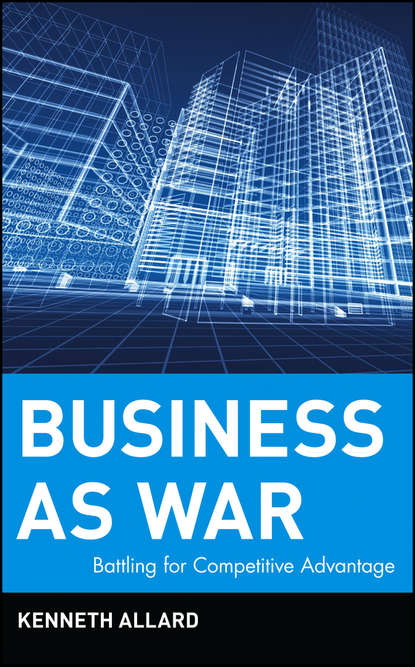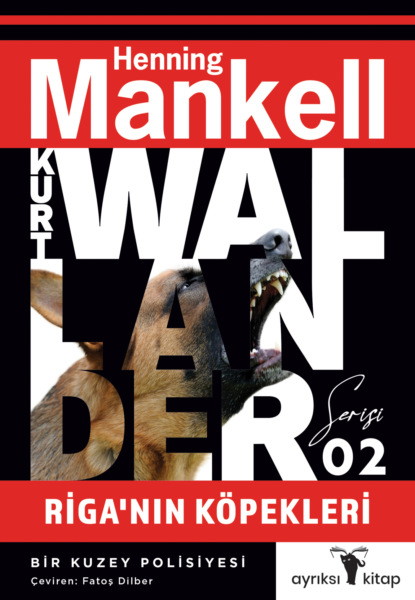- -
- 100%
- +
Den Anfang des Verstehens bildet gleichwohl das Nicht-Verstehen. Erst das Klarwerden über das, was unklar ist, ebnet den Weg zu Einsichten.8 Dazu gehört auch die Prüfung, ob das, was jeweils selbstverständlich erscheint, auch wirklich der kritischen Nachfrage standhält. Erkenntnis beginnt mit dem Problematisieren des scheinbar Selbstverständlichen. Darum kommt es der Theologie zu, dass sie gegenüber dem Umgang mit dem Wort „Gott“ zunächst Bedenken anmeldet. Anders kann sie ihrer Zeit und ihrer Sache nicht gerecht werden. Sie hat mit der Frage zu beginnen, ob das, was in dieser Zeit „Gott“ genannt wird oder mit diesem Wort bestritten wird, in Wahrheit verdient, so genannt und bestritten zu werden. Sie hat den Schwierigkeiten nachzugehen, welche das Reden von Gott in der Moderne in die Krise gebracht haben, und sie muss die großen Enteignungen des Christentums im Blick behalten. Diese betreffen den Nachweis der Entbehrlichkeit Gottes für die Erklärung der Welt und ihres Entstehens, den Nachweis der Verzichtbarkeit Gottes für die Begründung einer menschendienlichen Moral und den Nachweis für den fehlenden Bedarf des Wortes „Gott“ in unserer Sprache. Eine der Wahrheitsfrage verpflichtete Wissenschaft kann nicht anders, als mit Infragestellungen und nicht mit Wahrheitsbehauptungen zu beginnen.
1.1. Enteignungen:
Vom Verbrauch des Wortes „Gott“
Was dem Glauben selbstverständlich ist, erscheint vielen säkularen Zeitgenossen heute als unverständlich. Von der Wirklichkeit Gottes auszugehen und darüber wahre Aussagen machen zu wollen, erachten sie als ein Ding der Unmöglichkeit. Mehr noch: Sie halten bereits die Wirklichkeit Gottes für etwas Unmögliches. Dennoch darüber zu reden gilt ihnen als eine nicht zu rechtfertigende Zumutung. Folglich erweist sich ihnen auch der Glaube an Gott als ein „Ding der Unmöglichkeit“, da der Bezug auf etwas Unmögliches selbst wiederum unmöglich ist und allenfalls als Illusion oder Projektion zu betrachten ist. Wenn der Glaube aber heute tatsächlich einen Wahrheitsanspruch erhebt, muss er das, wovon er redet, von etwas Unmöglichem unterscheiden können.
Dagegen war in früheren Zeiten die Bedeutung des Wortes „Gott“ anscheinend klar und eindeutig. Die Rede von Gott bezeichnete nicht nur etwas, das zu denken möglich war. Sie meinte auch etwas, das zu denken notwendig war: Gott ist im Rahmen einer Welterklärungstheorie das „erste Unbewegte, aber alles Bewegende“, der letzte und weltjenseitige Grund alles Seienden und als solcher auch der Garant einer Ordnung der Werte und Normen. Gott ist die notwendige Bedingung für alles Bedingte, die unabdingbare Ermöglichung alles Möglichen und Wirklichen, der Bürge für die Gültigkeit von Recht und Gesetz. In Gestalt der „Gottesbeweise“ versuchte die Theologie, durch rationale Argumentation das dem Glauben Selbstverständliche (d. h. die Existenz Gottes) in eine dem Denken zumutbare Erkenntnis zu überführen. Zumindest sollte jede/r Denkende der vom Glauben für selbstverständlich gehaltenen Rede von der Existenz Gottes am Ende mit so viel Verständnis begegnen können, dass sie als „nicht-unvernünftig“ qualifizierbar erscheint. Dabei wurde von unstrittigen Erfahrungen (z. B. von der Kontingenz der Welt) ausgegangen, die in eine Argumentation eingingen, deren Akzeptanz unabhängig von jedem Glauben ein Gebot der Vernunft darstellt und am Ende dazu führen sollte, dass zwischen Denkenden und Glaubenden ein rationales Einverständnis hinsichtlich der widerspruchsfreien Vertretbarkeit des Gottesgedankens entsteht.9 Eine solche Argumentation hatte zwar nie eine „konstitutive“, aber oft eine „propädeutische“, meist eine „explikative“ und zuweilen auch eine „verifikative“ Funktion.10 Es ging nicht darum, die Überzeugung von Gottes Existenz diskursiv zu erzeugen, sondern die Berechtigung und Verantwortbarkeit dieser (prädiskursiven) Überzeugung zu demonstrieren. Die „verifikative“ Funktion der Gottesbeweise darf hierbei ebenso wenig überschätzt werden wie die Falsifikation dieser Funktion: Denn sollte ein Gottesbeweis misslingen, ist damit zwar die Verifikation einer religiösen Überzeugung fehlgeschlagen, nicht aber diese Überzeugung selbst schon falsifiziert. Auf den Fehlschlag eines Gottesbeweises reagieren die Nachdenklichen unter den Glaubenden darum auch nicht mit der Aufgabe ihres Glaubens. Vielmehr bemühen sie sich um neue und bessere Argumente zur Rechtfertigung ihrer Überzeugung.
Im Übrigen ist das existenziell (und religiös) Gewisse nicht deckungsgleich mit dem rational Zwingenden. Der Gottesglaube zählt zu jenen existenziellen Gewissheiten, auf die Menschen „nichts kommen lassen“. Die Wege, auf denen man zu solchen Gewissheiten kommt, sind nicht allein die Wege stringenter rationaler Argumentation. Das Leben kennt noch andere Lehrmeister als die Vernunft! Wozu man auf Wegen gekommen ist, die nicht die Wege der Vernunft sind, dazu muss man dennoch auf vernünftige Weise stehen können. Überzeugungen, die im Widerspruch zu den Prinzipien kritischer Rationalität stehen, können auf Dauer niemanden überzeugen, bringen sich um ihre Geltungsfähigkeit und diejenigen, die sie nicht aufgeben, letztlich um ihren Verstand.11 Darum gilt der Grundsatz „nihil credendum nisi prius intellectum“ (P. ABAELARD): Nichts kann als Gegenstand des Glaubens ausgegeben werden, das nicht zuvor auf seine Verstehbarkeit und Vertretbarkeit hin geprüft wurde. Gottesbeweise sind Ausdruck einer solchen „fides quaerens intellectum“, d. h. intellektueller Bemühungen um die (rationale) Rechtfertigung einer von der Vernunft nicht hervorzubringenden Überzeugung (dass Gott existiert), die gleichwohl vernunftgeleiteter Wirklichkeitserfahrung und -deutung entspricht.12
In der Moderne sind jedoch die Voraussetzungen für solche Füllungen des Wortes „Gott“ weitgehend kollabiert. Jede für unbezweifelbar gehaltene Prämisse menschlichen Denkens, Wollens und Tuns, die etwa in den kosmologischen, physikotheologischen und ontologischen Gottesbeweis einging, lässt sich seit I. KANTS „Kritik der reinen Vernunft“ mit guten Gründen in Frage stellen.13 Seitdem steht die Auffassung, das Bemühen der theoretischen Vernunft um eine widerspruchsfreie Beschreibung der Welt und ihres Herkommens könne ohne religiös-metaphysische Zusatzannahmen nicht erfolgreich sein, auf sehr schwachem Fundament. Es ist signifikant, dass Kants Alternativentwurf, die Gottesfrage vor der Instanz der praktischen Vernunft zu verhandeln,14 mit einer Verschiebung des Beweisziels einhergeht. Die Konklusion dieser Argumentation lautet nicht: „Also existiert Gott bzw. das, was alle ‚Gott‘ nennen.“ Sein „postulatorischer“ bzw. ethico-theologischer Gottesbeweis führt vielmehr zu der Schlussfolgerung: „Also sollte man als Vernunftsubjekt so denken und handeln, als ob es Gott gebe!“ Gott ist nicht länger Gegenstand eines Wissens, einer objektiven Erkenntnis, sondern einer Sinnoption bzw. einer Hoffnung, die philosophisch verantwortbar ist, weil sie die praktische Vernunft um ihrer eigenen Rationalität und Moralität willen unterstellen muss: Die moralischen Forderungen der praktischen Vernunft sind für den Menschen nur dann rational zumutbar, wenn die Erfüllung dieser Forderungen zu einem Ergebnis führen wird, dem er mit Vernunftgründen zustimmen kann. Der hierfür notwendige Nexus zwischen moralischer Gesinnung, moralischer Tat und rational akzeptablen Handlungsfolgen ist aber nur dann gegeben, wenn die naturgesetzlich bestimmte Wirklichkeit mit der vom Sittengesetz bestimmten Welt letztlich zusammenstimmt bzw. mit ihr vermittelbar ist. Auf diese Vermittlung muss die praktische Vernunft notwendig setzen, wenn sie die Forderungen des Sittengesetzes für rational zumutbar halten will. Das Postulat der Existenz Gottes formuliert jene unerlässliche Bedingung, um die praktische Vernunft vor einem Widerspruch zu bewahren, in dem sie sich selbst aufheben würde.15
Die einzelnen Argumentationsschritte stellen sich wie folgt dar: (1) Die praktische Vernunft enthält eine unbedingte Verpflichtung (kategorischer Imperativ) zur Herstellung einer „moralischen“ Welt, deren Verpflichtungskraft durch sich selbst gegeben ist und einleuchtet (Autonomie der Moral). (2) Gegen die Erfüllbarkeit dieser Vernunftpflicht sprechen empirische Umstände (Endlichkeit des Menschen, Schicksalsschläge, naturgesetzliche Determinierung der Welt), die das Erreichen des moralisch gebotenen Zieles grundsätzlich verhindern können und dies de facto nur zu oft auch tun. (3) Kein Mensch könnte und dürfte dieser unbedingten Verpflichtung folgen, wenn die Herstellung einer „moralischen Welt“ faktisch unmöglich wäre oder ihm nur Nachteile brächte. Sie wäre selbst „unvernünftig“, wenn durch sie ein Widerspruch zwischen dem von der Vernunft unbedingt Gebotenen und dem vom Menschen in seiner Lebenspraxis (aus Klugheitsgründen) zu Vermeidenden bzw. zum empirisch und geschichtlich Möglichen entstehen würde. (4) Weder darf aus Vernunftgründen die Verpflichtungskraft des kategorischen Imperativs relativiert werden noch darf aus Vernunftgründen das Faktum der empirischen Nichtherstellbarkeit einer „moralischen Welt“ ignoriert werden. (5) Die Unbedingtheit des kategorischen Imperativs verlangt nach seiner „kontrafaktischen“ Umsetzung. Die rationale Unbedingtheit des Sittengesetzes (kategorischer Imperativ) und die rationale Zumutbarkeit seiner kontrafaktischen Erfüllung setzen eine Instanz voraus, welche die Befolgung des Sittengesetzes angesichts des o. a. Widerspruchsproblems erst möglich macht. (6) Die gesuchte Instanz kann zwar in der Erfahrungswelt nicht gefunden werden. Von ihr müssen jedoch sowohl das Vermögen zur Überwindung des Kontrafaktischen als auch zur Erfüllung des Sittengesetzes ermöglicht werden. (7) Ohne das Postulat der Existenz Gottes bzw. einer „eschatologischen“ Vollendung als Bedingung der Möglichkeit einer kontrafaktischen Erfüllung des Sittengesetzes kann die unbedingte Geltung des Sittengesetzes und Verpflichtungskraft der Vernunftpflichten diese Zerreißprobe nicht bestehen.
Allerdings ist auch dieser Ansatz nicht vor einem Einwand gefeit, der die Gottesbeweise der theoretischen Vernunft an ihrer empfindlichsten Stelle trifft. Was als denknotwendig behauptet wird, ist damit noch nicht als seinsnotwendig erwiesen. Und falls dies dennoch gelingen sollte, wäre dies wiederum nur eine gedachte Notwendigkeit. Auch der Gottesgedanke der praktischen Vernunft gründet nicht in einer dem moralischen Bewusstsein vorgegebenen und von ihm real verschiedenen, objektiven Wirklichkeit. Vielmehr konstituiert das moralische Bewusstsein diese Wirklichkeit als ein „Postulat“, das letztlich nur einen bewusstseins- und sprachimmanenten Ausdruck der Logik und Struktur ethischer Rationalität darstellt. Hier wird nicht thematisiert, was ihr vorgegeben ist, sondern was ihr mitgegeben ist. In seinem moralischen Bewusstsein weiß sich das Vernunftsubjekt zwar auf eine ihm transzendent (d. h. transsubjektiv) erscheinende Wirklichkeit bezogen. Allerdings weiß es darum nur in der Weise einer bewusstseinsimmanenten bzw. „intramentalen“ Vergegenwärtigung, so dass es über deren transsubjektiven oder transzendenten („übernatürlichen“) Realitätsstatus nichts sagen kann, was dem Risiko ihrer Projektion als einer selbständigen Größe entgeht. „Als bewusstseinsimmanentes Verhältnis bezieht das Gottesbewusstsein den semantischen Gehalt des Ausdrucks ‚Gott‘ auf den nur ihm gegebenen Mentaleindruck, ohne dass dieser eine Beziehung auf eine extramentale selbständige Realität implizierte.“16 Selbst wer aus Gründen der Vernunft auf ein „Gottespostulat“ setzt, muss auf die Einlösung von Geltungsansprüchen verzichten, welche über die Sprach- und Bewusstseinsimmanenz der Rede von Gottes Wirklichkeit hinausgehen. Man muss zwar nicht so weit gehen und behaupten, hier werde Gott bloß ausgedacht. In diesem Fall wäre das kantische „Gottespostulat“ grandios missverstanden. Aber zumindest wird er vom und im Denken hervorgedacht.
Diese Problematik stellt sich in jüngster Zeit neu und verschärft durch die Experimente der so genannten „Neuro-Theologie“17. Mit ihnen ist es gelungen, durch bildgebende Verfahren die Veränderung einzelner Felder in spezifischen Hirnarealen während religiöser Praktiken sichtbar zu machen. Dabei handelt es sich um Areale, in denen Prozesse ablaufen, die über die räumliche Orientierung, Bewegung und Selbstwahrnehmung der Probanden entscheiden. Durch entsprechende Stimulierungen dieser Areale ist es möglich, dass für die Probanden die Grenze zwischen Ich und Welt verschwindet und die Orientierung in Raum/Zeit-Bezügen aufgehoben wird. Was die Mystiker unterschiedlichster religiöser Traditionen berichten – das „ozeanische Gefühl“ der Versenkung, die Erweiterung von Bewusstseinsgrenzen, die Vereinigung mit einer allumfassenden Wirklichkeit –, lässt sich offenkundig rekonstruieren als Resultat einer via Meditation erfolgenden Stimulation entsprechender Hirnlappen. Der Beweis scheint erbracht, dass es sich bei mystischen Erlebnissen nicht um „Einbildungen“, sondern um empirisch nachweisbare Tatsachen handelt. Allerdings kippt dieser „Beweis“ sogleich in eine religionskritische Anfrage um. Denn er wirft die Frage auf, ob sich in mystischen Erfahrungen ausschließlich hirnimmanente Ereignisse manifestieren, die Ausdruck einer Selbstbeschäftigung des Gehirns sind, oder ob diese Erfahrungen eine „Außenreferenz“ haben (z. B. in der Weise, dass dieses „Außen“ das neuronale Geschehen affiziert oder mental verursacht), wie religionsapologetische Deutungen nahelegen wollen. In ihrer religionskritischen Variante zieht die Neurobiologie gleichwohl eine „Naturalisierung“ der Gottesvorstellung nach sich, welche am Ende ihren Gehalt als etwas allein vom Bewusstsein Hervorgebrachtes erscheinen lässt, das wegen einer fehlenden Außenreferenz nicht mehr von einer Illusion oder Projektion unterschieden werden kann. Allerdings behauptet dieser Ansatz zu viel, wenn er die Frage nach der Geltungsfähigkeit und Plausibilität der Inhalte mystischer Erfahrungen bzw. des Glaubens abhängig macht von ihrer Genese („genealogischer Fehlschluss“).
Ein entsprechend problematischer Syllogismus lautet: (1) Alles, was dem Menschen bewusst ist, ist ihm durch neuronale Prozesse bewusst bzw. von ihnen bedingt. (2) Religiöse Überzeugungen („Gott existiert“) sind Inhalte bzw. Gegenstände menschlichen Bewusstseins. (3) Also sind religiöse Überzeugungen dem Menschen durch neuronale Prozesse bewusst bzw. von ihnen bedingt.
Ein Fehlschluss tritt dort auf, wo die Korrelation von neuronalen Prozessen, religiösen Vollzügen und deren Gehalt im Sinne einer konditionalen Kausalität und/oder Identität gedeutet wird. In bestimmten Fällen entsprechen die neuronalen Muster religiöser Praktiken (Meditation, Gebet, Liturgie) zwar durchaus den Mustern pathologischer Prozesse (z. B. Epilepsie). Aus solchen Korrelationen ist aber weder eine Identität pathologischer und religiöser Bewusstseinsvorgänge oder -zustände ableitbar („Religiöse Ekstase ist nichts anderes als eine Spezialform von Schädellappenepilepsie“), noch ist eine konditionale („wenn/dann“) Verknüpfung zwingend nach dem Muster „Wenn x anfällig ist für Epilepsien, dann ist x auch disponiert für Mystik“.
Selbst wenn bei einem religiösen Menschen über bildgebende Verfahren ein (hirn)pathologischer Befund diagnostiziert wird und es erwiesen ist, dass diese Pathologie religiöse Vorstellungen generiert, so ist damit im strikt logischen Sinne aber noch nicht erwiesen, dass das Generierte selbst etwas Pathologisches (d. h. Inakzeptables, Irrationales, Vernunftwidriges, Unverantwortbares) darstellt. Die neuro-biologische Rekonstruktion von neuronalen Erregungszuständen, welche religiöse Bilder und Empfindungen generieren, ersetzt nicht den philosophischen Nachweis, dass und warum es sich um Lug- und Trugbilder handelt, d. h. was das Verlogene und Trügerische an ihnen ist.
Die Reflexion auf die evolutionäre Bedingtheit oder neuronale Basis eines religiösen Phänomens besagt nichts über die Geltungsgrundlage seines Fortbestehens und auch nichts darüber, ob mit seinem Gehalt ein vertretbarer Geltungsanspruch einhergeht. Für die Klärung dieser Frage fehlt den Neurowissenschaften jede Kompetenz. Um dies über eine Analogie zu verdeutlichen: An einer Schultafel findet sich die mit Kreide aufgetragene Rechenoperation 2 × 2 = 5. Als empirische Gegebenheit lässt sie sich beschreiben als eine „spezifische Verteilung von Kreidepartikeln“. Man mag als Erklärung für diese Verteilung und ihre Bedeutung nun Erklärungen aus dem Bereich Physik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Ästhetik oder Graphologie suchen und finden. Für die Ungültigkeit dieser Rechenoperation ist aber ein mathematischer Beweis zu führen. Die psychologische Rekonstruktion, warum sich jemand verrechnet, ersetzt ebenso wenig den mathematisch-logischen Nachweis, dass und warum das Ergebnis falsch ist, wie die physikalische Erklärung, warum Kreide an der Tafel anhaftet, von einem graphologischen Gutachten erwartet werden kann.
Insofern muss auch zumindest offenbleiben, ob und inwiefern in der Selbstreferenz eines Subjekts eine „Außenreferenz“ konstitutiv eingeschlossen sein kann, die verschieden ist von der Außenreferenz sinnlicher Wahrnehmungen. Ob die Alternative „Selbstreferenz oder Außenreferenz“ selbst alternativenlos bleibt, hängt an der Entscheidbarkeit der Frage, ob subjektimmanente Ereignisse derart mit einer „transsubjektiven“ Struktur versehen sind, dass sie konstitutiv auf ein „Außerhalb“ verweisen. Die spezifische Logik von „Unbedingtheitserfahrungen“ im religiösen Kontext könnte in diese Richtung weisen: Wenn für religiöse Erfahrungen eine Wahrnehmung dessen charakteristisch ist, „was uns unbedingt angeht“ (P. Tillich), wird dabei nicht „etwas Unbedingtes“ erfahren (nach Art eines sachhaften oder personalen Gegenübers), sondern die spezifische Form bzw. das besondere Format eines Angegangenseins, d. h., es wird Unbedingtheit erfahren. Die Erfahrung solcher Unbedingtheit wäre somit ihrer Ereignishaftigkeit nach subjektimmanent, ihrem Modus und ihrer Struktur nach transzendierte sie die Bedingtheit des Subjekts und hätte in diesem Sinne eine Außenreferenz. Allerdings wäre erneut und eigens zu klären, worin der („onto-logische“?) Wirklichkeitsstatus dieses „Außenbezuges“ besteht.
Dabei wäre zu überlegen, ob etwa der „ontologische Gottesbeweis“ ANSELMS VON CANTERBURY (1033–1109) hierfür eine Vorlage liefern könnte. Anselm ist überzeugt, dass es (mindestens) einen Denkakt gibt, dessen Inhalt als unabhängig vom Denkvollzug gedacht werden muss; mehr noch: Der Vollzug dieses Denkens wird vom Inhalt dieses Aktes erst in Gang gesetzt. Dieser Inhalt besagt zudem, dass er nicht bloß als Gegenstand des Denkens gedacht werden kann. Denn dieser Inhalt lautet: „das worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann“ (id quo maius cogitari non potest), d. h., er nötigt das ihn denkende Subjekt, jede Bewusstseinsimmanenz zu transzendieren und etwas Unüberbietbares zu denken. Das Denken bzw. der Denkakt ist zwar ein bewusstseinsimmanentes Geschehen, der Inhalt dieses Denkaktes aber bezieht sich auf etwas, das nicht bewusstseinsimmanent sein kann. Der Gedanke von etwas Unüberbietbarem muss mehr als bloß ein Gedanke (bzw. etwas Gedachtes) sein, weil Gedanken überbietbar sind. Etwas Unüberbietbares hat man erst dann gedacht, wenn man seine Existenz annimmt und wenn man sein Nicht-Sein nicht denken kann. Die Außenreferenz dieses Denkens transzendiert darum auch jeden Bereich, innerhalb dessen etwas kontingent Wirkliches – und mag es noch so großartig sein – als Außenreferenz (z. B. sinnlicher Wahrnehmungen) vorkommen kann. Denn auch zu ihm ist sie als ein „quo maius“ zu denken. Das Kontingente mag real sein, aber es ist nicht notwendigerweise real (dies macht ja gerade seine Kontingenz aus). Daher ist das Unüberbietbare „jenseits“ alles Kontingenten zu denken und wenn es denk- und seinsmöglich ist, dann muss es eo ipso „immer schon“ sein.18
Dass diese Überlegungen heute nur noch im Konjunktiv formuliert werden können, verweist auf einen für die Theologie einst unstrittigen Sachverhalt, der in den Gottesbeweisen affirmativ artikuliert wurde und gegenwärtig nur noch in Frageform begegnet: Gibt es einen kritischen Maßstab, mit dem die Theologie den Gottesglauben hinsichtlich seiner „Gegenstandsfähigkeit“ verifizieren kann, so dass er sich nicht in bloß individuellen Gewissheiten und reiner Bewusstseinsimmanenz erschöpft? Lässt sich tatsächlich der Nachweis führen, dass Mensch und Welt in ihrer Kontingenz („Geschöpflichkeit“) auf eine sie bedingende und ermöglichende Größe verweisen, auf die sie „real“ bezogen und von der sie zugleich „real“ unterschieden sind? Bilanziert man die neuzeitliche Erkenntnis- und Metaphysikkritik,19 dann sind der Theologie nahezu alle Kriterien und Möglichkeiten abhandengekommen, diese Fragen anzugehen. Jeder der einst für unausweichlich und unbestreitbar gehaltenen Erfahrungs- und Denkansätze muss hinsichtlich seiner anscheinend ebenso unbestreitbaren Deutungen (inklusive ihrer Prämissen und Schlussfolgerungen) mit Vorbehalten versehen werden.
• Woher wissen wir, dass unser Denken nicht nur für den Bereich der innerweltlichen Erscheinungen erkenntnisfähig ist, sondern auch für deren Möglichkeitsbedingungen, die in der „Transzendenz“ angesiedelt sind?
• Woher wissen wir, dass das Dasein der Welt nicht doch einer Kette von Zufällen entspringt? Gibt es nicht genügend Anzeichen für die Absurdität unseres Daseins, für das Fehlen einer in die Natur eingelassenen „Grundordnung“ der Werte und Normen?
• Woher wissen wir, dass unsere Sprache die Wirklichkeit so erfasst, wie sie „wirklich“ ist? Ist nicht alles Denken ein Konstruieren? Trifft nicht auch der Gedanke des Notwendigen und Unabdingbaren nur etwas Gedachtes? Ist das Wort „Gott“ nicht bloß eine „Kopfgeburt“?
Wenn alle diese Denkvoraussetzungen des Wortes „Gott“ in die Krise geraten sind, muss dies Folgen haben für den Denkinhalt des Wortes „Gott“.20 Die christliche Rede von Gott hat aus ebendiesem Grund heute erhebliche Probleme, sich verständlich zu machen. Es sind bereits die Verstehensvoraussetzungen dieser Rede und nicht erst ihr Inhalt, welche die Gottesrede prekär erscheinen lassen.21 Die christliche Botschaft ist gerade deswegen für viele Zeitgenossen zu einer unassimilierbaren Fremdsprache geworden. Weggefallen, zerbrochen sind jene Plausibilitätsstrukturen und sozio-kulturellen Selbstverständlichkeiten, deren das Evangelium offensichtlich bedarf, um Gott zur Sprache bringen zu können. Die christliche Rede von Gott ist zu einem Text ohne Kontext geworden.
Je schneller sich die Moderne modernisiert, umso mehr wird Gott für sie ein Fremder. Aus den wissenschaftlichen Plausibilitäten wurde er vertrieben und für Moralbegründungen entbehrlich; ausgeschieden ist er aus dem Kalkül der Ökonomie und sperrig geworden beim Ausfüllen metaphysischer Reflexionslücken.22 Das philosophische Reden von Gott hat sich schon lange verfangen in den Schleppnetzen der Religionskritik. Und auch die Logik der Theologie schafft es immer weniger, den Gottesgedanken zusammenzudenken mit den Katastrophen der Geschichte. Das Bild eines allmächtigen und guten Gottes will nicht passen zu einer Welt, die seine Schöpfung sein soll und dennoch von einer Blutspur unschuldigen Leidens gezeichnet ist.23 Am Ende der Moderne steht der Gottesglaube ohne feste Plausibilitäten da. Es gibt offenkundig keinen allgemeinen Erfahrungs- oder Denkhorizont mehr, innerhalb dessen der moderne Mensch genötigt wäre, von Gott zu reden. Man kann über die Entstehung der Welt, über die Bedingungen der Erkenntnis und über die Gründe der Moral reflektieren, ohne dass sich dabei der Gedanke an Gott nahelegt.24 Selbst in religiösen Fragen ist er heute entbehrlich. Wer Interesse an Spiritualität anmeldet, muss dies nicht mit einem Interesse am Theismus verknüpfen. Man kann auch ohne Gott religiös sein.
Die kulturellen Plausibilitäten der Moderne stehen ohnehin im Zeichen der Verpflichtung, sich in Fragen der Wirklichkeitserkenntnis und der Lebensgestaltung nur den Imperativen der (autonomen) Vernunft zu unterstellen. Wenn die Welt sich von selbst versteht, bedarf es keiner anderen Größe mehr, die ein Weltverständnis ermöglichen könnte. Die Moderne weist den Menschen in die Welt zurück, nicht über sie hinaus. Sie ist abweisend gegenüber allem, was unsere Welt auf eine die Welt transzendierende Weise angeht. Schon gar nicht zwingt etwas in der Welt dazu, über oder von Gott zu reden.
Was aber bleibt von den traditionellen Gottesbeschreibungen übrig, wenn das Wort „Gott“ nicht mehr für den transzendenten Grund des Seins oder für den Maßstab für die Bestimmung moralischer Maßstäbe steht? Gehören sie ins Archiv, ins Antiquariat der religiösen Sprache? Was soll man tun, wenn diese Hauptwörter der Theologie nichts mehr benennen und darum nichts mehr bedeuten? Nach einem ebenso als Kritik (an überkommenen theologischen Redeformen) wie als Aufruf (zu einer Erweiterung der theologischen Grammatik) interpretierbaren Wunsch Kurt Martis bleibt die Möglichkeit übrig, „daß Gott ein Tätigkeitswort werde“. In den überflüssig gewordenen Substantiven sollen Verben entdeckt werden, die Gott als Ereignis einer bestimmten Praxis buchstabieren. Wer „verbalisieren“ will, um was es im Glauben geht, darf keinen Nominalstil pflegen. Damit ist mehr gemeint, als dass sich die Bedeutung des Wortes „Gott“ aus seinem praktischen Gebrauch ergibt. Im Zentrum steht die Überzeugung, dass dieses Wort etwas zu tun und nicht bloß zu denken gibt: Man kann nicht an Gott glauben und untätig bleiben. Die Praxis des Evangeliums ist der Weg, sich die Wahrheit des Gottesgedankens „einzuhandeln“. In einer Zeit, da der Gottesgedanke für etwas steht, das undenkbar geworden ist, scheint ein möglicher Ausweg darin zu bestehen, seine Plausibilität über eine spezifische Praxis zu erweisen. Danach hat sich auch die Sprachform des Glaubens und der Theologie zu richten. Auch hier regiert der Primat der Praxis. Praxisrelevante Aussagen sind in der Regel normative oder präskriptive Aussagen, d. h. Sätze über das, was zu tun ist. Hier heißt es „Gesagt – getan“. Wer davon überzeugt ist, muss die Gottesrede in der Tat „entsubstantivieren“ und Verben verwenden.