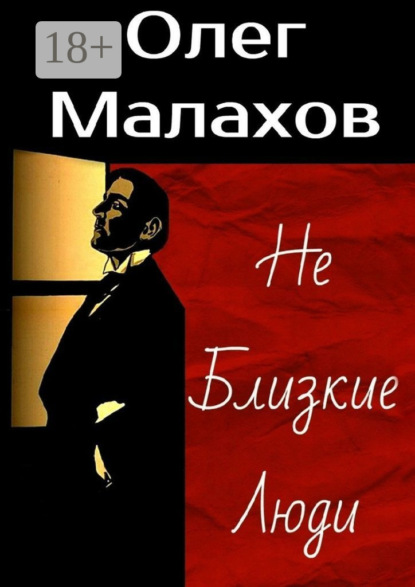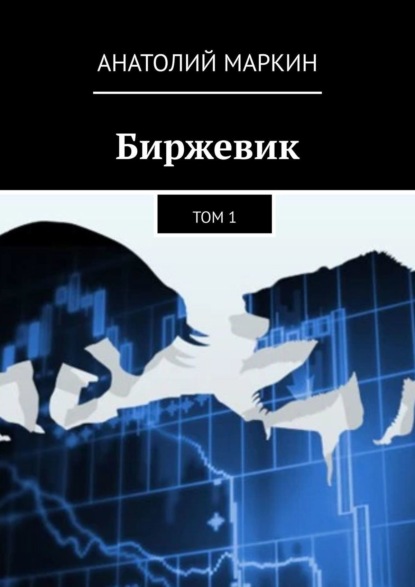- -
- 100%
- +
Aber auch dieser Ansatz wirft Fragen auf, die sich auf dem Wege der Praxis allein nicht beantworten lassen. Wie lässt sich denken, dass im Tun des Menschen Gott selbst am Werk ist? Ist nicht bei allem, das in der Welt getan wird, erwiesen, dass es das Werk des Menschen ist? Ist es am Ende nur ein intentionales „als ob“ auf Seiten des Menschen, das Gott noch ins Spiel bringt – gemäß der ignatianischen Maxime „Gib Dir in Deinem Tun solche Mühe, als ob der Erfolg Deines Tuns allein von Dir und nicht von Gott abhinge. Vertraue jedoch dabei so auf Gott, als ob Du selbst nichts, Gott allein alles vollbringen werde“?25 Wie göttliches Handeln denkbar ist, lässt sich nicht ablösen vom Problem der Denkbarkeit Gottes. Es handelt sich dabei um ein Problem, das von der christlichen Dogmatik mit ihrem Insistieren auf der Transzendenz Gottes noch verschärft wird. Wegen seiner schlechthinnigen „Jenseitigkeit“ und „Welttranszendenz“ kann Gott von der Sprache nicht ergriffen werden. Mit ihren Begriffen kann ihn der Mensch denkerisch nicht „im Griff haben“. Doch wenn Gott nur als unbegreifbar denkbar ist, muss dann das Denken im Blick auf Gott am Ende nicht resignieren? Ist das Ende des Gottesgedankens als eines dann im Grunde etwas Undenkbares denkenden Gedankens nicht notwendig die Resignation? Und ist die Geschichte des Gottesgedankens zurzeit nicht an ebendiesem resignierenden Ende angekommen?
Solche Resignation würde aber nicht nur das Denken betreffen. Es hat praktische Folgen. Wie nämlich soll man den christlichen Glauben tun können, wenn man Gott nicht mehr zu denken vermag und ebendeshalb sich selbst als an Gott Glaubenden nicht mehr verständlich machen kann? Ein derart unverständiger Glaube lässt sich nicht mehr von Unvernunft und Aberglaube unterscheiden. Wer etwas Undenkbares als zu glauben ausgibt, bringt sich und andere letztlich um den Verstand. Es bedarf eines neuen Anlaufs, um zu zeigen, dass die Feststellung der Undenkbarkeit Gottes nicht das Ende eines jeden theologischen Denkens markiert, sondern nur die Grenze einer bestimmten theologischen „Denkungsart“ anzeigt. Erst wenn wieder denkbar wird, wo und wie in der Praxis des Menschen sich ein Handeln oder eine Präsenz Gottes ereignet, kann K. Martis Wunsch in Erfüllung gehen. Erst dann wird das, wofür das Wort „Gott“ steht, wieder antreffbar in der Lebenswelt des Menschen. Gleichwohl findet seit etlichen Jahren eine derart praxisorientierte Gottesrede immer weniger Resonanz. Zu nahe scheint dieser Sprachstil an einer moralisierenden Glaubensrede zu sein. Zu rasch scheint sich hier die Theologie in eine Dublette der Ethik zu verwandeln. An solchen Doppelungen besteht aber nur wenig Bedarf. Viele säkulare Zeitgenossen scheinen an Moral genug zu haben. Wird ihnen zusätzlich eine christliche Moral angesonnen, tauschen sie das, wovon sie genug oder zu viel haben – Moral – gegen das ein, was ihnen fehlt: mystische Innerlichkeit, vielleicht auch fernöstliche Weisheit oder esoterische Lebenskunst …
Hinzu kommt, dass sich auch für viele sozial und politisch engagierte Christen eine Hoffnung nicht erfüllt hat, die sie in dieses Engagement gesetzt haben: dass es zum Ort und Ereignis einer Erfahrung der Nähe und des (Mit)Wirkens Gottes werde. Sie haben sich wund gerieben an Idealen, die es eigentlich verdient haben, Realität zu werden. Das „Reich Gottes“ sollte für sie keine bloß jenseitige Größe sein. Sie wollten den Himmel erden und zeigen, dass das „ewige Leben“ auch schon vor dem Tod beginnt. Aber diese Ziele scheinen eine Utopie zu bleiben. Es ist vielen Christen in ihrem Einsatz nicht erspart geblieben, der Erfahrung der Vergeblichkeit und der Übermacht des schicksalhaften und machbaren Todes ausgesetzt zu werden. Etliche Christen können ihren Glauben nur noch leben als eine Widerstandshaltung gegen die Umstände eines „etsi deus non daretur“. Ähnlich mag es den Verfechtern einer tiefenpsychologischen Glaubensauslegung ergehen. Ihre Transzendenz nach innen wird sie ins innere Ausland führen; im besten Fall wird der Abstand zwischen ihrem Ich und ihrem wahren oder besseren Selbst verringert. Aber werden sie am Ende dort etwas antreffen, das die Bezeichnung „Gott“ verdient?
Der Gottesgedanke scheint in Theorie und Praxis die Qualität verloren zu haben, etwas Alternativenloses zu bezeichnen. Weder für das Denken noch für das Tun des Menschen scheint er etwas zu bezeichnen, das als „conditio sine qua non“ seines Denkens und Handelns angesprochen werden muss. Folgt man dem Anspruch der Aufklärung, dann darf es hierzu auch keine Alternative geben. Sie hat die Losung ausgegeben: Oberste Instanz verantwortlicher Lebensführung, zuverlässiger Weltorientierung und unhintergehbarer Erkenntnisbegründung muss die Vernunft in ihrer Autonomie sein. Ihre Autonomie verlangt die Lösung von den Autoritäten der Tradition und den Widerspruch gegen ihre Auffassung, dass die Vernunft nochmals eine Autorität über sich habe, von der sie Wahrheiten, die ihr selbst unerreichbar sind, auf dem Wege der „Offenbarung“ entgegenzunehmen habe.26 In Fragen der Erkenntnis und Gestaltung der Welt gilt es, sich nur den Imperativen der Vernunft zu unterstellen. Was mit den Mitteln der Vernunft zureichend bewältigt werden kann, darf nicht an eine andere Instanz delegiert werden. Was an eine andere Instanz abgegeben wurde, muss der Vernunft und ihrem Subjekt zurückgegeben werden. Nicht zuletzt dafür plädierten die „klassischen“ neuzeitlichen Religionskritiken, die bis in die Gegenwart mit ihren Leitthesen in Stellung gebracht werden:27
• Alles, was der Mensch übernatürlichen Mächten und Gewalten zugeschrieben hat, muss ihm zurückerstattet werden, weil es ursprünglich ihm zukommt und Teil seines ur-eigenen Vermögens ist (L. Feuerbach).
• Alles, was der Mensch an Trost angesichts trostloser Lebensumstände bei der Religion gesucht hat, muss als billige Vertröstung entlarvt werden, weil es die Veränderung der Verhältnisse blockiert (K. Marx).
• Alles, was der Mensch „über“ sich wähnt, verhindert die Reifung dessen, was er „in“ sich hat, und lässt ihn „infantil“ bleiben (S. Freud).
Der Gottesgedanke wird als Projektion der dem Menschen eigenen Entwurfs- und Verwirklichungsmacht auf ein fiktives Außerhalb kritisiert. Hat der Mensch seine Potenz ganz erfasst, wird diese Projektion überflüssig und zum Störfaktor, der die Selbstverwirklichung der Vernunft hemmt. Glauben erscheint als eine rational nicht gedeckte Haltung, die vom Menschen aufgegeben werden muss, will er zu sich selbst kommen. Aussagen über „Transzendenz“ erscheinen als überflüssige Zusatzbehauptung zur tatsächlich erfahrbaren Wirklichkeit. Religiöse Rede von Gott unterliegt folglich dem Sinnlosigkeitsverdacht.
Das Autonomieideal der Moderne verlangt vom Menschen, in allen Fragen der Wirklichkeitserkenntnis und der Lebensgestaltung nur den Imperativen der Vernunft zu folgen. Mit dieser Aufforderung geht kein neues Zwangsregime einher. Vielmehr sichert sie erst Freiheit und Selbstbestimmung. Politische Selbstbestimmung ist angewiesen auf die Freiheit und die Pflicht, nach Gesetzen zu leben, die Gesetze der Vernunft sind. Vernünftig ist der Mensch, der es unternimmt, seine Unfreiheit und Unmündigkeit selbst zu überwinden und ein freies und gerechtes Miteinander der Menschen kraft eigener Einsicht und in eigener Verantwortung zu gestalten. Die Autonomie der Naturerkenntnis und der soziokulturellen Sachbereiche (Wissenschaft, Wirtschaft, Politik) macht die Hypothese „Gott“ zur Erkenntnis und Gestaltung von Natur und Gesellschaft überflüssig. Die Welt versteht sich von selbst und „funktioniert“ ohne sein Eingreifen oder Zutun. Es geht auch ohne ihn.28 Es ist geradezu ein Unterscheidungsmerkmal moderner und vor-moderner Welterklärungskonzepte, ob darin noch die Größe „Gott“ auftaucht.
Aus der Möglichkeit der Weltinterpretation und Weltgestaltung ohne Gott macht die Moderne die Notwendigkeit der Weltbewältigung ohne Gott – um der Autonomie der theoretischen wie der praktischen Vernunft willen. Was ich ohne einen anderen kann, das soll ich gefälligst auch alleine tun – so lehrt die Neuzeit. Und so macht sie aus der Möglichkeit des Menschseins ohne Gott die Notwendigkeit einer Menschlichkeit ohne Gott. Daher steht die Moderne nicht allein im Zeichen der Autonomie der Vernunft, sondern auch im Zeichen der Negation Gottes.29 Der faktische Lauf der Welt gibt ihr Recht. Er bestätigt kontinuierlich die Annahme von Gottes Nicht-Notwendigkeit zur Erklärung innerweltlicher Abläufe und Sachverhalte. Man kann mit ihm in der Welt nichts mehr anfangen, weil man alles auch ohne ihn in Gang setzen kann. Was der Mensch in ihr Neues aufführt, gelingt ohne göttlichen Beistand. Die Welt ist erklärbar ohne Gott und der Mensch kann menschlich sein ohne Gott. Gott lässt sich negieren, weil man nicht sieht, was einen Gott, der als moralische, naturwissenschaftliche, politische Arbeitshypothese abdanken musste, von einem Gott unterscheidet, den es gar nicht gibt.30 Was, wie und wer Gott sei, wird für eine Gott los gewordene Zeit offenkundig zu einer müßigen Frage. Ein Gott, der nirgendwo antreffbar ist, ist kein göttlicher Gott mehr, von dem es einmal hieß, er sei allgegenwärtig. Wenn man mit Gott im Horizont dieser Welt nichts mehr anfangen kann, ist er ins Beliebige abgedrängt und überflüssig geworden. Ein überflüssiger Gott ist kein wirklicher Gott.
Ein Gott, der offenbar kein „richtiger“ Gott (mehr) ist, ist nichts Richtiges – und darum kann das Reden von ihm auch nicht richtig sein. Es lässt sich unschwer zeigen, dass religiöse Aussagen über „Gott und die Welt“ sinnlos werden, sollten sie den Status empirischen Wissens von Tatsachen besitzen (z. B. „Gott befindet sich in einem Paralleluniversum“) oder als expressive Ausdrucksformen subjektiver Emotionen aufgefasst werden können (z. B. „Ich habe das Gefühl, dass Gott die Welt erschaffen hat“) bzw. als Hypothesen auftreten, die bestimmte Wirklichkeitsannahmen fingieren (z. B. „Christen tun so, als ob Jesus von Nazareth Gott als Vater habe“).31 Wenn nun ebenso gezeigt werden kann, dass keine andere Sprachform zur Verfügung steht, um das zu artikulieren, was Christen „eigentlich“ meinen, dann deutet dies weniger auf ein Versagen der Sprache und der Möglichkeit vernünftiger Rede hin. Vielmehr scheint darin deutlich zu werden, dass Christen – entgegen ihrer Behauptung – eigentlich nichts Vernünftiges zu sagen haben.
Gegen diese Schlussfolgerung wird in Religionskreisen zunehmend auf ein vielfaches „Vernunftversagen“ in der Moderne verwiesen und bestritten, dass alles, was zu sagen ist, in der Sprache der neuzeitlichen Vernunft formuliert werden muss. Deren Sprache und Sache gelten als kompromittiert und konterkariert durch das Widervernünftige, an dem die Religion teilhaben würde, sollte sie sich die Sache und Sprache der Vernunft zu eigen machen. In der Tat haben sich die von der Moderne ausgelösten Rationalisierungsprozesse längst als höchst ambivalent herausgestellt. Die Dialektik der Aufklärung hat die Gleichsetzung von Autonomie und Fortschritt als voreilig erwiesen. Es sind die Siege der aufgeklärten Moderne, die ihre Krisen hervorrufen.32 Ihre ökologischen Krisen und ökonomischen Pathologien lassen danach fragen, ob sie bei ihren Fortschrittsprojekten nicht ihr Autonomie- und Säkularitätsideal überdehnt hat. Der Kern dieses Ideals besteht in der Vorgabe, nur mit jenen Ressourcen auszukommen, welche die säkulare Vernunft mit ihren eigenen Mitteln erschließen und sichern kann. Hat sich die Moderne mit diesem Ideal nicht übernommen? Wird nicht jetzt sichtbar, dass sie auf Kräfte angewiesen ist, die „jenseits“ des Säkularen zu entdecken sind? Drängt sich nicht neu die Notwendigkeit auf, sich für das „Andere“ der Vernunft zu interessieren?
Das Projekt einer Weltbeherrschung als uneingeschränkter Ausführung menschlicher Autonomie bleibt zweifellos so lange unerfüllbar, wie jene Bedingungen menschlichen Daseins ausgeblendet bleiben, welche diesseits und jenseits der Vernunft zu orten sind. Hier gilt der Grundsatz: Es geht zwar niemals ohne Vernunft, aber auch nicht mit der Vernunft allein („sola ratione numquam sola“). Nicht nur Grenzen des Wachstums, sondern auch Grenzen der Vernunft sind unbestreitbar. Sie werden dort sichtbar, wo sich die Autonomie- und Fortschrittsversprechen der Moderne als unerfüllbar erweisen. In einer Zeit gewachsener Sensibilität für ihre ökologischen und ökonomischen „Entgleisungen“ braucht es nicht zu verwundern, wenn es eine neue Offenheit für jenes Krisen- und Lebenswissen gibt, das die Religion repräsentiert. In ihm spricht sich aus, was der Mensch nicht hinter sich lassen darf, wenn er vorankommen will. Abgewirtschaftet haben jene Größen und Kräfte, die nur ein für Mensch und Natur ruinöses, zweckrationales und instrumentelles, auf ein Unterwerfen der Wirklichkeit abgerichtetes „Herrschaftswissen“ verwalten. Hoch im Kurs stehen Traditionen, die ein „Verständigungswissen“ offerieren, das den Menschen wieder in Einklang mit sich und seiner Welt bringen kann.
Die damit einhergehende – vielfach eher behauptete oder beschworene als empirisch belegte – Renaissance der Religion, De-Säkularisierung der Kultur und Re-Spiritualisierung von Lebensdeutungen33 hat jedoch wenig Nachfrage für die Rede von Gott ausgelöst.34 Der „postsäkulare“ Trend zur Religion hat die Gottesfrage weitgehend ausgelassen. Und wo sie dennoch publizistisch aufgegriffen wurde, hat die einschlägige Literatur zwar dafür gesorgt, dass die Rede von Gott wieder im Kommen ist,35 ohne jedoch ein Kommen Gottes ansagen zu können. Bei aller Notwendigkeit, sich für das (religiöse) „Andere“ der Vernunft zu interessieren, besteht offensichtlich kein Anlass, mit dieser Notwendigkeit die Frage nach Gott zu assoziieren.36 Trotz aller Dialektik von Säkularisierungsprozessen bleibt ein Hauptsatz der neuzeitlichen Religionskritik in Geltung: Für das Reden von Gott besteht keine innerweltliche Notwendigkeit.
1.2. Bestreitungen:
Für und wider die Notwendigkeit Gottes
Wenn Gott im Horizont der Welt nicht mehr nötig ist – was ist dann mit ihm? Ein nicht mehr notwendiger Gott ist kein richtiger Gott mehr – ein Gott, der kein richtiger Gott ist, ist auch nicht wirklich Gott. Was weder richtig noch wirklich ist, ist so gut wie nichts. Und ein Gott, der so gut wie nichts ist, ist so gut wie tot. Folgt man dieser Ableitung, dann kommt damit auch die Theologie an ihr Ende. Ist damit aber alles gesagt, was am Ende der Moderne von Gott gesagt werden kann? Wenn sich die Theologie dieser resignativen Schlussfolgerung nicht anschließen und ihre Frage nach Gott nicht aufgeben will, kommt sie gleichwohl an dem Befund der innerweltlichen Nicht-Notwendigkeit Gottes nicht vorbei. Die Frage nach Gott kann nur im Kontext einer Gott los gewordenen Welt redlich gestellt werden. Außerhalb der religionskritischen Plausibilitäten der Moderne kann sie diese Frage nicht überzeugend angehen.
Die „Gottlosigkeit“ der Moderne und ihr Streben nach Autonomie bedingen einander. Erst in der Verarbeitung dieser Interdependenz ist es möglich, das christliche Reden von Gott wieder denkbar und verantwortbar zu machen. Die Verarbeitung des neuzeitlichen Atheismus und die Formulierung eines christlichen Gottesbegriffs sind somit als zwei zusammengehörende Aufgaben zu begreifen – und zwar (auch) aus explizit theologischen Gründen. Denn Gott kann nicht als Gott gedacht werden, ohne dass zugleich die Welt und ihre geschichtliche „Verfassung“ bedacht wird. Die Verfassung der Welt betrifft aber nicht nur den Gedanken, sondern auch die Wirklichkeit Gottes. Gottes eigene Wirklichkeit wird thematisch, wenn die Realität der Welt – seiner Schöpfung – und ihre geschichtliche Signatur begriffen werden. Deren Eigenart besteht aber nun darin, die Welt ohne Gott zu denken. Gott kann daher auch theologisch nicht ohne eine Welt gedacht werden, die ohne Gott gedacht werden will. Aber welche Theologie ist dazu imstande? Auf keinen Fall jene Theologie, welche die Kraft und Herrlichkeit Gottes behauptet, die liebevolle Nähe Gottes beschwört und sich selbst nicht einzugestehen wagt, dass keine Erfahrung eine solche Rede heute noch stützen kann. Selbst die Frommsten unserer Tage räumen ein, wenn man ihnen erlaubt, ehrlich zu sein, was ihre Glaubensnot ausmacht: dass sie ihren Gottesglauben nur noch als Kontrasthandlung zum Erlebnis seiner Folgenlosigkeit leben können, dass sie Gott bei seinem Wort genommen haben, um am Ende zu erleben, dass er es an ihnen nicht erfüllt hat.
„Wir haben gebetet, und Gott hat nicht geantwortet. Wir haben geschrien, und Er ist stumm geblieben. … Wir hätten Ihm beweisen können, dass unsere Ansprüche bescheiden, daß sie erfüllbar sind, wo Er doch der Allmächtige ist; wir konnten Ihm darlegen, dass die Erfüllung dieser Bitten im eigensten Interesse seiner Ehre in der Welt und seines Reiches ist – wie sollte sonst noch einer glauben können, daß Er der Gott der Gerechtigkeit und der Vater der Erbarmung und der Gott allen Trostes ist, daß Er überhaupt ist? (…) Wir haben gebetet. Aber wir wurden nicht erhört. Wir haben gerufen, aber alles blieb so stumm, daß wir uns schließlich lächerlich mit unserem Geschrei vorgekommen wären, wenn es eben nicht von der Not und der Verzweiflung erpreßt gewesen wäre.“37
Die Erfahrung einer Glaubensnacht bezeugen auch die Tagebücher und Briefe von Mutter Teresa von Kalkutta (1910–1997).38 Ihre Zeugnisse des Erlebens einer inneren Leere, eines Gottvermissens, eines Gottesverlustes stehen im scharfen Kontrast zu dem in der Öffentlichkeit verbreiteten Bild einer von Gottes Nähe buchstäblich „erfüllten“ Heiligen. Ihr war es möglich, in der Weise der Sehnsucht nach Gott an ihrem Glauben festzuhalten. Doch nicht allen Christen ist dies vergönnt. Viele religiöse Biographien der letzten Jahrzehnte erzählen von einem allmählichen Abgleiten – zunächst als Distanzierung von religiösen Institutionen, dann aber auch als Abwendung von jeglicher geformter Frömmigkeit.39 Die religiöse Grunderfahrung vieler Zeitgenossen ist, keine Erfahrung des Unbedingten, der Transzendenz mehr zu machen. Sie erleben an sich das Schwinden religiöser Gewissheiten – an ihre Stelle tritt nichts Neues und nichts Anderes, sondern buchstäblich: Nichts.
„Ich befinde mich mitten im Prozeß einer Ablösung, die an mir geschieht, ohne dass ich es will. Ich gleite und gleite immer weiter fort, irgendwohin ins Leere, wo niemand mehr ist, auch kein Echo, wenn ich versuche zu rufen. Kaum sind noch die Gestade sichtbar, von denen ich kam; und die Worte, die Namen, die ich einmal hatte, um das Heilige zu benennen, haben sich im Nebel aufgelöst.“40
Vor diesem Nichts kommt jede Theologie an ihr Ende, die das intellektuelle Anspruchsniveau der Neuzeit unterbietet und die Gottesfremdheit der Moderne mit der Gottesvertrautheit des Mittelalters eintauschen will. Eine solche Theologie kennt Gott nur noch als guten alten Bekannten, als jemanden, mit dem sich frühere Generationen ganz gut verstanden haben, woran entsprechende Zeugnisse heute noch erinnern. Einer Gott los gewordenen Zeit setzt sie trotzig oder besserwisserisch, auf jeden Fall aber vollmundig die Überzeugungen einer besseren alten Zeit entgegen. Eine solche Theologie hat Gott in Wahrheit längst hinter sich. Religiöse Gewissheiten, die ihre Behauptungen stärken könnten, besorgt sie sich im Copyshop der Kirchengeschichte. Für alle, die in der Gegenwart nichts mehr von Gottes Nähe spüren, hat sie nur Vorwürfe übrig: Wäre ihr Glaube stärker, ihre Hoffnung unerschütterlicher und ihre Liebe inbrünstiger gewesen, dann stünde es jetzt besser um sie. Dass die Anfechtung des Gottesverlustes umso heftiger erlebt wird, je stärker Glaube, Hoffnung und Liebe ausgeprägt waren,41 will eine solche Theologie nicht wahrhaben. Ebenso wenig kommt ihr in den Sinn, dass die Erschließung der Wirklichkeit Gottes mit der Enteignung überkommener Gottesschablonen beginnen kann.42 Und dass die Erfahrung des Gottesentzuges selbst eine religiöse Erfahrung sein kann43 ist für sie erst recht unvorstellbar.
Die religionskritischen Plausibilitäten der Moderne eröffnen aber auch – wie im Folgenden zu zeigen ist – durchaus die Möglichkeit einer zeit- und adressatengemäßen Rede von Gott. Diese bedingt allerdings die Aufgabe bisheriger Prämissen christlicher Gottesrede, von denen man annahm, dass sie die Plausibilität dieser Rede verbürgen. Vor allem gilt dies für die Prämisse der Notwendigkeit Gottes zur Erklärung innerweltlicher Abläufe und Sachverhalte (inklusive der religiösen Angelegenheiten des modernen Menschen). Diese Prämisse hat die Moderne als überflüssig erwiesen mit der Konsequenz, dass Gott im Horizont der Welt nicht mehr nötig ist, ins Beliebige abgedrängt und überflüssig geworden ist. Ein überflüssiger Gott ist kein wirklicher Gott mehr – ihm fehlt ja das Prädikat der Notwendigkeit.
Wie schwer der Verlust dieses Prädikates wiegt, bezeugt die prominenteste „Vermisstenanzeige“, die von Seiten der Philosophie formuliert wurde. „Wohin ist Gott?“ lässt Fr. NIETZSCHE seinen „tollen Menschen“ fragen44 und bringt damit zum Ausdruck, dass Gott nicht mehr dort ist, wo er als Gott hingehört – nämlich „ganz oben“, um von dort aus erst die Unterscheidung von „oben“ und „unten“ und eine Hierarchie aller Werte zu ermöglichen: als oberster Gesetzgeber oder als höchstes Gut. Wo die Moderne aber an ein Höchstes und Oberstes, an ein Erstes und Grundlegendes stößt, entdeckt sie nichts mehr, was sie „Gott“ nennen könnte oder müsste. Übrig bleibt nur die vage Aussicht, dass es einen anderen ihm gemäßen Platz geben könnte. Lässt sich eine „andere“ Notwendigkeit denken, von der her sich sein Gottsein bestimmt? Da dies offenkundig nicht der Fall ist, kann nur noch auf höchst unbestimmte Weise nach Gott gefragt werden. Dieses Fragen verliert aber jeden konkreten Anhalt und wird selbst etwas Vages. Denn es ist kein Kontext, kein Ort, keine Funktion mehr erkennbar, womit man das Erfragte in Beziehung setzen könnte. Man kann auch nicht mehr sagen, Gott sei abwesend. Ein Abwesender hält sich ja woanders auf und ist durch dieses „Woanders“ bestimmbar. Was aber bestimmungslos und unbestimmbar geworden ist, hat auch kein „Woanders“ mehr. Gott wird ein „nichts“ und „niemand“. Es ist dann nur konsequent, die Suche nach ihm abzubrechen und den lange Zeit Vermissten für tot erklären zu lassen.45
Wenn Gott alle Bestimmungen verliert, die ihn als Gott identifizierbar machen, ist er nicht mehr unterscheidbar von einem „Gott“, der nicht (Gott) ist. Letztlich wird er sogar vom Nichts ununterscheidbar – es ist gleichfalls völlig unbestimmt und unbestimmbar (ebendies macht ja seine „Nichtigkeit“ aus). Wenn Gott nicht mehr vom Verdacht der Nichtigkeit entlastet werden kann, wird jede affirmative Rede von Gott problematisch. Als unproblematisch galt dieses Sprechen so lange, wie es von Gottes Notwendigkeit für die Bewältigung innerweltlicher Sachverhalte als von einer als evident erachteten Prämisse ausgehen konnte, die Gott bestimmbar machte. Von dieser Notwendigkeit her ließen sich Aussagen darüber treffen, „wie“ Gott sei: Die Kontingenz der Welt erwies ihn als „allmächtig“; als Bürge menschlicher Wahrheitssuche musste er „allwissend“ sein; dass das menschliche Streben nach dem Guten nicht ins Leere lief, verdankte es seiner „Allgüte“. Genau diese Voraussetzung hebt die Moderne auf und erweist sie als nicht-notwendig.
Mehr noch: Für die autonome Vernunft ist dies sogar eine falsche Prämisse. Für das Projekt, die Rede von Gott denkerisch, d. h. mit den Mitteln der autonomen Vernunft, zu verantworten, gilt dies aber auch. Daher steht die Theologie nunmehr vor der Herausforderung, in dieser falschen Voraussetzung vernünftigen Denkens auch eine falsche Prämisse theologischen Denkens zu erkennen. Entfällt die Möglichkeit, von Gott sagen zu können, wofür er notwendig sei, gibt es für eine affirmative Gottesrede keinen unmittelbaren Anlass und Ansatz mehr.
Es wäre jedoch ein Kurzschluss, damit das Ende jeglichen theologischen Denkens gekommen zu sehen. Wenn das Wahrheitsmoment der Rede vom „Tod Gottes“ in der Beseitigung einer falschen Prämisse besteht, dann ergibt sich für jede weitere Rede von Gott die Notwendigkeit, unter Absehung der Vorstellung von Gottes Notwendigkeit für Aufgaben, die sich in der Welt dem Menschen stellen, von der Wirklichkeit Gottes zu reden. Es entfällt dann auch die Konsequenz, dass jedes Reden von Gott notwendigerweise affirmativ sein muss.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.