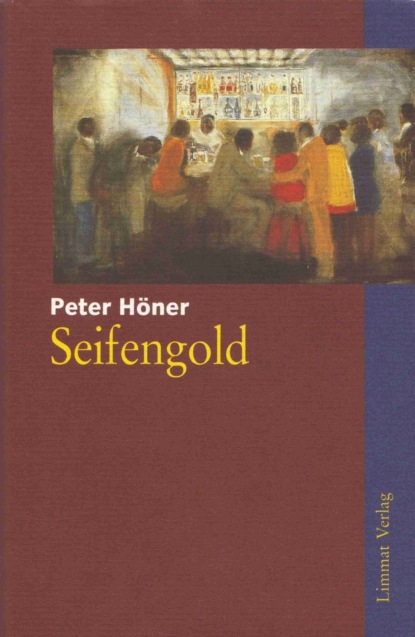- -
- 100%
- +
«Hier! Das ist die Unterschrift des Mannes. Drei Tage und drei Nächte war er unser Gast.»
Tetu schaute sich den Zettel gar nicht erst an.
«Wissen Sie vielleicht, was der Mann in Lodwar wollte? Wie er heißt? Was er gestern gemacht hat?»
«Nein. Alle unsere Gäste bezahlen im voraus, alles weitere …»
«Essen ihre Gäste hier?»
«Manchmal.»
«Hat der Ermordete hier gegessen?»
«Vielleicht.»
«Gehörte der Tote zu einer Hilfsorganisation?»
«Vielleicht.»
«Vielleicht! Manchmal, vielleicht! – Jetzt hören Sie mir einmal gut zu, Sie Schlaumeier: Der Ermordete war von der Geheimpolizei. Er war hinter einer Bande von Betrügern her, die zusammen mit den Goldgräbern krumme Geschäfte machten. Er suchte einen gewissen Salvatore Lomazzi. – In seinen Unterlagen, die ich in seiner Manteltasche fand, entdeckte ich einen Zettel. ‹Eiffeltower! Im Auge behalten.› – Können Sie sich vorstellen, warum?»
Der Wirt ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, er schmunzelte und goß Tetu einen Tee nach.
«Die Frauen kommen jeden Augenblick.»
Nach ungefähr einer Stunde kamen drei Frauen. Eine hatte einen kleinen dunkelbraunen Koffer bei sich. Sie legte den Koffer vor Tetu auf den Tisch. Der Wirt übersetzte. Das sei der Koffer eines Mannes, der gestern Abend noch einmal weggegangen und nicht mehr wiedergekommen sei. Seine Frau habe den Koffer heute morgen zur Polizeistation gebracht.
Tetu nahm den Koffer und stand auf. Er hätte die Frau gerne noch gefragt, warum sie den Koffer zur Polizei gebracht und ob sie gewußt habe, daß ihr Gast tot sei, und wenn ja, woher? Aber weil er weder vom Wirt noch von seinen Frauen eine vernünftige Antwort erwartete, fragte er nichts mehr. Er bedankte sich für den Tee und ging.
Der Koffer enthielt ein zweites Paar Hosen, drei Hemden, von denen zwei bereits schmutzig waren, Wäsche, einen Schlafanzug und einen Toilettenbeutel mit Seife, Rasierpinsel und Zahnbürste. Irgend etwas Schriftliches fand Tetu nicht.
Auch seine weiteren Versuche, in Lodwar etwas über den Toten zu erfahren, scheiterten. Auf dem Markt, in den Kneipen, nirgendwo fand er einen Menschen, der ihm etwas erzählen konnte oder wollte. Die meisten taten, als würden sie seine Fragen nicht verstehen. Andere, wie zum Beispiel die Lastwagenfahrer, die in der Oase ihre Löhne versoffen und verhurten, wurden wütend und beschimpften ihn.
Selbst von Fatuma erfuhr Tetu nichts mehr. Sie wollte nichts wissen, nichts sagen. Und Nairobi ließ ihn ebenfalls im Stich.
Am Morgen des vierten Tages entschloß er sich, zusammen mit seinem Adjutanten die Goldgräbersiedlung in den Bergen zu besuchen. Sein Fahrer war entsetzt.
Der Besuch einer Goldgräbersiedlung sei für einen Uniformierten lebensgefährlich. Die Dörfer gälten als Schlupflöcher für Wilderer, Deserteure, enttäuschte Lehrer, Arbeitslose und gescheiterte Politiker.
«Räuber, Mörder, ganze Banden verstecken sich in den Bergen. Sie kennen kein Recht und keinen Gott. – Ein Polizist mit unbequemen Fragen ist dort oben etwa so sicher wie eine Maus unter Füchsen.»
Doch Tetu bestand auf der Fahrt. Sie verpflichteten einen Einheimischen als Führer – einen jungen Turkana, der in Lodwar als Tankwart arbeitete – und beluden ihren Jeep mit einem zusätzlichen Maschinengewehr.
Der Weg in die Berge führte durch die Wüste. Sie rasten über harte Sandpisten quer durch die Ebene. Doch ohne ihren Führer hätten sie sich in den spiegelnden Flächen der Einöde schnell verfahren. Von einer Straße konnte keine Rede sein. Nur ab und zu stießen sie auf Fahrspuren, eine weichere Stelle im Sand oder eine kaum wahrnehmbare Senke, die sich als Furt durch eine ausgetrocknete Wasserader erwies.
Der Turkana hockte neben Tetus Fahrer und zeigte mit seiner Hand die Richtung an. Mit knappen Rechts-Links-Ausschlägen seiner Finger korrigierte er den Polizisten so lange, bis dieser den Wagen in die gewünschte Richtung gelenkt hatte, dann drehte er die Hand in die Waagrechte und deutete mit einem lässigen Schwung der gesamten Hand dem Fahrer an, daß er nun – immer geradeaus! – sein Tempo erhöhen könne. Manchmal streckte der junge Mann seinen Kopf durch das geöffnete Verdeck des Jeeps, stand auf und musterte die Landschaft. Ein junger Krieger unterwegs mit zwei dicken Polizisten in unbequemen Uniformen. Sie waren dem Turkana vollkommen ausgeliefert.
Nach zwei Stunden erreichten sie einen Fluß, der zu ihrer Überraschung ziemlich viel Wasser führte. Hinter dem Fluß schlängelte sich eine Schotterstraße ins Gebirge, und der helle, feste Sandboden verlor sich rasch zwischen einzelnen Lavabrocken, verschwand schließlich unter einer dichten Decke rotbraunschwarzen Schotters. Lavaschutt türmte sich zu Hügeln, durch die sich das rostfarbene Sträßchen in die Höhe schraubte, und im Einerlei der Steinwüste versanken die letzten Grasinseln. Nirgends zwängte sich noch ein Strauchgestrüpp durch die scharfkantigen Gesteinsbrocken der Wüstenei.
Die Straße war steil und schlecht befestigt. Schutt und Geröll rutschten unter den Rädern weg, und größere Blöcke mußten von Hand beiseite geräumt werden. Sie kamen nur sehr langsam voran. Immer wieder mußte der Turkana aussteigen und den Fahrer von Felsbuckel zu Felsbuckel lotsen, über eine ausgeschwemmte Rinne oder durch einen Engpaß. Sie verloren Zeit, schwitzten und fluchten viel.
Bevor sie die Hütten der Goldgräber sahen, rochen sie sie; einen stechend süßlichen Gestank nach Pisse, Scheiße und faulendem Kehricht. Nach einer doppelten Kehrschleife verbreiterte sich das Tal, und unmittelbar vor ihnen standen schief die ersten Hütten des Goldgräberdorfes. Schmutzige Plastikbahnen, alte Bleche, Tierhäute, zerschlissene Matten verwoben sich zu einem Geflecht von Wänden und Dächern, einem wahren Meer allerarmseligster Behausungen. Dicht zusammengedrängt und ineinander geschoben, sich aneinanderlehnend und doch ohne Halt, verstopften sie das Tal.
Sie fuhren vorsichtig tiefer in den Ort hinein. Rechts und links wucherte die Siedlung die Talwände empor. Hütten und Schutt vermischten sich miteinander, so daß sich die rostigen Dächer kaum von der rotbraunen Lava unterscheiden ließen.
Der Wagen rutschte auf der glitschigen Straße von einem Schlagloch ins andere. Es wurde Zeit, daß sie sich nach einem Wendeplatz umschauten. Als dann mehrere Lavabrocken die Straße abriegelten – eine Barriere, die wahrscheinlich von den Goldgräbern gebaut worden war, um das Eindringen in ihre Schürfgebiete zu verhindern – hielt Tetus Fahrer an und schaltete den Motor aus.
Grabesstille lagerte über dem Ort, gespenstisch und unheimlich nistete sie zwischen den Hütten der toten Stadt. Hielt sich denn tagsüber kein Goldgräber zwischen den Baracken auf? Wo waren die Händler, Bierverkäufer, die Frauen, die ihre Dienste anboten? Die Kirche, die sich um die ‹verirrten Schafe› kümmerte?
Tetu befahl seinem Fahrer, den Jeep zu wenden, während er sich ein paar Schritte ins Gewirr der Hütten wagen wollte. Etwas weiter unten kollerte ein Stein den Abhang hinunter. Ein Kind oder eine Frau hüpfte um die Ecke. Das gelbgrün bedruckte Tuch flatterte fröhlich im trostlosen Rost. Hinter einem schmutzigen Plastikfetzen glaubte Tetu, ein Gesicht zu sehen.
Es gab Leute im Dorf, und mit ein bißchen Glück würde er auch die Kneipe finden, in der sich die Männer versammelten. Irgendwo würde einer im Dunkeln sitzen, krank und besoffen, und ihnen erzählen, was für tolle Kerle sie seien, und wie sie irgendwann, demnächst, in die Stadt ziehen würden, die Taschen voller Geld.
Sie fuhren zurück und fanden tatsächlich eine Abzweigung, die sie übersehen hatten. Die Straße führte die Talflanke entlang durch einen älteren und weniger baufälligen Teil der Siedlung, und sie endete vor einer Ladenzeile. Bestimmt an die zehn Dukas reihten sich um einen schmutzigen Platz. Lebensmittel und Gemüsebuden, eine schiefe Kneipe mit Hinterzimmern, ein Eisenwarengeschäft und ein Tuchladen, vor dem sich dünne Matratzen zu einem Berg auftürmten. Sogar ein Matatu stand hier, eines dieser Sammeltaxis, von denen man allerdings nie wußte, ob sie noch fahrtüchtig waren. Aber einen Menschen sahen sie nicht.
Die Holzveranda des ‹Lucky Dog› war leer, auch in der Gaststube saß niemand. Tetu tastete sich durch den schummrigen Raum, der mit Tischen und Bänken verstellt war, zu einer Tür, die vermutlich in den Hof und seine Hinterzimmer führte. Er drückte die Tür auf und überraschte eine ältere, verwachsene Frau, die Wäsche gegen Steine schlug. Die Frau erschrak, ließ ihre Wäsche fallen und versuchte, über den Hof zu entkommen. Tetu erwischte die Alte am Arm und zwang sie, ihn anzuschauen. Er fragte, warum und vor wem sie sich fürchte, und wo die anderen seien? Die Wäscherin verdrehte die Augen und schob ihre schwere Zunge unbeholfen im Maul herum. In einem der Hinterzimmer schrie eine Frauenstimme. Jemand stolperte am Haus vorbei. Irgendwo in der Nachbarschaft knallte eine Türe zu.
Tetu und sein Adjutant hetzten um die Baracke, sie zwängten sich zwischen den Höfen und Hütten hindurch und kletterten auf Felsbrocken. Doch wie sehr sie sich auch anstrengten: Das Hüttenmeer zu ihren Füßen verriet seine Bewohner nicht. Nicht an Tetu und seinen Begleiter, die beiden Männer in Uniform.
Der Jeep und ihr Führer waren inzwischen bestimmt von zehn oder mehr Leuten umringt. Es waren Einheimische, wahrscheinlich Hirten, die ihre Kamele im Abfall der Siedlung weideten. Als die Männer Tetu und seinen Adjutanten kommen sahen, trabten sie davon. Nur einer blieb stehen.
Der Mann, barfuß, aber in Hose und Hemd, stellte sich Tetu als Besitzer der Eisenwarenhandlung vor. Er grinste, als ob er Lob erwarte. Dann behauptete er, Tetu könne jede nur gewünschte Auskunft haben. Und er machte die entsprechende Geste.
Tetu befahl seinem Fahrer, den Motor zu starten und kletterte in den Wagen.
«Ich weiß, was ich weiß. – Hättet ihr ihn nicht umgebracht …»
«Was haben wir? Niemand von uns, niemand», höhnte der Eisenwarenhändler und kreischte: «Arschloch, verdammtes! – Die Polizei! Ihr! Ihr wißt gar nichts wißt ihr!»
«Ach. Und das Messer in seinem Rücken? – Wenn ich erst einmal weiß, wem du das Messer verkauft hast, werde ich den Mörder schnell gefunden haben.»
«Ich verkaufe keine Messer. Wir, wir haben ihn nicht umgebracht. – Der Mann wollte mit uns zusammenarbeiten, er kam aus Nairobi, er wollte uns helfen.»
«Lomazzi! Euch helfen?»
«Lomazzi? Nie gehört», maulte der Mann. «Hinter der Kajarta-Schlucht im Ngoi River wurde Gold gefunden. Nuggets so groß wie Kieselsteine.»
«Und nun wollt ihr das Gold an der staatlichen Einkaufsstelle in Sigowa vorbeischmuggeln? – Was versprach er euch dafür, daß ihr den Staat bescheißt?»
«Von dem, was sie uns in Sigowa bezahlen, können wir nicht leben …»
«Wem gehört denn das Gold? Euch vielleicht?»
«Wer steht in den Bächen? Wer kraxelt die Felswände hoch? Wer …»
«Der Eisenwarenhändler, der den Goldgräbern ein paar rostige Bleche verkauft», spottete Tetu und befahl seinem Fahrer, loszufahren. Der Mann sprang entsetzt zur Seite, und Tetu bog sich wütend aus dem Fenster und schrie:
«Melde dich bei mir in Lodwar. Hol dir eine Lizenz für deinen Laden. Sonst laß ich deine Bude schleifen!»
Es war bereits nach vier Uhr. Tetu trieb seinen Fahrer zur Eile an, und geradezu waghalsig jagten sie die Bergstraße hinunter. Trotzdem erreichten sie den Rand der Wüste erst knapp vor Sonnenuntergang, und weil es unmöglich war, den Weg durch die Wüste im Dunkeln zu finden, mußten sie sich nach einer Übernachtungsmöglichkeit umsehen.
Tetu erinnerte sich an seine Campingnacht mit Mettler vor zwei Jahren und wollte schon ähnliche Vorkehrungen treffen, als ihr Turkana-Führer sie auf die Silhouette eines Gehöfts aufmerksam machte und ihnen vorschlug, die Nacht bei seinen Verwandten zu verbringen. Tetu und sein Adjutant nickten begeistert. Dank ihres Führers konnten sie sogar darauf hoffen, daß man ihnen einen Schlafplatz in einer der Nebenhütten anbieten würde. Ein kleines Trostpflaster für ihren erfolglosen Ausflug.
Seither hockt er wieder in seinem Büro in Lodwar und wartet auf Anweisungen aus Nairobi. Er beschäftigt sich mit dem Aufräumen seines Schreibtisches oder harkt mit einer alten Gabel den Sand seiner Kakteensammlung. Er zwingt sich, alte Aktenstücke zu lesen, oder stapft in seinem Büro herum. Er wirbelt die wenigen Fakten über die Ermordung des Geheimagenten durcheinander, zählt alle Erlebnisse der letzten Tage auf und versucht, aus dem wenigen, das er erfahren hat, irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Aber alle seine Anstrengungen enden immer wieder damit, daß er, das Gesicht in den Händen vergraben, kopfüber auf seine Pultplatte sinkt. Mit verdrehtem Kopf und halb geöffnetem Mund verschnarcht er seine Niederlage. Das Wüstenkaff lähmt alle seine Kräfte, und die Sonne, die auf das Blechdach niederbrennt, frißt den letzten Rest seiner Würde auf.
Um halb fünf, eine gute Stunde vor Feierabend, tickert der Telex. Tetu ist mit einem Schlag hellwach. Andächtig und voller Furcht, das altehrwürdige Gerät könnte plötzlich erneut versagen, stellt er sich neben den rasselnden Apparat. Wenn nur der Lochstreifen nicht aus der Rolle springt oder ein Leistungsabfall ihres internen Stromhaushalts das Rattern der Maschine erlahmen läßt. Doch die Botschaft ist kurz, und schon nach wenigen Sekunden wird Tetu akustisch aufgefordert, den Empfang der Mitteilung zu bestätigen. Anschließend spannt er den Lochstreifen in das Hauptgerät, das das gelochte Band entschlüsselt und in Buchstaben, Worte und Sätze verwandelt, die den Sinn der Meldung enthüllen. Eine Antwort der Zentrale.
«17. Juli / R.N.Tetu unverzüglich nach Nairobi kommen / betrifft Akte 005 89-B / sich im Hotel ‹Impala›, Westlands, unter dem Namen Kariuki Gichira melden. / Sekretariat 3, Buffalo House, SSK.»
Wie eine Schweizer Bank einer Treuhandgesellschaft den Ankauf von 136 kg und 370 g Seifengold gutschreibt.
Schweizerische Kreditgesellschaft
Zürich 12-06-XY
Gutschriftsanzeige:
VOBIS TREUHAND
Dr. Hans Junghans
Postfach
8802 Kilchberg
Konto-Nr. 201/352499 POG
Auftrag: Inkasso 02-06-XY, VTK 136Õ370 g SG
Zahlungsgrund
Laut Pb aus den 136Õ370 g Seifengold
93'451 g Feingewicht(Good Delivery)
Referenzpreis Zürich 12-06-XY, 10 Uhr, 999,9/1000 18'250.43 sFr.
Val. 12-06-XY SFR 1,705,520.90
Unterschrift: Serge Meili
2
Die Brandung klatscht an die Mauer der Terrasse. Seit Tagen fegt der Wind Gewitter und Regengüsse über die Insel, brüllt das Meer, und der Lärm rund um das ‹Rafiki Beach Hotel› verwandelt seine Räume in stille Oasen wohliger Ruhe.
Jürg Mettler liegt ausgestreckt in seinem Himmelbett und schaut in den dunklen Baldachin. Trotz der geschlossenen Fenster bläht sich das Moskitonetz in den Böen des Sturms. Die gedrechselten Stützen erinnern an die Masten eines Bootes, schemenhafte Striche, die nach oben in der Finsternis des Zimmers verschwinden.
Neben Mettler schläft Alice. Ihr Wuschelkopf ruht auf seiner Brust. Ein Bein, quer über seinen Bauch geschoben, drückt ihm auf die Magengrube.
Die Regenzeit in Lamu ist Mettlers liebste Zeit. Ihr Beginn ein Freudenfest. Schon Tage vorher wird über nichts anderes geredet. Man beurteilt den Himmel, die Wolken und die Farbe des Meeres. Einer weiß: In Malindi hat es letzte Nacht geregnet. Dann, innerhalb weniger Stunden, ist es soweit. Ein scharfer Wind fegt Staub und Hitze aus der Stadt, Wolkenbrüche spülen jeden Winkel aus. Der Dreck eines Jahres wird ins Meer geschwemmt. In der Stadt und auf der Insel herrscht der Sturm.
Nach einem ersten Freudentaumel verkriechen sich die Menschen in ihren Häusern und beginnen zu warten. Sie warten sechs Wochen lang, bis die neue Saison beginnt.
Für Mettler und Alice besitzt die Regenzeit einen zusätzlichen Reiz.
Als brummiger Griesgram ist er nach Lamu gekommen. Ein freudloser, schwitzender Privatdetektiv aus der Schweiz, der verlernt hatte, über sich selbst zu lachen. Er glaubte, zu seinem Alter gehöre eine Lebenskrise, und er war unfähig zu irgendeiner Entscheidung. Dann, im allerletzten Augenblick, entschied der Himmel für ihn. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Regenzeit begann. Völlig durchnäßt flüchtete er durch die Gassen Lamus und rettete sich zu Alice, die ihn liebte, wie er war. Sechs lange Wochen schlossen sie sich im ‹Magharibi Guesthouse› ein und vergaßen die Welt. Nach fast zwanzig Jahren hatten sie sich ein zweites Mal gefunden, der lange Regen kam ihnen gerade recht.
Die Jahre in Lamu veränderten ihn. Nicht nur, daß er schlanker wurde, kräftiger, sportlicher. Nein. Wohl zum ersten Mal erfuhr er, was es hieß, Zeit zu haben. Stunden, Tage, Wochen. Endlich hörte er auf, zu zählen und zu planen, erlebte er eine Art Stillstand. Die Heiterkeit des Augenblicks.
Er gab seinen Beruf auf. Er kaufte zusammen mit Alice das ‹Rafiki Beach Hotel› und wurde Wirt. ‹Wer nichts wird, wird Wirt.› Sagt man in der Schweiz!
Er fand Freunde. Robinson Njoroge Tetu zum Beispiel, den Chef der Kriminalpolizei. Sie mochten sich, weil sie über vieles ähnlich dachten. Und waren doch verschieden. Tetus Ehrfurcht vor der eigenen Uniform. ‹Der Polizist: Ein Diener des Staates.› Sie stritten sich sogar deswegen. Aber dann, nachdem Tetu einen weiß Gott verzwickten Fall bravourös gelöst hatte, schickte ihn ihr Bekannter, Hemed S. Lali, nach Lodwar in die Wüste. Mettler konnte seinem Freund nicht helfen. Einfacher wurde Mettlers Leben nicht. Nein. Dafür sorgte und sorgt sein Sohn Ali. Dieser weigerte sich, mit ihnen in Lamu zu leben, im Hotel zu helfen. ‹Nicht solange du und meine Mutter das ‹Rafiki› leiten!› Eine Haltung, die ihn sehr getroffen hatte. Alice sah das nicht so. ‹Wenn der Junge keine Lust hat …› Jetzt lebt er in der Schweiz, hat vor kurzem geheiratet. Er hatte nichts dagegen, bitteschön, der Junge kann heiraten, wen er will.
Sie waren auf der Hochzeit. Alice und er. Die Eltern des Bräutigams. Aber seit dieser Hochzeit träumt Alice von einem Leben in der Schweiz. Sie ist sogar bereit, das Hotel zu verkaufen und in die Schweiz zu ziehen. Weil ihre Familie jetzt in Europa, in Zürich sei.
Mettler seufzt. Er hat Ali erst kennengelernt, als der Bursche längst auf eigenen Füßen stand. An den zurückgekehrten Vater glaubte in Lamu niemand. Ali war der Sohn von Mama Alice. Natürlich war es falsch zu erwarten, daß sich zwischen ihnen noch eine Art Vater-Sohn-Verhältnis entwickeln würde. Trotzdem. Er versuchte zum Beispiel, Ali in der berühmten Hotelfachschule in Nairobi unterzubringen. Der Bursche lief davon. Mehrmals. Alice und er schickten ihren Sohn in die Schweiz, steckten ihn in ein Internat. Der Junge weigerte sich, seine mangelhafte Schulbildung aufzubessern. Er motzte, ein Besuch der Schweizer Hotelfachschule in Luzern interessiere ihn nicht. Immer war alles falsch, was er für Ali plante. Aber wenn er seinen Sohn fragte, was er denn nun werden wolle, er müsse doch etwas lernen, einen Beruf, lachte der Bursche nur. Alle zwei Monate wollte er etwas anderes. Einmal wollte er eine Musikgruppe gründen, dann träumte er von einer Ausbildung als Sprengmeister. Was ihm gerade einfiel. Oder er wollte studieren, ein Geschäft gründen, irgendetwas, wovon er sich einen Haufen Geld versprach. Seine Alten abgaunern, nannte er das wohl.
Schließlich lernte er die Schweizerin Christina Frank kennen. Vor einem Jahr, vielleicht schon früher. Die beiden wollten in Zürich einen Laden eröffnen, in dem sie allerlei Krimskrams verkauften. Tina und Ali, Kunsthandwerk aus Afrika. Und sie heirateten. An einem kalten 2. Mai.
Mettler schiebt das Bein von seinem Bauch, löst sich vorsichtig aus der Umklammerung von Alice und stiehlt sich aus dem Bett. Er schlüpft in seinen Morgenrock, setzt sich in einen Sessel beim Fenster und zieht die Vorhänge zurück.
Der Sturm hat nachgelassen. Ein gleichmäßiger, schwerer Regen rauscht auf die Hotelbauten nieder. Gleich nebenan plätschert ein Wasserstrahl von einem der Dächer auf die Terrasse. Die Brandung des Meeres ist schwächer geworden, wahrscheinlich weil die Flut ihren höchsten Stand bereits überschritten hat, und die Wellen die Hotelmauer nicht mehr erreichen.
Mettler weiß aus Erfahrung, daß sich sein Gedankenkarussell, einmal in Gang gekommen, noch bis in den Morgen weiterdreht. Er weiß auch, daß er die Fragen, die ihn beschäftigen, nicht lösen kann. Nicht ohne Alice. Trotzdem weckt er sie nicht. Seine Angst, irgendwann im Verlauf der nächsten Jahre wieder nach Europa zurückkehren zu müssen, kann oder will Alice nicht verstehen.
«Was hast du gegen die Schweiz? Was ist denn so schlimm an dem wunderschönen Land?» hatte Alice ihn gefragt, als er nach Ausreden suchte, um ihre Teilnahme am Hochzeitsfest zu entschuldigen. Er antwortete trotzig:
«Die Schweiz ist nicht schön, und Hochzeiten sind ein Greuel.»
Die naßkalten Tage – Graupelschauer, dazwischen kurze Aufhellungen einer stechende Aprilsonne – schienen ihm recht zu geben. Später verhüllte eine diesige Wolkendecke die Sonne, und die Bise trieb ihnen das Wasser in die Augen und fuhr unter Jacken und Pullover.
Die Hochzeit, das Fest an sich, war durchaus erträglich. Das übliche Ritual. Immerhin verzichteten die beiden auf einen Ausflug auf dem Hallwilersee oder ein Fest in einer Waldhütte. Christina und Ali hatten in einem Restaurant einen Saal gemietet, irgendwo hinter Winterthur. Das Essen war ausgezeichnet. Trinksprüche und Kanzelworte beschränkten sich auf ein Minimum. Auf eine Tischordnung wurde verzichtet. Viel Aufwand trieben die beiden wirklich nicht.
Aber die Gäste, Christinas und Alis Freunde, Christinas Familie. Christina selbst.
Natürlich geht es ihn nichts an, wen sein Sohn heiratet. Ali heiratete eine Weiße. Eine Schweizerin. Warum nicht. Nur: Warum heiratete er eine Frau, die zehn Jahre älter ist? Eine Frau, die soviel mehr Erfahrung besitzt und dem schmalen Bürschchen in allem überlegen ist. Sie paßte doch nicht zu ihm.
Zu Christina selbst fällt ihm nicht viel ein. Er hatte sie kaum kennengelernt. Attraktiv ist sie nicht, das kann er sagen, nicht einmal hübsch. Eine kleine Frau und ein bißchen pummelig. Doch das mochte damit zu tun haben, daß sie bereits im siebten Monat schwanger war.
Alice behauptete später, Christina habe feine Züge, Lachfältchen und ein sinnliches Grübchen über der Oberlippe. Grüne Augen. So genau hatte er seine Schwiegertochter gar nicht angeschaut. Ihre Mutter auf jeden Fall war eine kleine, dicke, bösartige Frau, die den ganzen Abend weder mit Alice und ihm noch mit Ali ein Wort gewechselt hatte.
Christina hatte ihnen erzählt, daß sie nach ihrer Banklehre mehrere Jahre in Afrika gearbeitet habe. In einem Hotel an der Diani Beach, dessen Namen er schon wieder vergessen hat. Nebenbei, und weil den Einheimischen der Zutritt zu den Touristenhotels verboten war, gründete sie zusammen mit einem Inder eine Ladenkette. In den Nischen der Hotelhallen verkauften sie den Touristen bedruckte Tücher, Afro-Kitsch, geschnitzt und getöpfert. Selbstverständlich gegen harte Devisen. Später soll ihr dann ihr Chef einen Job als Vermögensverwalterin und Anlageberaterin vermittelt haben. Immobilien.
Jaja, Christina Frank kennt seine Wahlheimat, daran zweifelt Mettler keinen Augenblick. Auch ihm wollte man vor Jahren einen solchen Hotelshop schmackhaft machen. Die Lösung seines Devisenproblems. Wertlose Schillinge würden sich in Dollars, Deutsche Mark und Schweizerfranken verwandeln. Doch er und Alice wollten in ihrem Hotel keine Krämerbude. Abgesehen davon, daß diese Art von Geschäften nicht über jeden Zweifel erhaben war. Doch er sagte nichts. Auch nicht, daß er ihre Firma kannte.
Selbstverständlich gehörten Christinas Freunde aus Afrika zur Schar der Hochzeitsgäste: Judith Kibo, eine bildhübsche Kalenjin, die zusammen mit Christina in die Schweiz gekommen war, als diese von ihren Chefs, Frau Stocker und Lomazzi, in die Schweizer Geschäftsverwaltung berufen wurde. Der indische Geschäftspartner von Christinas Ladenkette, Ralf Vir. Henrik Imbugwa Kimele, ein Sohn oder Vetter des kenyanischen Finanzministers.
Die wichtigsten Gäste aber, zumindest für Christina, waren wohl Esther Stocker, eine etwa fünfzigjährige Frau, von der es hieß, sie sei vor Jahren die Geliebte eines afrikanischen Ministers gewesen, und der Italie-ner Salvatore Lomazzi, der gerade von einer Geschäftsreise aus Ostafrika zurückgekehrt war. Lomazzi kannte Lamu: