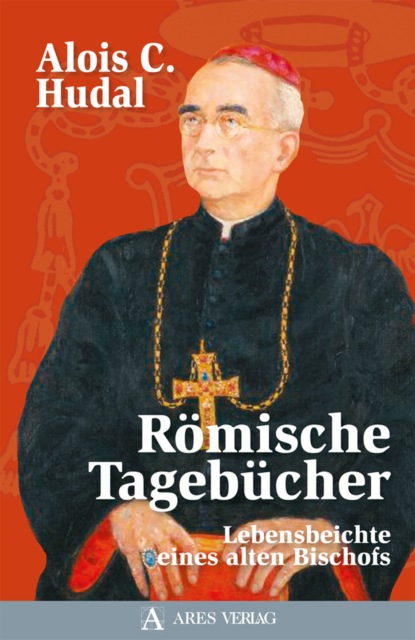- -
- 100%
- +
Es waren herrliche Bekenntnisse, die mich mit größter Freude erfüllten. Als wir auf das wissenschaftliche Arbeiten zu sprechen kamen, gestand er mir seinen Unwillen, daß auch ihm trotz der mündlichen Zusage Pius’ X. niemals eine Einsicht in das reiche Archivmaterial des Heiligen Offiziums gewährt worden war. Ein glücklicher Zufall vermittelte ihm aber die Kenntnis von nicht wenigen Urkunden dieser höchsten päpstlichen Behörde, die unter Napoleon nach Venedig und Paris verschleppt worden waren. So war es verständlich, daß manches in seinen Darstellungen im Urteil der Kritik als einseitig empfunden wurde. Daß er selbst an der römischen Kurie Gegner hatte, obwohl seine Papstgeschichte ganz in katholischer Schau geschrieben wurde, sah ich, als ich Kardinal De Lai, Sekretär der Konsistorialkongregation, den wichtigsten Berater Pius X., besuchte, der auch beim Pontifikatswechsel als Vertreter eines zentralistischen Kurses und wesentlicher Mitarbeiter am kirchlichen Rechtsbuch in großem Ansehen stand. Als wir zufällig auf die Papstgeschichte zu sprechen kamen, als ich ihm von meinem Besuche bei Pastor berichtete, meinte er: „Meno verità e più carità sarebbe stato meglio10).“ Es war ein hartes Urteil über das wissenschaftliche Schaffen eines Mannes, der Jahrzehnte der Wissenschaft im Sinne des Papsttums verwendet und zahlreiche Angriffe von Nichtkatholiken geerntet hatte. Warum dunkle Seiten im Buche der Kirchengeschichte überschlagen? Warum eine idealistische Frisierung nach Art von Legenden und frommen Andachtsbüchern! Warum Kirche und Papsttum mit Wolken stützen, während doch beide auf ehernen Säulen ruhen und letzten Endes auch durch eine Darstellung der menschlichen Entwicklung mit Fehlern, Armseligkeiten und tief bedauernswerten Verfallserscheinungen (es genügt an das 9. Jahrhundert, Tuskulaner und an die Vor-Renaissance-Zeit zu erinnern) nichts vom Goldgrund göttlicher Führung verlieren können. Pastors Ruhmesblatt ist nicht bloß das monumentale Werk seiner Papstgeschichte, die kein Panegyrikus nach Art romanischer Darstellung ist, sondern daß er als Laie trotz vieler Tiefenblicke in das Dämonische und Untermenschliche auch in der Welt des Religiösen seinen Kindesglauben rein und unversehrt bewahrt hat. Das ist das Heldische in seiner Persönlichkeit. Feinde, Intrigen, lieblose Kritik, da er von seinem großen Gegner P. Ehrle als „integraler“ Katholik wenig geschätzt war, nichts war imstande, ihn von der Liebe zur Kirche zu trennen. Es war mir oft, als sehe er die Menschen nicht mehr, sondern nur die „civitas supra montem“10a) — das himmlische Jerusalem, die entmenschlichte, geläuterte Kirche.
Pastors Lebenswerk wird aber die Jahrhunderte überragen, auch wenn Nichtkatholiken und einzelne katholische Geschichtsforscher manche Abschnitte seiner Darstellung anders beurteilen, mehr vom Standpunkt einer natürlichen Entwicklung oder des Dämonischen, das auch vor dem Kirchenportal nicht haltmacht. Die Gefahren begannen für ihn, als drei Fragen ein klares und, soweit menschliches Wissen ein sachliches Urteil überhaupt ermöglicht, ein solches forderten: Savonarola, dessen klassische Geschichtsdarstellung durch Schnitzer nicht überboten werden konnte — der Heilige gegenüber einem Alexander VI. —, der Ritenstreit in China, in dem Jesuiten, die weitblickende Männer unter sich hatten, und Dominikaner sich als Gegner gegenüberstanden —, in Wirklichkeit hatte diese Geschichte mit Religion nicht das Geringste zu tun; es war nur eine machtpolitische Frage der europäischen Protektoratsstaaten, für die China als Kolonie ein Geschäft war, dessen Betrieb nicht durch religiöse Neuheiten gestört werden durfte, und endlich die heikelste aller Fragen, die Aufhebung des Jesuitenordens durch Papst Klemens XIII. Hier mußte er, wie immer sein Urteil war, in einen Gegensatz kommen zu den Söhnen des Spaniers Ignatius und den bereits im Niedergang befindlichen Minoriten, die für den Papst als ihren Ordensbruder leidenschaftlich Stellung nahmen. Als dieser letzte literarische Kampf tobte, ohne je wirklich ausgefochten zu werden, da schließlich jeder Teil Gründe für und gegen sich hatte, trat Ehrle hinter den Kulissen in Erscheinung, um Pastors weitere wissenschaftliche Arbeit zu unterbinden. Die wahre Wissenschaft lebt aber nur von der Freiheit des Irrtums, und so habe ich mich niemals dazu hergegeben, Dienste gegen Pastor über Wunsch dieses Jesuitenkardinals zu besorgen. Schmerzlich berührte es mich, als eines Tages der Jesuitenkardinal Ehrle mich ersuchte, in geschickter diplomatischer Form auf Pastor einzuwirken, damit er seine wissenschaftliche Arbeit einstellen möge, „er sei nicht mehr auf der Höhe“. Ich habe dem alten Kirchenfürsten erwidert: „Warum machen Sie denn das nicht selbst angesichts Ihrer hohen Stellung?“ Es war unvermeidlich, daß Pastor, der in Rom als Vertreter des katholischen Integralismus betrachtet wurde, in einen Konflikt mit verschiedenen Mitgliedern der Gesellschaft Jesu kommen mußte, obwohl in München mehrere Jesuiten einen Großteil seiner Arbeiten besorgten. Das Kapitel über die Auflösung dieser bedeutenden Ordensgesellschaft war zu gefährlich, auch wenn er es noch so vorsichtig schreiben wollte. Es ehrt den genialen und wahrheitsliebenden Jesuitengeneral Ledochowski, daß er Pastor stets in enger Freundschaft verbunden war. Ich danke Gott, der Bitte Ehrles niemals entsprochen zu haben.
Spät abends besuchte ich den Kurienkardinal Andreas Frühwirth. Der Sohn einer schlichten Bauernfamilie aus dem Grenzgebiet Steiermarks wurde später einer der eifrigsten Vorkämpfer der deutschen Sprache und des Deutschtums im bedrohten Gebiet überhaupt. Er liebte Österreich und Deutschland und fühlte sich in dankbarer Erinnerung an seine Münchner Nuntiaturzeit auch als Anwalt deutscher Angelegenheiten und Wünsche in Rom. Seine besondere Sorge galt der Erhaltung einer deutschen Seelsorge und des Religionsunterrichtes in deutscher Sprache in den öffentlichen Schulen Südtirols. „Die päpstliche Kurie denke in einzelnen ihrer Vertreter zu realpolitisch, da es schließlich nicht wesentlich sei, in welcher Sprache das Christentum von einem Menschen aufgenommen werde.“ Er hatte eben einen Hilferuf der Brixener Bischöflichen Kurie gegen die nationale Unterdrückungspolitik der Faschisten an das Staatssekretariat weitergeleitet. Dann sprach Kardinal Frühwirth, der Mitglied mehrerer päpstlicher Kongregationen, darunter jener für die Riten, war, von den Heiligsprechungsprozessen. Ihm war es in erster Linie um jene für deutsche Heilige zu tun. Daß er mehrere Prozesse (so jenen für Albertus Magnus, die Mystikerin Margarethe Ebner) auch wegen des schleppenden Formalismus nicht weiterbringen konnte und daß im größten Tempel der Christenheit immer nur Romanen auf die Altäre erhoben wurden, als ob deutschen Menschen der Sinn für eine kanonisierte Heiligkeit abhanden gekommen wäre, das alles quälte ihn, auch wenn er andererseits zugab, daß die Kirche des deutschen Volkes an Seligen nicht Mangel hätte. Nach seiner Auffassung besteht bei den Beamten dieser Kongregation, von denen nur wenige die deutsche Sprache beherrschen, mehr Interesse für solche romanischer Länder, während deutsche Prozesse jahrzehntelang im Staub der Archive liegen. Die Weltkirche sei auf diese Weise in Gefahr, in Frömmigkeit und Heiligenkult eine romanische Farbe zu erhalten. Ich bewunderte diese Haltung des Kardinals, dem das römische Volk wegen seines ehrenhaften Lebenswandels den Beinamen eines „Santo“ gegeben hatte. Er selbst war in gewisser Hinsicht nach dem alten Spruch „Vox populi, Vox Dei“11) bereits kanonisiert. Eine Stunde flog im Zuhören wie nichts dahin. Frühwirth war ein liebenswürdiger, stets hilfsbereiter, kluger Mann ohne jede Präpotenz, der seine hohe Würde nicht eitel zur Schau trug. Er hatte sich in Rom sein deutsches Herz bewahrt. Nach dem Urteil italienischer Stellen hätte er als Nuntius versagt, da er die strengen Maßnahmen Pius’ X. gegen die modernistischen Strömungen an deutschen Hochschulen nicht durchführte oder immer wieder milderte. Als ich auf dem Heimweg meine ersten Eindrücke in Rom überlegte und die Urteile dieser beiden Persönlichkeiten Pastor — Frühwirth vergegenwärtigte, war mir eines klar geworden: Beide waren römisch gesinnt im besten Sinne dieses Wortes, aber beide dachten und fühlten deutsch, der hochbetagte österreichische Kardinal mehr als Pastor.
Heute morgen standen im Programm die deutsche Botschaft und bayerische Gesandtschaft beim Heiligen Stuhl, der reichsdeutsche Jesuitenkardinal Ehrle und mehrere päpstliche Würdenträger des Vatikans. Allen war ich ein Unbekannter, der zum ersten Mal ihren Weg kreuzte. Der deutsche Reichskanzler Wirth, der gerade bei einem Empfang in der deutschen Botschaft Villa Bonaparte in der Via Piave, zu dem ich eingeladen war, anwesend war, kannte die Steiermark und meinte, in diesem Grenzlande sei das Deutschtum kein blutmäßiges Bekenntnis, sondern ein nationaler Daseinskampf, die Revolution zweier Rassen, ein seelischer Konflikt. Ich bemerkte aus dem Gespräch mit den beiden Chefs der diplomatischen Missionen, daß die Frage des staatspolitischen Rechtsschutzes der deutschen Nationalstiftung und die Verdrängung der Österreicher vom Rektorat der Anima beziehungsweise wenigstens die paritätische Leitung von abwechslungsweise Reichsdeutschen und Österreichern ihr Sorgenkind war. Beide, Diego von Bergen und Freiherr Ritter von Groenesteyn, die im Vatikan den Einfluß des Gesandten Pastor nicht untergraben wollten, da er ihnen wegen seiner Beziehungen manche wertvolle Auskunft vermitteln konnte, stammten aus der alten Diplomatenschule. Beide waren Grandseigneurs, treffliche Vertreter des Reiches und Bayerns. Ich hatte, nachdem der Einfluß des geistlichen Botschaftsrates Steinmann, eines Schlesiers, mit dem der Breslauer Kardinal Bertram manche Schwierigkeiten durchzukämpfen hatte, zurückgedrängt war, das Glück, mit beiden führenden Diplomaten in freundschaftliche Beziehungen treten zu können. Nach 1930 gab es zwischen uns keine Reibungen mehr. Wiederholt schützte mich besonders der bayerische Gesandte gegen die Hintertreppenpolitik des Jesuiten Ehrle. Wichtige geheime Gutachten für das Berliner Auswärtige Amt sind durch meine Hände gegangen, und ich war immer bestrebt, auch wenn ich keine amtliche Stellung dortselbst annehmen konnte, wie einst der Österreicher Johannes von Montel im Sinne einer gesamtdeutschen Haltung tätig zu sein. Der Weg führte mich zum Jesuiten Ehrle, der in einem bescheidenen Ambiente des südamerikanischen, von seinen Ordensbrüdern geleiteten Kollegs in den Prati wohnte. Eine hoheitsvolle Erscheinung, Gelehrter von Weltruf, huldvoll lächelnd mich zum Ringkuß zulassend. Sein Blick gefiel mir nicht, er hatte etwas an sich, das kein großes Vertrauen einflößen konnte. Von Pius X. wegen seiner Arbeit gegen die Gründung eines internationalen katholischen Geschichtsforschungsinstituts vom Vatikan ausgeschaltet, kehrte er nach dem Krieg wieder nach Rom zurück, wo er für seinen Nachfolger Achille Ratti Stimmung machte und schließlich den Purpur erhielt. Ehrle hatte, wie ich schon bei der ersten Aussprache bemerkte, keine feste nationale Haltung. Er schätzte Österreich nicht hoch ein, obwohl er wiederholt im Jesuitenkolleg von Feldkirch (Vorarlberg) die Verhältnisse beobachten konnte. Er hatte auch kein großes Verständnis für die nationalen Belange der Südtiroler. Es schien ihm selbstverständlich zu sein, daß diese armen, vom deutschen Mutterlande gegen die Versprechungen Wilsons abgetrennten Menschen ihre völkischen Forderungen der deutschen Jugenderziehung, des Unterrichts in der Muttersprache den Interessen der Weltkirche, in diesem Falle Italiens, unterordnen müßten. Er war Römer geworden, der delikaten Fragen und Problemen auf Umwegen auszuweichen suchte. Zwischen uns beiden hat seit dem Kampf um das Rektorat eine Isolierschicht bestanden. Ich klagte diesem Ordensbruder im Purpur meine Anfangsschwierigkeiten, da mit der Anima auch die Vertretung fast aller reichsdeutschen und österreichischen Bistümer bei den päpstlichen Verwaltungsbehörden verbunden war. Ehrle, der Rom aus einem jahrzehntelangen Aufenthalt kannte, gab mir aber einige treffliche Worte: „Italiener haben uns Deutschen gegenüber allerlei voraus. Sie nehmen nichts tragisch und nichts gründlich. Sie weichen, solange als möglich, grundsätzlichen Lösungen aus. Das ‚arrangiare, combinareund dilatare‘11a) ist ihre große Weisheit in der obersten Kirchenleitung. Sie lassen die Zeit arbeiten. Wir Deutschen müßten Gott danken, daß wir nicht zur Regierung der Kirche berufen wurden. Mit unserem Organisationsfanatismus, mit Statistiken und unserer nationalen Eigenart der Gründlichkeit des ‚andare in fondo‘11b) alles ordnen zu wollen, Fragen und Probleme wissenschaftlich bis in die letzten Schlußfolgerungen auszudenken, eigene Auffassungen anderen aufzudrängen, hätten wir eine Weltkirche, die auf so viele Nationen Rücksicht nehmen muß, nur in die größten Schwierigkeiten gebracht. Der Deutsche ist religiös gründlicher als der Italiener, denn er sucht Probleme, wo sie nicht vorhanden oder nicht zu lösen sind, aber gerade seine Kritiksucht macht ihn nicht geeignet, einen so komplizierten Mechanismus, wie es der römische Katholizismus ist, ruhig und ausgleichend ohne Erschütterungen und gewaltsame Lösungen zu regieren.“
Die Worte dieses alten Kirchenfürsten, der fast fünfzig Jahre in Rom, wenn auch in erster Linie unter den Bücherschätzen der Vatikanischen Bibliothek, verbracht hatte, sind mir eine große Lebensweisheit geworden, so betrübend ich ihren Hintergrund empfinden mußte. Leider hat später gerade dieser den Einflüsterungen nicht unzugängliche Kardinal mir hinter den Kulissen viele Schwierigkeiten in der Leitung von Kolleg und deutschsprachiger Gemeinde bereitet, da er sein Vorurteil gegen Österreich nicht ablegen konnte. Ich eilte durch das Quartiere del Rinascimento — die sogenannte Spina, die damals noch beide Borghi voneinander trennte, sie war noch nicht niedergelegt — zum Vatikan. Glanzvolle Kardinalspaläste, die noch im Verfall und ihrer Verwahrlosung vom Reichtum ihrer einstigen Bewohner zeugten, dagegen armselige menschenunwürdige Schaluppen — Slums, in denen dicht zusammengedrängt oft bis zu sechs Menschen in wenigen Räumen arbeiten, essen und schlafen mußten, manche vielleicht zufrieden mit ihrem niedrigen Lebenskomfort oder wenigstens lethargisch geworden, rückständig auf sozialem Gebiet. Es kann im 16. Jahrhundert, als die Erbauer der Paläste hochherzige Mäzenaten der Kunst waren, nur noch schlechter gewesen sein, als Luthers Schatten die verweltlichte Kirche zu stören begann. Traumverloren schreite ich durch dieses Viertel mit engen Gassen und dem finsteren Borgo, vorbei am Hause des Arztes Leos X., noch einige wenige Schritte und die Kolonnaden Berninis mit dem unvergleichlichen Petersplatz sagen mir, daß ich nunmehr auf heiligem Boden stehe, wo jede Kritik verstummen soll. Ich eile nach St. Peter. Phantastisch strömt das Licht von der Kuppel in alle Arme des Baues. Es ist schwierig, hier innig zu beten. Ich gehe von einem Grabdenkmal der Päpste zum anderen und blicke zur Decke. Die Raumwirkung ist befreiend von jeder irdischen Schwere. Ich suche einen stillen Winkel, um dem Apostelfürsten oder irgendwelchem der ungezählten hier begrabenen Heiligen betend meine Aufgabe in Rom als Leiter der deutschen Nationalstiftung anzuvertrauen. Heute empfing mich Kardinalprotektor der Anima Merry del Val, ihm und dem Geschichtsschreiber der Päpste Baron Pastor hatte ich in erster Linie meine Ernennung zum Rektor zu verdanken.
Fast jedes Institut in Rom hat einen Kardinalprotektor. Der erste in der Geschichte der Anima war der Neffe Papst Pauls II., Marco Barbo, 1469, der auch der Bruderschaft der Anima angehörte und die deutschen Verhältnisse aus der Zeit seiner Kardinalslegation kannte. Viele erlauchte Namen folgen in den Jahrhunderten — unter anderen, um nur einige Namen zu nennen, Otto Truchsess von Waldburg (Bischof von Augsburg), Madruzzo-Trint, Colonna, Scipione Borghese, Alessandro Albani, Harrach, Kollonitsch, Herzan. Einige von diesen waren auch beim Vatikan Protektoren der deutschen Nation, Deutschlands oder der österreichischen Erblande.
Merry del Val war eine wahrhaft fürstliche Erscheinung. Trotz gegenteiliger Behauptungen, die in Rom verbreitet wurden, eine Persönlichkeit von hoher Geistigkeit. Er war eine glückliche Mischung und Verkörperung des Spanischen, Englischen und der Romanität. Deutschland liebte er nicht seit den üblen Erfahrungen als Staatssekretär Pius’ X. mit der Borromäus-Enzyklika und dem zurückgezogenen Modernisteneid der Theologieprofessoren. Beide mußten über Druck der preußischen Vatikanvertretung und des Berliner Auswärtigen Amtes zurückgezogen werden. Alles, was die spitze Zunge des römischen Pasquino („Merry del Val non val12)“ über diese Persönlichkeit sagte, war böswillige Kritik. Wohl konnte ein Großinquisitor des mittelalterlichen Spanien nach den Gemälden von El Greco und dem Roman Dostojewskys kein anderes Profil gehabt haben, in dem alles Würde und Strenge ohne Kompromisse war. Von diesem Fürsten der Kirche hätte ich, auch wenn ich ihm nicht zu Dank verpflichtet wäre, nur den besten Eindruck erhalten. Rede, Gesichtsausdruck, vornehme Erziehung, Würde und Liebenswürdigkeit wirkten harmonisch in ihm zusammen. Gegenüber so vielen anderen, die ich kennenlernen mußte, ein kirchlicher Grandseigneur auch in der aufrichtigen Gesinnung des Wohlwollens. Dem Wunsch seines Geheimsekretärs Monsignore Canali, der von Papst Benedikt XV., seinem Rivalen, bald nach der Wahl infolge des Wechsels der Vatikanpolitik aus dem Amt eines Substituten im Staatssekretariat entfernt worden war, konnte ich später nicht entsprechen. Er bat mich, die Geschichte Merry del Vals als Staatssekretär zu schreiben. Da wegen des Amtsgeheimnisses nur wenige Urkunden des Vatikanarchivs zur Verfügung gestellt werden konnten, mußte ich diese ehrenvolle Aufgabe ablehnen, um nicht einen Panegyricus ohne wissenschaftlichen Wert verfassen zu müssen. Merry del Val war auch eine wohltuende Ausnahme gegenüber den gewöhnlichen Kardinalprotektoren religiöser Institute in Rom. Er nahm diese Aufgabe nicht als eine Förmlichkeit, sondern als persönliche Verantwortung. Noch über Wunsch der österreichischen kaiserlichen Vatikanbotschaft zum Protektor der Anima ernannt, hat er nach 1923 wesentlich geholfen, die Rechtsansprüche der Belgier und Holländer zu klären.
Durch Kardinal Merry del Val wurde ich bald nach meiner Ernennung zum Rektor der Anima in die höchste römische Behörde, das Heilige Offizium, berufen, der ich stets in tiefer Dankbarkeit gedenke, nachdem ich die Ehre hatte, über 35 Jahre dieser als Berater angehört zu haben. Schwerwiegende Entscheidungen gingen in diesen langen Jahren durch unsere Hände. Verurteilung der Action francaise; Massenübertritte ganzer serbisch-orthodoxer Orte zum Katholizismus, um dadurch der gewaltsamen Ausrottung durch die Ustascha-Truppen des Kroatenführers Pavelič zu entgehen; Priesterweihe für zur Kirche heimkehrende protestantische Pastoren, die verheiratet waren und deshalb nicht zum Zölibat verpflichtet werden konnten; Befreiung verunglückter Priester, die als das Opfer von Beichtvätern und einer rückständigen Seminarerziehung trotz sexueller Schwierigkeiten in diesen Beruf hineingeraten sind — weitherzig, eines wahren obersten Seelenhirten war die Haltung Pius‘ XII., wenn solche Fälle ihm vorgetragen wurden, meistens unerhörte seelische Tragödien — besonders in Italien zählte man mehrere Tausende; die Verurteilung des politischen Kommunismus, mehrere Werke des NS (Rosenberg, Bergmann); „prêtres ouvriers“12a) (eineigener, meistens vergeblicher Versuch, die Arbeiterschaft der Kirche wieder zurückzuerobern); die Wiedereinrichtung des Diakonats ohne Zölibatszwang im Sinne der Urkirche; Bestrebungen der Wiener Nuntiatur, die Freimaurer über die Johannesloge von Österreich aus mit Rom zu versöhnen — Befürworter war der dortige Nuntius, der das Wesen dieser Bewegung verkannte, wie Berichte an das Staatssekretariat (1952—53) deutlich beweisen.
Dieses Crescendo in den Besuchen großer römischer Persönlichkeiten glitt etwas ab, als ich dem päpstlichen Majordomus Samper und dessen Stellvertreter, dem Maestro di Camera Caccia-Dominioni meine Aufwartung machen mußte. Ersterer, eine elegante Erscheinung von südamerikanischer Herkunft, war nicht minder liebenswürdig als der junge Mailänder Prälat, den Pius XI. nach Rom mitgebracht hatte und der bald sein vertrauter Freund geworden ist. Ersterer war ein Fremdkörper in dieser eigenartigen Welt, in die Ausländer sich selten ganz hineinleben können. Caccia-Dominioni liebte scherzend ein freies Wort. So unterbrach er mich lachend mit dem alten römischen Pasquinowort: „Cardinali sono come amici inutili e come nemici prepotenti13).“ Als ich von beiden weg in den Damasushof ging, fuhr gerade ein Stromlinienwagen, Type Maybach, eines ausländischen Vatikangesandten vor. Unwillkürlich dachte ich an die Worte, die einst Manzoni, der als guter Katholik nicht minder ein offenes Urteil über das politische Leben hatte, an seinen Verwandten Marchese d’Azeglio geschrieben hat: „Io trovo la cosa più inutile la diplomazia. Gli ambasciatori non sono che spie messe a origliare nelle anticamere. Questo poteva essere buono una volta, ma adesso che c ‘è la stampa, cosa serve 1 ’ambasciatore? A ricevere uno schiaffo come Hübner*) o come Barrili, ad assicurare che tutto va bene in Spagna la vigilia della cacciata della regina14)?“
Was würde er im Zeitalter der Demokratie sagen, da Diplomaten oft nur mehr Briefträger der gerade am Regierungsruder befindlichen politischen Parteien ihres Staates sind, abhängig nicht von den Monarchen, die eine Kontinuität des politischen Denkens verkörperten, sondern von ständig wechselnden Stimmungen der die Masse beherrschenden Zeitungsschreiber und die deshalb auch als Gesandte bestrebt sein müssen, die Personalpolitik des Vatikans nach opportunistischen Gesichtspunkten zu beeinflussen. In den langen Jahren habe ich nicht wenige Diplomaten in Rom kennengelernt. Mehrere waren ausübende Katholiken, andere liberal, religiös gleichgültig, Protestanten, Orthodoxe; auch Mitglieder der Loge konnten bei den eigenartigen Verhältnissen Südamerikas nicht fehlen. Diplomatische Rücksichten, Berechnung und politische Hemmungen sind für die Kurie unvermeidliche Begleiterscheinungen. Im Zeitalter der katholischen absolutistischen Monarchen, die den anderswo nicht verwendbaren Adel auf hohe Kirchenposten beriefen, mußte Rom nicht selten mit dem herrschenden Staatssystem gehen, wie es Rosmini in seiner Schrift „Die 5 Wunden der Kirche“ in ergreifender Weise geschildert hat.
In republikanisch-konstitutionellen Staaten mit demokratischer Parteienbildung muß dieselbe Kirche im Interesse höherer Vorteile zu manchen Dingen schweigen und die am Ruder befindlichen Parteien stützen, weil der betreffende Botschafter oder Gesandte im päpstlichen Staatssekretariat seine Minen legt oder bremst, nicht selten unterstützt von trüben Kanälen des Weltjournalismus, während ein vom Staate unabhängiges, kämpfendes, sich auf eigene Füße gestelltes Kirchenwesen schon längst öffentlich gemeldet hätte. So gibt es kein Staatssystem, mit dem der Vatikan nicht verhandeln muß und mit dem er nicht Kämpfe und Auseinandersetzungen hat, um mitten im religiösen Verfall der Zeit vom weltanschaulichen Erbe der Vergangenheit wenigstens etwas retten zu können. In gespannter Erwartung begab ich mich zum ersten Mal in das päpstliche Staatssekretariat, um mich den beiden höchsten Beamten dortselbst, Pizzardo und Borgoncini-Duca, vorzustellen. Nachdem ich die übliche Wartezeit antichambriert hatte, wurde ich zuerst zum Sostituto des Kardinalstaatssekretärs vorgelassen. Die Aufnahme war höflich und liebenswürdig, wie es italienischer Sitte entspricht. Sie galt wenigstens nach den äußeren Eindrücken mehr dem Österreicher als dem Deutschen, denn die Tragödie des Kammerherrn und Geheimsekretärs Benedikt XV., Monsignore Gerlach von Baden, war noch nicht vergessen. Er hatte das Vertrauen seines hohen Herrn im Ersten Weltkrieg schmählich mißbraucht und war vom italienischen Gericht als Spion zu langer Kerkerhaft verurteilt worden. Pizzardo, ein ehemaliger Jesuitennovize, mit dem intuitiven Blick des Italieners, äußerst beweglich, fast feminin, machte nicht den Eindruck des profunden Kenners der Verhältnisse, sondern eines von anderen im Urteil abhängigen Menschen. Er war der Vertreter mancher Schichten römischer Kurialisten, deren Kirchenpolitik immer bereit war, Verträge und Annäherungen an die jeweilige politische Machtgruppe zu erreichen, während sie für den Fall eines politischen Wechsels ihre Leute auch im anderen Lager hatten. In dieser Haltung wurden sie von der wendigen Gesellschaft Jesu gestärkt, die, um ein klassisches Beispiel aus der neuesten Zeit herauszugreifen, in der Frage von Freimaurerei und Kirche kompromißfreudige Mitglieder (besonders in Frankreich und Amerika) hatte (P. Bertheloot) und deshalb überall für Demokratie, Persönlichkeitsrechte, Freiheit des Gewissens und Individuums (die alten zu Beginn des 19. Jahrhunderts verurteilten Auffassungen von Lamennais) eintraten, während andere wiederum eine ablehnende Stellung bezogen, so daß der Orden, wie immer die Sache schließlich endigen sollte, für alle Fälle etwas in Händen hatte, um durch Schwierigkeiten hindurchzukommen. Das Opfer sind die linientreuen Charaktere und Idealisten, denen das „salvarsi la pelle15)“ nicht gelungen ist. Seine erste Frage war, wie weit Österreich schon im Ausbau der katholischen Aktion fortgeschritten sei. Ich mußte ihm leider erwidern, daß praktisch sich nur wenige damit beschäftigen können; niemand wisse recht, ob es sich nur um eine straffere Zentralisation der zahlreichen in Österreich seit Jahrzehnten bestehenden Vereine und Verbände handle oder um Neuorganisation der gesamten katholischen Front für politische Endziele, um, wie Bischof Besson (Fribourg) es so geistreich formulierte, der „insufficience du Clerque e sufficience des laiques16)“ nachhelfen zu können. Tatsächlich steckte damals Österreich ganz in den politischen und wirtschaftlichen Daseinssorgen, um diesen Rumpfstaat von Saint-Germain, der nicht recht leben, aber andererseits auch nicht sterben konnte, über die Wirtschaftskrise der unmittelbaren Nachkriegszeit für eine bessere Daseinsform hinwegzuretten. So kamen auch die Beschlüsse der ersten Katholikentage Österreichs über gewisse allgemeine Richtlinien ohne politische Zielsetzung nicht hinaus. Wesentlich günstiger war der Besuch bei Monsignore Borgoncini-Duca, dem späteren Nuntius in Italien. Er kannte Österreich vom Hörensagen aus den Berichten der Wiener Nuntiatur und katholischen Presse. Auch er war von feinen gesellschaftlichen Umgangsformen, wenn auch ein Vertrauensmann der deutschen Botschaft ihn mir als wenig zuverlässig geschildert hatte. Den Hauptpunkt des Tages bildete mein Besuch bei Kardinalstaatssekretär Pietro Gasparri. Äußerlich wenig gepflegt, fast vernachlässigt wie manche Vertreter des armen italienischen Landklerus, war er huldvoll, mir trotz seiner gewaltigen Arbeitslast eine lange Audienz zu gewähren, nachdem Gesandter Pastor mir geraten hatte, das Gespräch sofort auf das neue kirchliche Rechtsbuch zu bringen, dessen geistiger Vater Gasparri war. Sogleich erzählte er von den reichen Erfahrungen, die er im Verkehr mit den Konsultoren verschiedenster Nationen und mit den Mitgliedern der Kardinalkommission gesammelt hatte, deren Aufgabe die Festlegung der einzelnen Paragraphen des Codex iuris canonici war. Neben Merry del Val die interessanteste Persönlichkeit des Kardinalskollegs, war er von einer rührenden Bescheidenheit, ein einfacher, schlichter Mensch aus dem Bauerndorf Uscita in Umbrien, der mitten in der monotonen Hofetikette der Kurie seine Natürlichkeit bewahrt hatte. Während des Weltkrieges nahm er eine äußerst kluge Haltung ein, gegenüber den Bestrebungen von Erzberger-Flotow die römische Frage mit den Kriegszielen staatlicher Mächte zu koppeln. „15 Jahre habe ich freiwillig auf jeden Urlaub verzichtet, um das kirchliche Rechtsbuch zu vollenden, das ich bereits als Professor des Institut catholique in Paris begonnen hatte, aber ich bin mir bewußt, daß nicht weniges darin einer Überarbeitung und einheitlicheren Begriffsfassung schon heute bedürftig ist.“