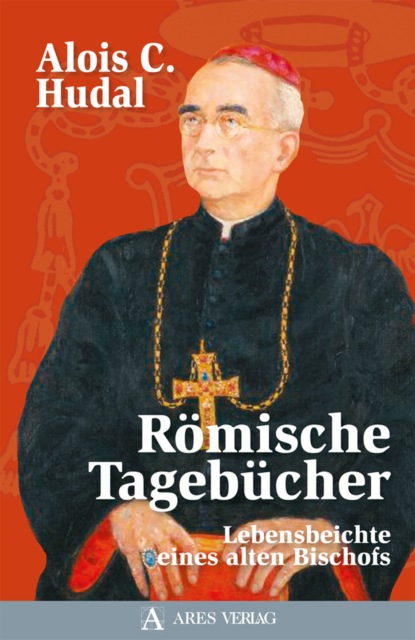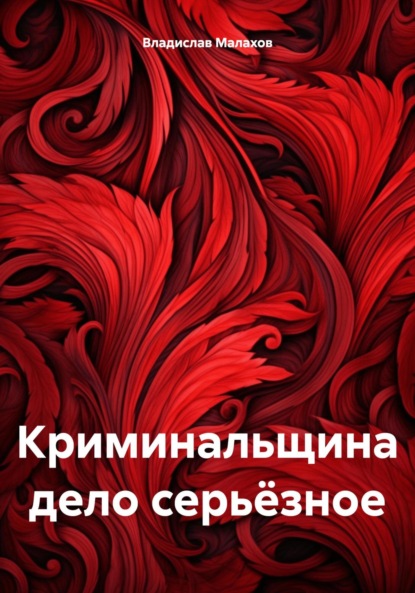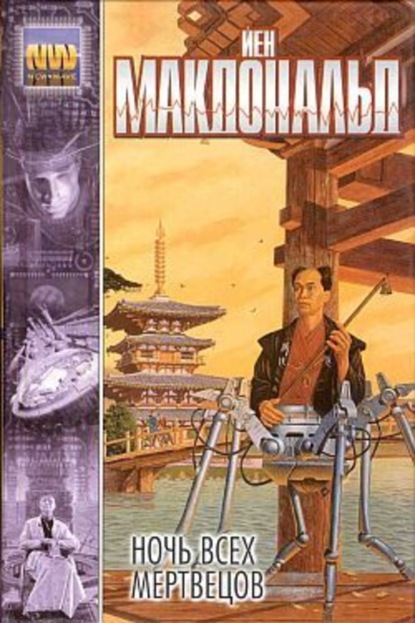- -
- 100%
- +
Als ich 1930 ihm die Bitte des Dekans der theologischen Fakultät in Bonn, Professor König, unterbreitete, dem dortigen kirchenrechtlichen Seminar sein Lichtbild mit Unterschrift widmen zu wollen, holte er persönlich ein solches mit prächtigem Rahmen aus dem Salon und fragte mich so ganz natürlich: „Wie soll ich unterschreiben? Ich bin ja nicht mehr Staatssekretär!“. „Eminenz“ — unterbrach ich ihn — „unterschreiben Sie als solcher, denn Sie sind in die Geschichte als der bedeutendste nach Consalvi eingegangen.“ Er war von einer rührenden Bescheidenheit und demutvollen Einfachheit, dankbar bewegt, wenn man seine Riesenarbeit der Kodifikation des kirchlichen Rechtsbuches würdigte. Ihm merkte man es an, daß er die Ehrenstelle nicht gesucht, sondern daß eine höhere Fügung ihn dorthin gebracht hatte, wo seine ganze Lebensaufgabe ihre Erfüllung finden sollte. Da ich aus seinen Worten auch etwas von Liebe zu meinem unglücklich gewordenen Vaterland fühlte, suchte ich das Gespräch auf die Folgen des Friedensvertrages hinzulenken, der für die Dauer unhaltbar sei. Aufmerksam hörte der hohe Kirchenfürst mir zu, da er die Bedeutung Altösterreichs für den Katholizismus im Donauraum zu würdigen wußte. Schließlich meinte er — darin erwies er sich als Rechtsgelehrter und Realpolitiker — „Warum habt ihr Österreicher diesen Vertrag von Saint-Germain unterschrieben? Jetzt seid ihr leider gebunden.“ Dann fand er Worte herzlicher Teilnahme für das Schicksal der Habsburgermonarchie, die ich als durchaus aufrichtig empfinden konnte, auch wenn man in römischen Kreisen ihn einer besonderen Vorliebe für Frankreich beschuldigte. Als ich nach dieser bedeutsamen Audienz nochmals in das päpstliche Staatssekretariat zurückkehren mußte, um mich einigen untergeordneten, aber für die Anima wichtigen Beamten vorzustellen, meinte ein junger italienischer Monsignore: „Qui si fa la politica17).“
Am Abend sprach ich mit einem katholischen Laien, der aus jahrzehntelanger Beobachtung diese halb religiöse, halb politische Welt kannte und vielleicht Enttäuschungen erfahren hatte — „questi sono pronti di vendere la propria camicia18)“, war sein sonderbares Urteil. Und doch schlägt in dieser merkwürdigen Welt des Vatikans das Herz der römischen Kirche. In dieser Gralsburg des Glaubens an ewige Ideale in der Wüste moderner Zweifelsucht, mit dem schwerelosen, scheuen Lächeln der Beamten, die sich alle langsam ändern, je länger sie in einer Atmosphäre nicht selten gegenseitigen Mißtrauens leben müssen, klingen alle Sorgen, Kümmernisse und Siege des katholischen Gedankens aller Kontinente und menschlicher Armseligkeit zusammen.
Das Staatssekretariat ist mit dem Heiligen Offizium die wichtigste Zentralbehörde der römischen Kirche. In gewisser Hinsicht übertrifft es an Einfluß die letztere Kongregation, weil die Entscheidungen wesentlich von politischen Erwägungen des Augenblicks beeinflußt werden müssen. Keine Bischofsernennung, auch nicht jene der an sich dazu berufenen Konsistorialkongregation, kann ohne vorherige Fühlungnahme und Billigung seitens des Staatssekretariats erfolgen. Es ist natürlich, wenn man von Missionsländern oder von Staaten ohne bedeutendes politisches Parteileben und wenn man von Nordamerika absieht, daß jede Ernennung irgendwie mit den gerade herrschenden politischen Strömungen des öffentlichen Lebens einen Zusammenhang haben muß, um überflüssigen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen. Die Vatikandiplomaten der einzelnen Staaten sind nicht minder interessiert, Komplikationen oder eventuell notwendige Epurationen des politischen Systems ihrer Heimat zu unterbinden, farblosen und konzilianten Vertretern eines sogenannten diplomatischen Christentums im Episkopat die Wege zu ebnen. Nicht wenige Dokumente der Botschafts- und Nuntiaturarchive des 19. Jahrhunderts könnten diese Behauptung geradezu als Dogma der kirchlichen Personalpolitik Roms erhärten, das durch Ausnahmen nichts von seiner Kontinuität verliert. Im Staatssekretariat werden auch die vom Heiligen Offizium, der obersten Stelle für das Gebiet des Glaubens und der Sitten, ausgearbeiteten Maximen, wenn sie nicht rein religiös-spekulative Wahrheiten von Theologenschulen beinhalten, auf ihre augenblickliche politische Tragbarkeit und Opportunität einer Veröffentlichung überprüft, um allen Schwierigkeiten mit den Staaten auszuweichen. So kann heute etwas an sich absolut Richtiges als inopportun verurteilt werden, was übermorgen, wenn ein parteipolitischer Szenenwechsel eintritt, von der gleichen Stelle als eigene Auffassung vertreten wird. Klassische Fälle sind die Namen Bonomelli, Rosmini und jener des Demokratenführers Murri und Don Sturzo, um nur wenige zu nennen. Politik und Religion müssen, wo immer eine Bindung zum Staat besteht, ein Connubium eingehen, in dem Gegensätze nicht kompromißlos ausgetragen, sondern durch Taktik, Ausweichen und Abwarten klug gemildert werden. Ein Mikrokosmus ist deshalb die „casa del padre comune“,18a) das Eigenartigste auf religiösem Gebiet, das die Geschichte in Europa hervorgebracht hat. „Denn welcher Kluge fand’ im Vatikan nicht seinen Meister“, diese Worte des Gesandten von Ferrara im Drama Goethes haben auch für die Gegenwart ihre Bedeutung. Für Rom arbeitet als der mächtigste Kampf- und Bundesgenosse die Zeit. Der Vatikan kann warten, was Parteien, besonders aber Diktatoren und Totalitätssysteme nicht können, ohne an Prestige im Volke einzubüßen. Rom aber gewinnt, je langsamer es arbeitet. Gegenüber manchen Vorwürfen, die von verschiedenen Seiten erhoben werden, als ob gerade das päpstliche Staatssekretariat durch einen „sacro opportunismo19)“ Kämpfer und religiös führende Gestalten nicht vorwärtskommen lasse im Interesse des diplomatischen Christentums, das Kompromisse eventuellen Schwierigkeiten vorzieht, kann man vielleicht mildernd sagen, daß es einen anderen Weg heute nicht gibt. Die Kirche muß jenen klugen Weg des „minus malum20)“, oft des Augenblickserfolges, wählen, nachdem ihr nicht mehr wie im Mittelalter katholische Armeen und die Gerichtshöfe der Inquisition zur Verfügung stehen. Vielleicht hat Joseph Bernhart in seinem Buche über den Vatikan richtig geurteilt, wenn er schreibt: „Ein Bau von geordneten Gliedern in wuchtiger Geschlossenheit, einfach und gewaltig zugleich, so steht die Kurie vor den Augen der Welt und nötigt selbst ihren Feinden Bewunderung ab. Nur ist sie nicht das, wozu ihre Lobredner sie machen wollen, die ideale Verknüpfung gegensätzlicher Regierungsformen. Sie ist vielmehr die reinste Inkarnation des Absolutismus, gestützt nicht nur auf das Gottesgnadentum, die alte Idee der Monarchie, sondern vielmehr auf das Bewußtsein der Statthalterschaft Gottes auf Erden“.
Zwei Erlebnisse. — Eine Feierlichkeit in St. Peter — meine erste Audienz bei Pius XI.
Ein Pontifikalamt des Papstes ist ein gewaltiges Schauspiel, ein Stück Mittelalter in jener Kirche zum Leben erweckt, deren Baugeschichte, äußerlich gesehen, den religiösen Spalt in Europa mitverursacht hat. Vor zwanzig Jahren konnte ich als Kaplan der Anima zum ersten Mal eine solche Feier erleben. Zuviel haben unterdessen Weltkrieg, Revolution und das Schicksal meines armen Vaterlandes in meiner Seele geändert, um mit gleichen Augen alles zu sehen. St. Peter wirkt an gewöhnlichen Tagen wie ein Museum, in das die Menschen hinein- und herausgehen aus Neugierde und kaum das allerheiligste Sakrament beachten. Der Barock wirkt wie Kulissenkunst eines übergroßen Festsaales. Künstlerischer und tiefer ist jener in den süddeutschen und österreichischen Stiftskirchen. Ein Gemurmel von Zehntausenden, die im Petersdome schon eine Stunde vor Beginn der Feierlichkeit versammelt sind, bildet die Einleitung. Fürsten, Grafen, Marchesi und Barone, die Überreste des europäischen Adels, haben eigene Plätze. Kein von allen Teilnehmern gesungener feierlicher Choral und kein gemeinsames Gebet bereitet die Seelen für den großen Festakt vor. Schon erklingen die silbernen Trompeten. Der Festzug, den Ordensgeistlichkeit eröffnet, setzt sich in Bewegung. Interessante Profile, nicht wenige scharfgezeichnete Gesichtszüge. Als der General der Gesellschaft Jesu, P. Wladimir Ledochowski, der schwarze Papst, vorüberzieht, richten sich viele Blicke auf ihn. Viele Zehntausende Ordensmitglieder aller führenden Nationen und in fast allen Staaten unterstehen seinem Kommando. Es ist der Generalstab der Kirche in vielen Dingen. Längst vergessen, überholt und als Unrecht bewiesen klingen heute die harten Worte des Hauptgegners der Jesuiten, Papst Klemens XIV., der in seiner Aufhebungsbulle 1773 schreibt: „Die Jesuiten haben in allen Jahrhunderten den Frieden der Weltkirche gestört.“
Dagegen war einer der ersten Ratschläge, der mir bei meinem Eintreffen in Rom gegeben wurde, ein anderer: „Trachten Sie in Rom mit der Gesellschaft Jesu gut zu stehen, das kann ihrer Stellung beim Vatikan nur nützen, sonst sind Sie verloren.“ Ich konnte demgegenüber darauf hinweisen, daß ich einer der ersten Schüler des vom deutschen Jesuiten Leopold Fonck gegründeten päpstlichen Bibelinstituts war und auch als erste wissenschaftliche Abhandlung in deutscher Sprache „Das Buch der Sprüche“ dortselbst veröffentlichen konnte. Überdies zogen in meinem Geiste verschiedene hochangesehene Mitglieder dieser Gesellschaft vorüber, so Hummelauer, ein Bibelforscher mit selbständigem Urteil, die aus diesem Orden hervorgegangen sind, Hermann Muckermann, der intuitiv die Bedeutung der Rassenfrage und Eugenetik erfaßte, Lippert, der vornehme Essayist, der nicht Weniges in seinem geistvollen Stil Nietzsche zu verdanken hatte, und endlich Przywara, der Philosoph und Ästhet, dessen blendende Gedankengänge besonders die katholische Jugend der Nachkriegszeit begeisterten. In diesen Persönlichkeiten, zu denen später Karrer und Balthasar von Urs kamen, glaubte ich schon in Graz den geistigen Ausdruck der Gesellschaft erblicken zu können. In Rom wurde diese meine Beurteilung nicht geteilt. Sie galten als Außenseiter und nicht als Normaltyp eines Jesuiten.
Prächtige Gestalten sind im Festzug des Papstes die Ordensgeneräle der Dominikaner und Franziskaner. Trotz ihrer in die Zehntausende gehenden Mitgliederzahl können sie sich in der Weltkirche vor allem an der Kurie nicht so durchsetzen wie die Gesellschaft Jesu, obwohl Thomas von Aquin, Albertus Magnus, Bartholomäus Las Casas und Lacordaire nicht bloß für den Dominikanerorden, sondern auch für die gesamte Kirche Sterne ersten Ranges sind. Die Nachfolger des heiligen Thomas vertreten ein wundervolles theologisches System, einheitlicher, geschlossener und konsequenter als jenes anderer Orden. Wenn nicht die letzten Schlußfolgerungen im Mysterium enden, während der forschende Menschenverstand noch weiterschreiten möchte, wäre die Theologie eines Thomas von Aquin das großartigste System theologischen Denkens, das je eine Religion in Europa aufgestellt hat. Daß die Lehre von der ewigen Vorausbestimmung des Menschenschicksals nicht bei Zwingli und Calvin geendet hat, ist das Verdienst der Thomaserklärer, die rechtzeitig aufhören oder sich in die Geheimnisse Gottes flüchten. An uns schreitet vorüber die ehrwürdige Gestalt des Benediktiner-Abtprimas aus der freiherrlichen Familie von Stotzingen. Etwas vom großen antiken Menschentum der Römer lebt in der monumentalen einfachen Mönchregel eines Benedikt bis heute weiter. Unsterblich bleiben die Verdienste dieses Ordens und seiner Abzweigungen in der Kolonisation des deutschen Lebensraumes. Durch Jahrhunderte waren mehrere seiner Abteien in Italien (Farfa, Nonantula) Burgen und Festungen des Römischen Reiches Deutscher Nation. Gegenüber diesen drei alten Orden treten die übrigen, deren Generäle im Farbenreichtum der Trachten einander folgen, weniger hervor, so überaus verdienstvoll ohne Zweifel ihr Wirken im Gesamtorganismus der Weltkirche ist. Ihre manchmal eigenartigen Uniformen, die in romanischen Ländern entstanden sind und mit ihrer fremdartigen Ästhetik kaum in das moderne Stadtbild passen, gehen nach der Lebensgeschichte ihrer Gründer auf Anweisungen Christi oder seiner Mutter zurück.
Vorbei zieht das Heilige Kolleg. In würdig gemessenem Schritt folgen einander die Purpurträger: ehrwürdige Erscheinungen, vom Alter gebeugte Männer, die alle mehr oder weniger ein interessantes Leben hinter sich haben. Seit 1870 wurden sie immer stärker auf die Rolle hoher Verwaltungsbeamten oder vortragender Räte herabgedrückt, abhängig von Ordens- oder Weltgeistlichen, die ihre Referate besorgen, da sie in merkwürdiger Ämterkumulierung meistens vier bis sechs päpstlichen Kongregationen angehören und deshalb auch bei genialster Begabung unmöglich von einer Sitzung zur anderen das gewaltige Arbeitspensum auch nur flüchtig lesen können. Mit Ausnahme von Merry del Val, Gasquet, Billot, Ehrle und Frühwirth gehören alle der italienischen Nation an, die seit Jahrhunderten der römischen Kurie die Angestellten vermittelt, manche aus Süditalien oder Sizilien, wo nicht wenige Heilige geboren wurden, aber im Volke noch viel aus den Religionen der Antike mitgezogen wird. Mein Begleiter, der zum ersten Mal in Rom eine solche große Feierlichkeit mitmachen konnte, fragte mich etwas naiv: „Umfaßt dieses hohe Kolleg in seiner Zusammensetzung alle Nationen? Ist es der Ausdruck einer Weltkirche?“ (Pius XII. hat unter dem Druck der politischen Verhältnisse nach 1945 manches daran geändert.) Ich konnte ihn bald mit der Antwort beruhigen, die ich erst vor wenigen Tagen von einem der besten Kenner Roms erhalten hatte, dem ich ähnliche törichte Fragen vorlegen wollte. Im absolutistischen System der Weltkirche haben Kardinäle wenig zu reden, da ihre Meinung den Papst nicht bindet. Die letzte Entscheidung muß er selbst fällen. Er kann machen, was er nach seinem Gewissen und Urteil für gut findet. Eine Appellation oder irgendwelche Kontrolle im Sinne der Urkirche ist nicht mehr möglich. Deshalb spielt es keine Rolle, wer gerade den Purpur trägt. Die Urteile der Römer sind geistreich, aber hart. Ich höre sie über diese und jene Kardinäle, über den Spanier Merry del Val, den Engländer Gasquet, der die Nichtigkeitserklärung aller anglikanischen Weihen in Rom durchgesetzt hat, den Franzosen Billot, der die in romanischen Ländern besonders urgierte Herz-Jesu-Verehrung als dogmatisch fragwürdig erklärte und eine Vorliebe für eine geläuterte Action française hatte, den deutschen Jesuiten Ehrle, der seiner Würde bewußt, trotz des hohen Alters in aufrechter Haltung dahinschritt. Nichts würde sein Ordensgelübde verraten, irdische Ehren abzulehnen. Das Kardinalskolleg, das in den Jahrhunderten seines Bestandes, weil es (bis ins 19. Jahrhundert hinein) auch Nichtpriester unter sich hatte, auf eine bewegte Geschichte zurückblicken kann, die wissenschaftlich noch nicht geschrieben ist, ist heute gegenüber der großen Bedeutung im Mittelalter eine „umbra magni nominis21)“, wenn auch religiös vorwärtsstrebende Kämpfergestalten und Persönlichkeiten von hoher Kultur in ihm immer vertreten sind. Ihr Privatleben ist opfervoll geworden, ohne Abwechslung, in manchen Dingen ein weiterlebender Barock entschwundener Zeiten. Mich fesselt nur mehr eines, die Gestalt des Papstes, die wie eine Erscheinung vergangener Jahrhunderte mit religiöser Begeisterung durch die Menge auf dem Tragsessel durch St. Peter zieht. Feierlich klingen Perosis Melodien „Tu es, Petrus“ durch die Kirche. Der Jubel hat kein Ende. Wie eine Symphonie von Musik, Religion und Kunst zieht der Ritus des päpstlichen Hochamtes an unserem Auge vorüber — alles ist Einheit, Harmonie, Zusammenklingen.
Als der letzte Segen erteilt wird, dieselben Posaunen erklingen, die Menge im Beifall jubelt, blicke ich hinüber, wo einst die Grabstelle der Mutter Heinrichs IV., Agnes, der Tochter des Herzogs Wilhelm von Aquitanien war, dem die Lombarden ihre Krone angeboten hatten. In der Petronillakapelle liegt sie begraben, unweit vom Papstaltar, an dem die feierlichen Zeremonien der Missa papalis sich vollziehen. Niemand beachtet mehr die letzte Erinnerung an diese deutsche Mutter, nachdem ihr Grab verschollen ist. Beim Neubau von St. Peter wurde alles beseitigt, was den Architekten störte. So teilt Agnes das Schicksal der deutschen Päpste, deren Gräber in Sankt Lorenzo vor den Mauern, im Dom zu Florenz und in Ravenna verschwunden sind. Kein Gedenkstein erinnert mehr an ihre Namen. Sie sind ausgelöscht und leben nur mehr in den Büchern der Geschichte. Nur zwei Fürstlichkeiten der deutschen Nation, Agnes und Otto II., haben als die einzigen gekrönten Häupter aus der langen Geschichte des Römischen Reiches Deutscher Nation hier ihre Ruhestätte gefunden. Auch Agnes erlebte einst in St. Peter den Triumph eines Papstes, als ihr Sohn Heinrich IV. von der Kardinalskommission des Reiches und der Krone verlustig erklärt wurde. Schon beim Ausgang von St. Peter ruht Mathilde von Tuscien, die Gegnerin der Italienpolitik Heinrichs IV., der ihren großen Feudalbesitz bedrohte. Ein weiteres Stück deutscher Tragik. Wie wenn Hieroglyphen sich entziffern, sprechen diese Grabinschriften in die Gegenwart hinein.
Ein zweites Erlebnis. — Das erste Mal beim Papst. Erwartungsvoll schreite ich durch die vielen Säle des vatikanischen Palastes, bis die Glocke das Zeichen gibt, daß ich eintreten darf. Hinter einem schlichten Paravento noch einige Schritte, und ich knie vor dem Steuermann der Weltkirche. Eine wenig künstlerisch ausgeführte Glasmalerei auf dem Fenster hinter dem Thronsessel des Papstes stört den ersten Eindruck, das Geschenk einer Mailänder Firma. Schon auf dem Wege hörte ich, daß der gelehrte Papst mehr Prunk als echte Kunst liebe. Der Oberitaliener hat ein schärferes Profil als der Römer. Kraft, Arbeit und Energie sprechen aus dem Antlitz dieses Papstes. Die Gesichtszüge sind fast hart zu nennen. Der Römer ist der geborene „fra commodo22)“, der Fragestellungen ausweicht oder sie erst dann erledigt, wenn sie nicht mehr zeitgemäß sind und eine Verurteilung oder positive Einstellung der Weltkirche niemand mehr besonders aufregt. Das bekannte Wort „Roma lavora con piedi di piombo23)“ erklärt sich aus dieser römischen Vorliebe für ein ruhig dahinfließendes Leben. Der Rhythmus der Arbeit und der Dynamismus des Nordmenschen mit seiner Faustischen Unruhe liegen ihm nicht. Er will nicht überall „Ordnung machen“, kennt nicht den Fanatismus für die Wahrheit und nimmt deshalb auch vieles im Leben nicht tragisch. So bildet er das statische Element innerhalb der Weltkirche, das aber für eine so große, nur auf dem Glauben und ohne äußere Machtmittel aufgebaute religiöse Organisation eine Notwendigkeit ist. Pius XI. ist aus einem anderen Holze geschnitzt. Kühl und nüchtern, eine geborene Herrschernatur. Ein Mann mit Linie, Kirchenfürst durch und durch. Der Norditaliener mit der Tiara, der den Besucher trotz aller väterlichen Güte seine hohe Stellung fühlen läßt. Ein ragender Fels im Toben der Zeitgeschichte, kein Opportunist oder Diplomat im Sinne Talleyrands. Gegenüber dieser Säkularerscheinung machte der übrige Hofstaat einen wenig bedeutenden Eindruck. Die Frage dreht sich bald um meine Heimat, um Österreich. Ich hörte aus den Worten des Papstes viel Sympathie und spürte Wärme. Er war geboren, als Österreich noch Mailand besetzt hatte. Seine Verwandten standen im Dienste der alten Habsburgermonarchie. Die Namen Kardinal Geysruck, Erzbischof von Mailand, dessen Ernennung Wien nur mit Drohungen beim Vatikan durchgesetzt hatte, und Feldmarschall Radetzky bedeuten für ihn als Italiener Josefinismus, Knechtung und Fremdherrschaft. Er scheint aber das jetzige Österreich zu schätzen, das klein und machtlos geworden ist. Das Gespräch ging bald auf deutsche Belange über. Er sprach voll Bewunderung über deutsche Arbeit und Wissenschaft, nachdem er als Gelehrter so oft die Bibliotheken Deutschlands, Österreichs und Böhmens besucht hatte, und von der Genauigkeit und Disziplin des deutschen Menschen. Deutschland werde sich wieder aus der Katastrophe herausarbeiten. Dann zeigte er mir einen langen, vom Reichspräsidenten Hindenburg an ihn gerichteten Brief mit dem Dank der deutschen Regierung für alles, was der Vatikan nach dem Kriege auf karitativem Gebiete getan hatte. „Welche Persönlichkeit!“, rief er aus, als er die machtvolle Unterschrift des Generalfeldmarschalls betrachtete. Vielleicht liebt er Deutschland in seiner Not und Verdemütigung, ob auch in Glanz und außenpolitischer Größe, wenn es einmal national erwachen sollte? Ich konnte den Gedanken nicht loswerden, daß er Deutschland mehr bewunderte, als sich ihm seelisch nahe fühlte. Ich erinnerte ihn daran, den Namen „Achille Ratti, Prefetto della Biblioteca Ambrosiana“ eingetragen gefunden zu haben in der Bibliothek des Prämonstratenserklosters Strahov bei Prag und in einem ärmlichen Pfarrhaus des Ennstals, in dem er vor seiner Bergpartie auf den Dachstein in der Steiermark übernachtet hatte. Diese Audienz umfaßte kostbare Augenblicke, die mir unvergeßlich sind. Die Kirche hat in Pius XI. einen großen Führer erhalten, auch wenn die Wellen der Zeit den kleinen Kahn stürmisch emporhoben. Er ist mehr als jener „dolce Cristo in terra24)“, von dem italienische Zeitungen in einem eigenartigen Byzantinismus mit Catherina von Siena sprechen. Er ist eine durchaus männliche Erscheinung. Er weiß, was er will, und ist sich seiner Würde, aber auch des Bleigewichtes seiner Verantwortung in dieser Zeitenwende ganz bewußt. Er ist leidenschaftlich bemüht, das Ansehen des Vatikans zu mehren und dem Papsttum den Anschluß an die große Weltpolitik im Interesse der Weltkirche zu sichern. Mit tiefem Dank für die erste Audienz verließ ich von seinem apostolischen Segen beglückt sein Arbeitszimmer. Nur Pius XI. galten meine Gedanken. Alles andere ist Alltag und Schatten, der sich an die Sonne drängt. Die Eindrücke lassen mich nicht mehr zur Ruhe kommen. Dieser Papst mit seinen bald siebzig Jahren ist noch relativ jung zu nennen, trotz des langen Lebens eine unverbrauchte Kraft. Möge ihm in heiliger Eingebung die Gnade geschenkt werden, die Kirche aus der Vergangenheit zu einer glücklichen Synthese von Religion und nationalem Denken zu führen, wie es Millionen von Europäern heute wünschen. Unendlich groß ist seine Verantwortung. Er ist ein Märtyrer seiner Stellung, der erste Kreuzträger der Welt, darin wirklich der Vicarius Christi, umgeben von Rivalitäten der Staaten, Nationen und verschiedenen theologischen Richtungen innerhalb der Kirche. Wenn man die Bilder der Renaissancepäpste mit jenen des 20. Jahrhunderts vergleicht, welch ein Unterschied schon allein im Gesichtsausdruck einer milden Schwermut, die sich der Gefahren und Schattenseiten unserer Zeit, besonders des Niederganges des verinnerlichten religiösen Lebens, bewußt ist. „Oremus pro Pontifice nostro25)!“
5) „ein entwaffneter Prophet“
6) „leben und (andere) leben lassen“
7) „klerikale Eifersucht“ (Streberei)
8) „Vor allem nie zuviel Eifer“
9) „Das Leben für die Wahrheit einsetzen“
10) „Besser gewesen wäre: weniger Wahrheit und mehr Liebe“
10a) „Stadt auf dem Berge“
11) „Volkesstimme ist Gottes Stimme“
11a) das „Arangierene, Kombinieren und Hinausschieben“
11b) „(den Dingen) auf den Grund gehen“
12) „Mit Merry del Val ist’s nicht weit her“
12a) Arbeiter priester
13) „Kardinäle sind gleich unnützen Fieunden und präpotenten Feinden“
*) Österreichischer Diplomat in Paris und Rom.
14) „Die Diplomatie ist meines Erachtens das Allerüberftüssigste! Die Botschafter sind nichts anderes als Spione, dazu da, um in den Vorzimmern zu lauschen. So etwas mochte früher einmal einen Sinn gehabt haben; aber wozu dient jetzt, da es die Presse gibt, noch ein Botschafter? Um eine Ohrfeige zu bekommen wie Hübner oder wie Barrili, um — am Vorabend der Vertreibung der (spanischen) Königin — zu versichern, in Spanien sei alles in Ordnung?
15) „die eigene Haut in Sicherheit bringen“
16) „der Unfähigkeit des Klerus und der Fähigkeit der Laien“ (nachhelfen zu können)
17) „Hier wird die Politik gemacht“
18) „Diese sind dazu fähig (wenn es opportun ist), ihr eigenes Hemd zu verschachern“
10a) »(das) Haus des gemeinsamen Vaters“
19) „‚heiligen‘ Opportunismus“
20) des „kleineren Übels“
21) „ein Schatten eines großen Namens“
22) „bequemer Bruder“
23) „In Rom geht man mit bleiernen Füßen voran“ (Hudal dürfte jedoch hier falsch zitiert haben. Das römische Volkssprichwort lautet nämlich: „A Roma si va avanti con piedi di piombo!“)
24) (jener) „süßer (gütiger) Christus auf Erden“
25) „Beten wir für unseren Papst!“