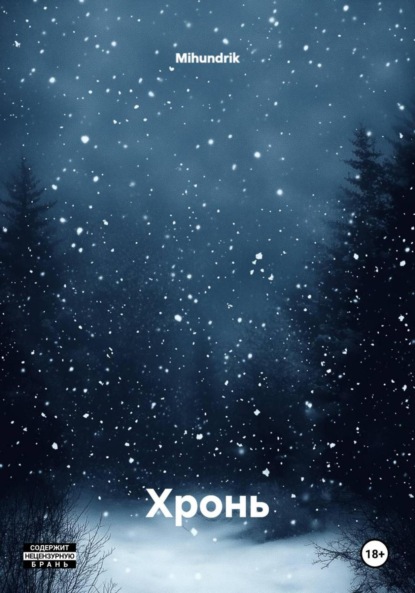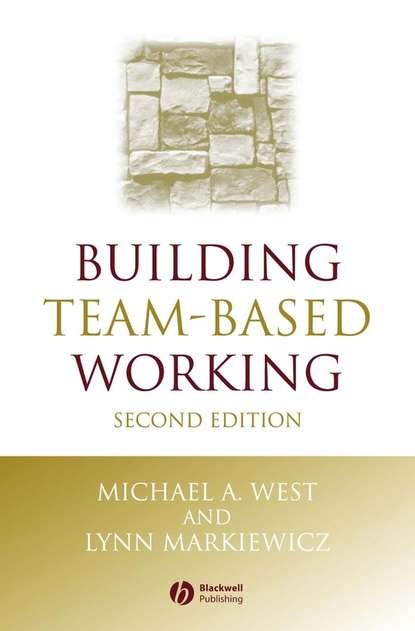- -
- 100%
- +
Ein Merkmal einer für alle gesunden zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen ist Gleichwürdigkeit. Der Begriff stammt vom dänischen Familientherapeuten und Autor Jesper Juul. Gemeint ist damit nicht Gleichheit von Groß und Klein. Es geht nicht darum, dass ein Kind in seinem Handeln die gleichen Rechte hat wie Lehrpersonen oder Eltern. Kinder brauchen situativ Grenzen, die ihnen Sicherheit und Geborgenheit geben, damit sie innerhalb dieses Rahmens fruchtbare Erfahrungen machen können. Unter Grenzen sind also nicht starre, von oben verordnete Gesetze oder Regeln zu verstehen. Gemeint ist damit der persönliche Ausdruck von in Beziehung stehenden Erwachsenen, die in der Lage sind, ihren Kindern empathisch zu begegnen und ihnen auch die eigenen Gefühle mitzuteilen. Gleichwürdigkeit ist durch eine Subjekt- Subjekt-, nicht aber durch eine Subjekt-Objekt-Relation gegeben.
Was sich seit einigen Jahren in vielen Familien und auch in Schulen vor allem zeigt, ist ein Beziehungsverhältnis von Erwachsenen und Kindern, das sich am ehesten als egozentrisches Nichbeziehungsverhältnis bezeichnen lässt. Noch vor fünfzig Jahren waren in unserer Gesellschaft patriarchalische Strukturen etabliert und unumstritten. Im öffentlichen Leben war der Pfarrer, Arzt und Lehrer, in der Familie der Vater, eine unangreifbare Autorität. Schulklassen wurden mit vierzig und mehr Kindern geführt, nach deren persönlichen Bedürfnissen fragte niemand. Begriffe wie Heterogenität oder Individualisierung existierten nicht. Soziologie, Psychologie, Pädagogik und andere wissenschaftliche Disziplinen trugen und tragen zu einem durch konstruktivistisches Denken, durch Gender und neuerdings auch Diversity Studies geprägten gesellschaftlichen Wandel bei. Es brechen traditionelle Muster auf, was etwa in Bezug auf Geschlechterrollen und Familienbilder am augenscheinlichsten ist. Das bringt ungezählte neue Möglichkeiten für alle, handkehrum aber auch viele Unsicherheiten mit sich, gerade auch in Erziehungsfragen. Eltern von heute sind selber in der postantiautoritären Zeit nach den 60er-Jahren aufgewachsen. Sie haben alle nur denkbaren und undenkbaren Erziehungsstile erfahren und experimentieren unter Umständen wild weiter. Es mangelt mitunter an Richtung und Klarheit, die Kinder dringend brauchen würden. Insbesondere in der Autonomie- oder Ich-Entwicklungsphase im Alter von zwei bis fünf Jahren (früher als Trotzphase bezeichnet) ist es wichtig, dass ein erwachsenes Gegenüber da ist, das sich mit seiner ganzen Persönlichkeit authentisch und klar zeigt. Wenn dieses fehlt, kann sich der Blick der Kinder auf sich selbst verzerren. Sie werden egozentrisch, entwickeln vielleicht ein Allmachtsgefühl und haben später möglicherweise Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse zurückzustellen – was eine gleichwürdige Beziehung zwischen Kindern respektive Jugendlichen und den Eltern trotz aller Bemühungen verunmöglicht. Dieses Phänomen ist immer häufiger in Familien mit sogenannten «Helikoptereltern» zu erkennen, wenn meist Mütter – weil die Väter oft abwesend sind – ihr eigenes Leben vergessen und stattdessen das Leben ihrer Kinder zu ihrem eigenen Projekt machen. Dasselbe gilt für die Beziehungskultur an Schulen. Bei den ganzen Anstrengungen um Individualisierung darf die Fähigkeit, sich zugunsten gemeinsamer Interessen auch unterzuordnen, nicht vergessen gehen. Nur wenn Kinder und Jugendliche wie Lehrpersonen zu sozialem und selbstverantwortlichem Handeln fähig sind, ist eine dialogische oder eben gleichwürdige Beziehungskultur möglich – und damit ein Lernprozess, der den Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes gerecht wird.
Zu den Vorbildern, an denen sich Kinder orientieren können, gehören Lehrpersonen, die gerne unterrichten. Denn nur wenn Begeisterung überhaupt da ist, kann der Funke auf die Kinder überspringen. Wenn es einer Lehrperson gelingt, auf allen Stufen Kinder und Jugendliche fürs Singen zu begeistern, jedoch kaum ein Kind fürs Zeichnen, ist das keine Aussage über die Lernmoral der Kinder und keine über Sinn oder Unsinn der beiden Fächer, sondern lediglich eine über die Lehrperson selbst. Wenn Schülerinnen und Schüler in einem Fach schlechte Noten, nach einem Lehrerwechsel aber plötzlich gute schreiben, so zeigt dies, wie wichtig die Überzeugung einer Lehrperson, ihre Begeisterung für die Sache sowie über ihre Unterrichtsqualität für den Lernerfolg sind (wobei dieser ja nicht unbedingt an Noten gemessen wird). Angehende Lehrpersonen, die später an einer demokratischen Schule arbeiten möchten, durchlaufen in Israel, der Hochburg dieser Bewegung, am «Institute for Democratic Education» in Tel Aviv, ein erstes Ausbildungsjahr, während dem ihre eigene Persönlichkeit im Zentrum steht. Es geht darum, herauszufinden, was sie wirklich gut können und gerne machen. Im zweiten Ausbildungsjahr steht dann die Frage im Zentrum, wie sie dies in Bezug zu den Kindern bringen können.
Kinder lernen in sozialen Kontexten. Ab Geburt bringen sie einen Überschuss an Hirnzellen mit in ihr Leben. Dies hat die Natur so eingerichtet, damit jedes Neugeborene an jedem Ort dieser Welt in jeder möglichen Lebensgemeinschaft aufwachsen kann. Im Verlauf seines Aufwachsens verknüpfen sich jene Hirnzellen, die aktiviert und gebraucht werden, wenn der Mensch in seinem Umfeld und mit dem eigenen Körper bestimmte Erfahrungen macht. Anlagen, die nicht gebraucht werden, bilden sich zurück. So bekommt jedes Kind sein optimales Gehirn, das es in seiner äußeren und inneren Erfahrungswelt benötigt.[2] Wer im Amazonas aufwächst, kann über hundert verschiedene Grüntöne erkennen. Inuits lernen, viele verschiedene Beschaffenheiten von Schnee zu bestimmen. In unseren Breitengraden sind dies unnütze Informationen und Fähigkeiten, also verfügen wir nicht darüber. In diesem Zusammenhang ist es für die Schule bedeutsam zu wissen, dass der Mensch den Großteil aller Fertigkeiten und Fähigkeiten – man spricht von zwei Dritteln – außerhalb der Schule erwirbt. Dies haben die Erziehungswissenschaftler Andreas Helmke und Franz Emanuel Weinert 1997 in einer viel beachteten Studie festgehalten. [3] Die Schule hat keinen Einfluss auf den Kompetenzerwerb in den ersten vier, fünf Lebensjahren, nach der Einschulung nur einen ziemlich beschränkten. Das Hirn eines Fünfjährigen entspricht in seiner Struktur den Anforderungen seines unmittelbaren Umfelds, zu dem die Schule in den ersten Lebensjahren nicht zählt. Also ist es auch nicht darauf zugeschnitten. Deshalb muss es vordringliche Entwicklungsarbeit an Schulen sein, das Umfeld der Schülerinnen und Schüler in die Bildungsbemühungen miteinzubeziehen. Wichtigste Ansprechgruppe sind diesbezüglich Eltern der Kinder aus bildungsfernen und kulturell anders ausgerichteten Familien.
Aus den Erfahrungen im Mutterleib – der engsten Verbindung zur Mutter, also zu einem anderen Menschen, sowie der rasanten Entwicklung seines eigenen Körpers, den das Kind zunehmend koordinierter gebrauchen und erleben kann – bringt der Mensch zwei Grundbedürfnisse mit auf die Welt; er hat das angeborene Bedürfnis nach Geborgenheit und nach autonomer Persönlichkeitsentwicklung. Weil sich die beiden Bedürfnisse gegenseitig bedingen, kann ein Kind unmöglich erfolgreich lernen, wenn es sich nicht in der Familien- oder Klassengemeinschaft aufgehoben und seiner selbst wert fühlt.
Erfahren Kinder und Jugendliche auf Dauer diese Geborgenheit nicht oder können sie die an sie gestellten Aufgaben regelmäßig nicht bewältigen, verlieren sie ihren Selbstwert und die Freude am Lernen; sie sind in ihrer Integrität verletzt. Ist das einmal geschehen, wird es sehr schwierig, Kindern erfolgreich zu vermitteln, dass sie etwas können oder wertvoll sind. Ihre Reaktion folgt nach einem von drei möglichen Mustern: Sie greifen an, sie flüchten oder sie erstarren. Dies sind die abrufbaren Notfallprogramme unseres Hirnstamms, wenn wir uns bedroht fühlen. Angriff ist in der Schule selten eine erfolgreiche Wahl. Allenfalls zeigt sich das Muster in Unruhe während des Unterrichts, in Pausenschlägereien, Sachbeschädigungen oder – oft bei Mädchen in der Pubertät – Selbstverletzungen. Flucht ist im Rahmen der Schulpflicht ebenso wenig möglich. Möglich ist mentales Abhauen in Form von Tagträumerei und Unkonzentriertheit. Besonders bedrohlich ist die Erstarrung; Kinder werden apathisch, mitunter depressiv und sogar suizidal.
Es gibt die Kinder und Jugendlichen, die sich problemlos in den Schulbetrieb einfügen und auf bereichernde Art auch einbringen. Und dann gibt es die Antischülerinnen und -schüler, die oft nicht weniger intelligent sind, sich aber viel schlechter anpassen können und negativ auffallen. Nun gibt es die Möglichkeit, sie mittels Bestrafung oder Belohnung anzutreiben, wie es ein Eseltreiber mit seinem störrischen Tier macht. Vielleicht bewegt sich das Kind so tatsächlich in die gewünschte Richtung, aber sicher nicht aus eigenem Antrieb. Fremdführung und Gehorsam führen nicht zu Eigenverantwortung, Kreativität, leidenschaftlichem Handeln und dazu, dass sich Schülerinnen und Schüler aufgehoben fühlen. Das Ziel muss ein hohes Maß an Innenorientierung und Selbstführung respektive -disziplin sein. Gelingen kann dies, wenn die Haltung der Lehrperson stimmt; wenn es ihr gelingt, eine dialogische Beziehungskultur zu etablieren, in der ein aufrichtiges Interesse und darauf aufbauendes gegenseitiges Vertrauen die Grundlage ist. Dies ist eine Voraussetzung für kompetenzorientiertes Lehren und Lernen.

Abb. 4: Führungsmethoden

Das Gelingen von Lernprozessen hängt, wie wir seit der als Hattie-Studie berühmt gewordenen Schrift des neuseeländischen Pädagogen John Hattie aus dem Jahr 2009 wissen, in hohem Maße von den Schülerinnen und Schülern, ihrer Herkunft und Disposition, aber maßgeblich auch von der Lehrperson ab: von ihrem Bildungsverständnis, von ihrer Haltung dem Lernen und Lehren gegenüber, von ihrem Rollenverständnis und von der Ausgestaltung ihrer Beziehung zu Schülerinnen und Schülern. Darauf ist Bildungserfolg vor allem zurückzuführen, weniger auf die Unterrichtsmethoden. Mit Bildungserfolg ist nicht Schulerfolg – sprich gute Noten und Zeugnisse – gemeint, sondern die Erhaltung der Neugierde auch über die Schule hinaus, Handlungsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein im Berufs- und Lebensalltag. Oder anders gesagt: der Erwerb von Kompetenzen im personalen, sozialen, fachspezifischen, methodischen Handlungsbereich. Lehrerinnen und Lehrer müssen dafür eine andere Rolle einnehmen können: Sie sind nicht mehr nur Dozierende – weil sich Kompetenzen ja nicht vermitteln lassen –, sondern vielmehr Lernbegleiter oder Coaches. Natürlich bedarf es bestimmter Methodik und Didaktik, um diese Rolle auszugestalten. Dazu und zum eigentlichen Kompetenzbegriff mehr in den Folgekapiteln. Vorerst geht es lediglich um das Rollenverständnis von Lehrpersonen, ums Umdenken, um die Haltung.
So, wie kleine Kinder das Gehen lernen, indem sie hinfallen, selber wieder aufstehen, Schritte machen, wieder hinfallen, aufstehen und es von vorne versuchen, müssen auch Schulkinder und Jugendliche selber Erfahrungen sammeln und Fehler machen können, um neue Herausforderungen zu meistern und persönliche Erfolge zu erleben. Die Eltern können ihrem Kleinkind das Gehen nicht aktiv beibringen, ihm aber anteilnehmend und präsent zur Seite stehen, wenn es dazu reif ist. Genau das können und müssen Lehrpersonen für ihre Schülerinnen und Schüler tun, wenn diese kompetenzorientiert lernen sollen. Es geht nicht darum, ihnen Schritt für Schritt voranzugehen, den Weg vorzuspuren und Entscheidungen abzunehmen, aber auch nicht darum, sie auf ihrem Weg sich selbst zu überlassen. Richtig wäre es, sie zu begleiten. Erfolgreiche Lernprozesse werden durch eine Haltung der Lehrperson stark begünstigt, die präsent, achtsam und wohlwollend ist. Spürbares Vertrauen in die Schülerinnen und Schüler ermutigt diese zu selbstständigem Handeln, macht sie zuversichtlich, selber etwas erreichen zu können. Kinder brauchen Erwachsene, die an sie glauben und ihnen etwas zutrauen. Das Wissen darum, dass ihre Lehrerin oder ihr Lehrer Fehler nicht als Versagen, sondern als Erfahrung abbucht, bewirkt, dass Kinder und Jugendliche ihre inneren Impulse und eigenen Ideen wahrnehmen, danach handeln und weniger durch das Erfüllen von äußeren Vorstellungen und Vorgaben gelenkt sind.
Kommt ein Kind in einer bestimmten Situation trotz größter Bemühung nicht so weit, wie es gern möchte, helfen ihm Forderung, Moral, Belehrung und Bewertung wenig. Es verschließt sich und tritt weiter an Ort. Wenn sich die Lehrperson aufrichtig dafür interessiert, wie es ihren Schülerinnen und Schülern geht, wenn sie an die Kinder und Jugendlichen herankommen und sie bewegen möchte, muss sie ihre Entscheidungen und Gedanken möglicherweise als das Beste akzeptieren, was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt und unter gegebenen Umständen leisten können – auch wenn aus ihrer Sicht womöglich viel mehr Potenzial da wäre. Die Aufgabe der Lehrperson besteht darin, eine Vertrauensbasis zu schaffen, individuelle Leistung zu erkennen und zusammen mit dem Kind dessen Potenzial zu entfalten, es durch Begleitung und Ermunterung so weit zu bringen, dass es selber einen nächsten Schritt wagt.
Ein bewährtes Instrument sind regelmäßige Coachinggespräche, wobei ein angemessener und realisierbarer Rhythmus gefunden werden muss. Möglich ist beispielsweise die Etablierung eines Einzelgespräches pro Schultag. Während einer Phase der selbstständigen Arbeit trifft sich die Lehrperson für fünf bis zehn Minuten mit einem Schüler oder einer Schülerin zu einem persönlichen Gespräch. Bei einer Klassengröße von zwanzig Kindern kommt jedes monatlich zu einem solchen kurzen Reflexionsgespräch.
Die Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern ist dann erfolgreich, wenn die Lehrperson merkt, dass sie das Kind erreicht, wenn es sich ihr gegenüber öffnet und Vertrauen fasst. Das Kind seinerseits ist frei von Ängsten und erlebt seinen Lehrer oder seine Lehrerin nicht als jemand, der oder die ausschließlich für die Wissensvermittlung da ist und über seine Leistungen und sein Verhalten richtet. Es braucht eine freundschaftliche Begleitung, jemanden, der oder die sich aufrichtig für das Kind interessiert – nicht für die Zeugnisse, nicht für seine Eltern, nicht für das eigene Ansehen und Erfolgsgefühl als Lehrperson. Lehrpersonen müssen und sollen sich nicht zum Kumpel ihrer Schülerinnen und Schüler machen. Aber sie sollen ihnen freundlich, freundschaftlich und vertrauensvoll zugewandt sein.
Der Verlauf eines persönlichen Coachinggesprächs kann nach folgender Struktur ablaufen:
Befindlichkeit klären
–Wie geht es dir? Was macht dir Spaß, was Sorgen?
–Bist du zufrieden mit dir, mit der Schule, mit dem, was du in der Schule machst? Wie geht es dir mit den anderen Kindern, Lehrern, zu Hause mit deiner Arbeit?
–Was brauchst du? Wie können wir dich unterstützen?
Von wem möchtest du Unterstützung? Wie willst du unterstützt werden?
An das letzte Gespräch anknüpfen
–Was waren die Anliegen, Wünsche, Ziele, Probleme beim letzten Gespräch? Wie haben sich diese entwickelt?
–Konntest du deine Wünsche erfüllen, deine Ziele erreichen, Zielsetzungsvereinbarung einhalten? Wenn nein, was hat dich daran gehindert?
Weiter sehen
–Gibt es Handlungsbedarf für die nächste Phase?
Was möchtest du anpacken, erreichen, was ändern?
–Was ist dir wichtig in nächster Zeit? In Bezug auf dich selber, mit anderen Kinder, mit den Lehrern, mit dem Lernen, mit Projekten?
–Gibt es Bereiche, wo du mehr Verantwortung für dich übernehmen möchtest?
–Was sind meine Anliegen und Themen, die ich als Lehrperson ansprechen möchte?
Raum für Unerwartetes und Unerfragtes lassen
–Gibt es etwas, was dir noch wichtig ist, mir mitzuteilen?
–Weiter können Lehrpersonen wichtige Dinge aufschreiben, die als Erinnerung für das nächste Coachinggespräch wichtig sind oder die sie selber zu erledigen haben.
Regelmäßige Coachinggespräche leiten die Kinder und Jugendlichen in Selbstreflexion an und steigern ihre Fähigkeit zur Selbstführung. Sie bringen Lehrperson wie Schülerinnen und Schüler weiter im gemeinsamen Lehr- und Lernprozess als das Konzept von Belohnung und Bestrafung. Es entwickeln sich nicht Gehorsam und übersteigerte Außenorientierung, sondern viel eher Selbstdisziplin und darauf aufbauend zahlreiche Schlüsselkompetenzen, idealerweise wie von selbst. Eine Gesetzmäßigkeit in Gesprächen mit Kindern ist die: Kommen Lehrpersonen (auch Eltern zu Hause) mit Vorstellungen, moralischen Ansprüchen und Erwartungshaltung, die keinerlei Spielraum für andere Sichtweisen zulassen, auf das Kind zu, wird es das sagen, was die Erwachsenen hören wollen, um so möglichst schnell der Moralpredigt zu entkommen. Das lässt sich nur vermeiden, wenn die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern den nötigen angstfreien Raum gewährt, in dem sie sich frei äußern können, ohne dafür verurteilt zu werden.
Im Zusammenhang mit Haltungsfragen, Coaching und angemessener Kommunikation erläutert Jesper Juul in seinen Büchern, was unter gleichwürdiger Beziehungsgestaltung gemeint ist. Der lösungsorientierte Ansatz nach Steve de Shazer liefert einen riesigen Fundus an Ideen, Know-how und Weiterbildungsangeboten für Lehrpersonen und auch Eltern. Der Psychotherapeut entwickelte eine Kurztherapieform, die sich nicht an der Entstehung statuierter Probleme, sondern an deren Lösung orientiert. Im Zentrum steht das Gespräch. Die Methode wird an Schulen und besonders auch innerhalb der Schulsozialarbeit erfolgreich angewandt. Ausgegangen wird von einer Grundannahme und sieben darauf basierenden lösungsorientierten Annahmen:
Grundannahme:
Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen.
Die sieben lösungsorientierten Annahmen:
1Probleme sind Herausforderungen, die jeder Mensch auf seine persönliche Art zu bewältigen sucht.
2Wir gehen davon aus, dass alle Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben wollen und dass die nötigen Ressourcen dazu vorhanden sind. In eigener Sache sind wir alle kundig und kompetent.
3Es ist hilfreich und nützlich, dem Gegenüber sorgfältig zuzuhören und ernst zu nehmen, was er/sie sagt.
4Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten orientierst, findest du eher einen Weg.
5Nichts ist immer gleich, Ausnahmen deuten auf Lösungen hin.
6Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt.
7Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch.[4]


«Kompetenz» ist im Bildungsbereich zu einem inflationären Begriff geworden. Alle brauchen ihn, aber selten ist klar, wovon dabei eigentlich genau die Rede ist. Dies hat zum einen damit zu tun, dass der Begriff im alltäglichen Sprachgebrauch nicht gleich verwendet wird wie im Zusammenhang mit Schulentwicklung. Zum anderen existieren auch innerhalb dieses Bereichs unterschiedliche Auffassungen von Kompetenz.
Das diesem Buch zugrunde liegende Kompetenzverständnis folgt den Erkenntnissen von John Erpenbeck und Volker Heyse, die in der Kompetenzforschung richtunggebend sind, sowie der Definition des Entwicklungspsychologen Franz Weinert von 2011:
«Kompetenzen sind bei Individuen verfügbare oder durch sie erlernbare kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen [die willentliche Steuerung von Handlungen und Handlungsabsichten] und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.» [5]
Zentral für dieses Verständnis von Kompetenz ist deren Entwicklung, damit beschäftigen sich Erpenbeck und Heyse in erster Linie. Sie gehen davon aus, dass
«Kompetenzen von Wissen fundiert, durch Werte konstituiert, als Fähigkeiten disponiert, durch Erfahrungen konsolidiert, aufgrund von Willen realisiert werden.»[6]
Beide Definitionen bringen im Zusammenhang mit Bildung weitere Begriffe ins Spiel, die für das Verständnis von Kompetenz zentral, aber auf keinen Fall damit gleichzusetzen sind: FERTIGKEITEN, fachspezifische und nicht fachspezifische FÄHIGKEITEN, PERFORMANZ.
Eine einzelne fachbezogene FÄHIGKEIT bezieht sich auf fachliche Kenntnisse und damit auf spezifisches Wissen, das mit standardisierten Verfahren überprüft werden kann, was zur Qualifikation dieses Wissens führt. Wissen über die Struktur eines formalen Briefes gilt beispielsweise als solches Fachwissen. Von einer fachspezifischen FÄHIGKEIT kann hier gesprochen werden, wenn ein solcher Brief exakt seiner vorgegebenen Struktur gemäß zu Papier gebracht werden kann, wozu gewisse schreibmotorische FERTIGKEITEN notwendig sind. Eine nicht fachspezifische FÄHIGKEIT ist zugleich eine KOMPETENZ, wenn damit angewandtes Handeln in einer beliebigen herausfordernden Situation gemeint ist. Eine solche KOMPETENZ hat entwickelt und sich angeeignet, wer im Rahmen einer solchen Situation wie beispielsweise der Stellensuche einen Bewerbungsbrief schreiben kann. PERFORMANZ ist die Handlung in einer derartigen Situation an und für sich, also eine aus einer Entscheidungsfindung folgende Handlung, in der KOMPETENZ sichtbar wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kompetenz
–nie eine isolierte fachspezifische Fähigkeit oder Fertigkeit, sondern immer eine koordinierte Verbindung verschiedener personaler, sozialer, fachlicher, methodischer und handlungsbezogener Aspekte zu einer ganzen Handlung ist,
–nicht mit reinem Wissen gleichgesetzt werden kann, aber durch Wissen fundiert wird,
–immer nur hypothetisch vorhanden ist, sich erst in der Performanz, das heißt in sichtbarer Handlung zeigt und gemessen respektive beurteilt werden kann.
4.1
Kompetenzmodelle
Unsere Schulen sind darauf spezialisiert, Wissen zu vermitteln. Damit ist Wissen im engeren Sinn gemeint, das heißt fachbezogene Fähigkeiten, wie z.B. die Kommaregeln kennen, zu wissen, wie Wiederkäuermägen funktionieren oder wie man Zahlen schriftlich addiert. Sie kanonisieren, strukturieren und formalisieren Wissen fürs Volk, wie es eben der Auftrag der Volksschule von jeher ist. Sie entwickelte sich auf der Grundlage der religiösen Unterweisung, wobei es in erster Linie darum ging, jedem Kind den Katechismus einzutrichtern, um ihn abfragen zu können. So werden traditionellerweise bis heute Wissensinhalte didaktisch aufbereitet und nach erprobten Methoden vermittelt. Diese traditionelle und in der Gesellschaft verankerte Idee von Schule läuft der pädagogischen (und mittels Lehr- oder Bildungsplänen amtlich verordneten) eigentlich zuwider. Dennoch wäre es falsch zu glauben, Wissensvermittlung schließe kompetenzorientiertes Lehren (und Lernen) aus. Mit der richtigen Haltung und Methodik ist es möglich, Wissen mit überfachlichen und persönlichen Kompetenzen zu verbinden. Nach dem hier postulierten Kompetenzverständnis bildet Wissen die Grundlage für die Kompetenzentwicklung.
Unser Schulkonzept sieht vor, dass Wissenserwerb gemessen und bewertet wird. Schülerinnen und Schüler werden in standardisierten Verfahren qualifiziert, also benotet und, seltener, in Worten beurteilt. Im Bereich der Berufsbildung sind Qualifikationen oft gleichbedeutend mit Diplomen oder Zertifikaten. Nun ist aber gut qualifiziert nicht zwingend gleichbedeutend mit kompetent. Wissen, Qualifikation und Kompetenz stehen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. In welchem, verdeutlicht folgende Grafik von Erpenbeck und Heyse: