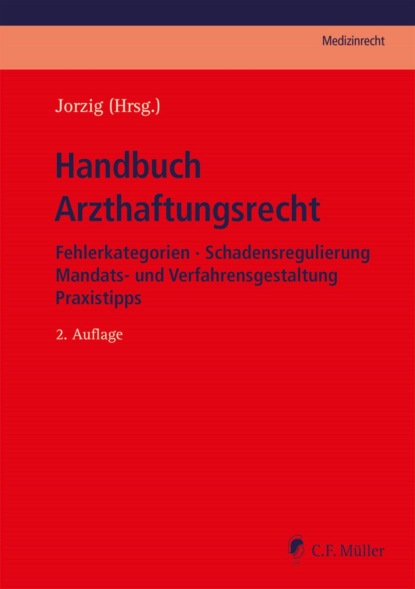- -
- 100%
- +
III. Mitverschulden
105
Das oben genannte Prinzip der Totalreparation kann durch die Norm des § 254 BGB durchbrochen werden und erlaubt eine Schadensabwägung. Die Haftung des Arztes kann sich im Einzelfall mindern oder ganz entfallen, wenn den Patienten an der Entstehung oder am Umfang des Schadens ein Mitverschulden trifft.[203] „Ein solches Mitverschulden liegt vor, wenn der Patient diejenige Sorgfalt außer Acht gelassen hat, die ein ordentlicher und verständiger Mensch zur Vermeidung eigenen Schadens anzuwenden pflegt.“[204] Ein Mitverschulden bei der Schadensentstehung gemäß § 254 Abs. 1 BGB kommt beispielsweise in Betracht, wenn der Patient es unterlassen hat, den Arzt auf besondere, für die Behandlung wesentliche und ihm bekannte Umstände hinzuweisen und diese für den Schaden ursächlich sind[205], der Patient den ärztlichen Hinweis auf die Notwendigkeit einer Kontrolluntersuchung nicht beachtet[206], die ärztlichen Therapie- und Kontrollanweisungen nicht befolgt[207] oder die ihm obliegende Mitwirkung an den Heilungsbemühungen unterlässt[208].
106
Die bisherige außerordentlich zurückhaltende Rechtsprechung bei der Feststellung eines Mitverschuldens des Patienten, weil die Expertenkenntnis der Ärzte überwiege[209], scheint im Rückzug begriffen. Das OLG Frankfurt entschied, dass die Arztseite bei absprachewidriger Entfernung aus Krankenhaus nicht haftet[210].
I. Allgemeines
107
Im Überblick und ohne Berücksichtigung der vielfältigen Einzelprobleme sollen noch die spezialgesetzlichen Regelungen des AMG, MPG, und des OEG vorgestellt werden.
108
In Bezug auf die Arznei- und die Medizinproduktehaftung sei dabei explizit darauf hingewiesen, dass es sich um eine Haftung für fehlerhafte Produkte handelt. Diese Art der Produkthaftung, für die der pharmazeutische Unternehmer bzw. der Hersteller des Medizinproduktes, einzustehen hat, ist von der Haftung des Arztes zu unterscheiden, der das Arzneimittel oder das Medizinprodukt anwendet. Der Arzt haftet, ohne das weitere Umstände i.S. eines eigenen Fehlverhaltens hinzutreten, nicht für die Anwendung des fehlerhaften Arzneimittels oder Medizinproduktes. Haftet der Arzt selbst, so kommt immer eine gesamtschuldnerische Haftung mit dem Arzneimittelhersteller oder dem Medizinproduktehersteller in Betracht[211].
II. Haftung nach dem Arzneimittelgesetz (AMG)
109
Vgl. hierzu auch 1. Teil, 3. Kap., Rn. 498.
110
Neben einer zivilrechtlichen Haftung[212] kommt eine Haftung für Schäden im Kontext mit der Anwendung von Arzneimitteln aufgrund der des § 84 AMG in Betracht. In § 84 Abs. 1 S. 1 AMG werden dabei die grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Haftung des pharmazeutischen Unternehmers aufgestellt. Abs. 1 S. 2 stellt in seinen Nummern 1 und 2 weitere zusätzliche – zueinander alternative – Haftungsvoraussetzungen auf. Durch den Abs. 2 wird dem Anspruchsteller der Kausalitätsnachweis, durch die Schaffung einer Kausalitätsvermutung, deren Voraussetzungen in einem Regel-Ausnahme-Verhältnis formuliert wurden, erleichtert. Nach Abs. 3 ist ein Ausschluss der Haftung für die Fälle vorgesehen, in denen die schädliche Wirkung des betreffenden Arzneimittels ihre Ursache nicht im Bereich der Herstellung bzw. Entwicklung hatte.[213]
111
Haftungsobjekt des § 84 AMG sind Humanarzneimittel, welche einer inländischen Zulassungspflicht unterliegen (bzw. von dieser freigestellt wurden), deren Abgabeort im Inland liegt und die inländisch in Verkehr gebracht wurden.
112
Unbedingte Voraussetzung für die Haftung nach § 84 AMG ist die Abgabe des Arzneimittels an einen Verbraucher. Darunter wird derjenige verstanden, an den das Arzneimittel in der Apotheke oder Abgabestelle zur Anwendung ausgehändigt wird. Darauf, dass der das Arzneimittel entgegennehmende Verbraucher dieses selbst anwendet, kommt es nicht an. Verbraucher sind somit auch diejenigen Personen, die das Arzneimittel für einen anderen erwerben.[214]
113
Infolge der Anwendung des Arzneimittels (Kausalitätserfordernis[215] i.S. einer generellen und konkreten Schadenseignung[216]) muss es zu einer Rechtsgutsverletzung der abschließend[217] aufgezählten Rechtsgüter Leben, Körper oder Gesundheit gekommen sein. Zudem muss die Gesundheitsbeeinträchtigung gerade auf der „Fehlerhaftigkeit“ des Arzneimittels beruhen, wobei sich diese Fehlerhaftigkeit aus § 84 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und Nr. 2 AMG ergibt.[218]
114
Die Kausalitätsvermutung des § 84 Abs. 2 AMG stellt ein verschachteltes Regel-Ausnahme-System dar: Nach Abs. 2 S. 1 muss der Geschädigte darlegen und beweisen, dass das Arzneimittel nach den Umständen des Einzelfalls geeignet ist, den Schaden zu verursachen. Gelingt der Nachweis der konkreten Schadenseignung, wird die Kausalität vermutet. Abs. 2 S. 2 nennt beispielhaft einzelne Umstände, nach denen sich die Schadenseignung beurteilt und fügt schließlich noch einen generalklauselartigen Auffangtatbestand („allen sonstigen Gegebenheiten“) hinzu. Die Kausalitätsvermutung gilt nach Abs. 2 S. 3 nicht, wenn (mindestens) ein anderer Umstand ebenfalls geeignet ist, den Schaden zu verursachen. Die Kausalitätsvermutung ist dann nicht nur widerlegt; sie „gilt (erst gar) nicht. Abs. 2 S. 4 enthält eine Ausnahmeregelung für andere Arzneimittel, die den Schaden ebenfalls verursacht haben können.“[219]
115
Nach Abs. 3 ist die Ersatzpflicht ausgeschlossen, wenn nach den Umständen davon auszugehen ist, dass die schädlichen Wirkungen ihre Ursache nicht im Bereich der Herstellung oder Entwicklung haben.
116
Aktivlegitimiert sind sowohl die Person, die das Arzneimittel eingenommen hat, als auch Sekundärgeschädigte.[220] Passivlegitimiert ist der pharmazeutische Unternehmer (§ 4 Abs. 18 AMG), der das Arzneimittel in Verkehr gebracht (§ 4 Abs. 17 AMG) hat.
117
Der Geschädigte hat die Anwendung des Arzneimittels, die Rechtsgutverletzung, die Abgabe des Arzneimittels im Geltungsbereich des AMG sowie die Bestimmung des Arzneimittels als Humanarzneimittel zu beweisen. Der Beweis der haftungsbegründenden Kausalität wird für den Geschädigten über Abs. 2 erleichtert; wobei die Norm auch das Beweismaß zugunsten des Geschädigten herabsetzt. In Bezug auf Abs. 3 ist der pharmazeutische Unternehmer beweisbelastet.[221]
118
In Bezug auf Inhalt, Art und Umfang enthält das AMG in § 85 AMG eine Regelung zum Mitverschulden, welche auf § 254 BGB verweist, sowie mit § 86 AMG eine Norm zum Umfang der Ersatzpflicht bei Tötung, mit § 88 AMG eine solche zu den Haftungshöchstbeträgen und mit § 89 AMG zur Leistung von Schadensersatz durch eine Geldrente.
III. Haftung für Medizinprodukte
119
Vgl. hierzu auch 1. Teil, 3. Kap., Rn. 578 ff.
120
Das MPG selbst enthält keine haftungsrechtliche Anspruchsgrundlage. Das gilt auch für die Medizinprodukteverordnung (MDR), deren Inkrafttreten allerdings durch die Corona-Pandemie aufgeschoben wurde. Ansprüche gegen den Hersteller eines Medizinproduktes können sich aber aus dem ProdHaftG und aufgrund der Verschuldenshaftung nach dem BGB (Vertrags- und Deliktshaftung) ergeben.[222]
121
Da die zivilrechtliche Haftung bereits angesprochen wurde[223], soll an dieser Stelle nur auf die Haftung für Medizinprodukte nach dem ProdHaftG eingegangen werden.
122
Nach der Haftungsnorm des § 1 Abs. 1 ProdHaftG ist der Hersteller (§ 4 ProdHaftG) des Medizinproduktes (§ 2 ProdHaftG) verpflichtet, Schadensersatz zu leisten, wenn durch den Fehler (§ 3 ProdHaftG; Konstruktions-, Fabrikations-, Instruktionsfehler und Produktbeobachtungspflicht) des Produktes eines der von Abs. 1 abschließend aufgezählten Rechtsgüter verletzt wird und die Haftung nicht nach den § 1 Abs. 2 bzw. Abs. 3 ProdHaftG ausgeschlossen ist.
123
Voraussetzung für die Haftung ist zunächst das Vorliegen einer Rechtsgutverletzung. Das fehlerhafte Produkt muss den Tod eines Menschen, eine Körper- oder Gesundheitsverletzungen oder eine Sachbeschädigung zur Folge gehabt haben. Für eine Sachbeschädigung als Rechtsgutverletzung ist nach § 1 Abs. 1 S. 2 ProdHaftG erforderlich, dass eine andere Sache als das fehlerhafte Produkt beschädigt wird und dass diese andere Sache ihrer Art nach gewöhnlich für den privaten Ge- oder Verbrauch bestimmt ist und hierzu von dem Geschädigten hauptsächlich verwendet worden ist.
124
Erforderlich ist weiterhin das Vorliegen eines haftungsbegründenden wie haftungsausfüllenden Zurechnungszusammenhangs. Das Schadensereignis muss sich daher gerade als die Realisierung des aus der Fehlerhaftigkeit des Produkts folgenden Risikos darstellen und der eingetretene Schaden muss kausal auf dem Produktfehler beruhen.[224]
125
Gemäß § 1 Abs. 4 S. 1 ProdHaftG trägt der Geschädigte die Beweislast für den Fehler, den Schaden und den Zurechnungszusammenhang. Der Hersteller trägt die Beweislast für die Ausschlusstatbestände nach § 1 Abs. 2 und Abs. 3 ProdHaftG.[225]
126
Ersatzfähig sind sowohl Vermögens- als auch Nichtvermögensschäden.[226] Aus den §§ 6–10 ProdHaftG ergeben sich Einzelheiten in Bezug auf Inhalt, Art und Umfang des zu leistenden Schadensersatzes.
127
Aktivlegitimiert sind der Patient, seine Angehörigen und Dritte, welche etwa beim Gebrauch eines Medizinprodukts verletzt wurden.[227] Sie haben ihre Ansprüche gegen den passivlegitimierten Hersteller auf dem Zivilrechtsweg zu verfolgen.[228]
IV. Haftung nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG)
128
Letztlich kann auch § 1 Abs. 1 S. 1 OEG zu einem Versorgungsanspruch im Zusammenhang mit einem Arzthaftungsfall führen. Dieser opferentschädigungsrechtliche Grundtatbestand gewährt demjenigen, der infolge eines vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriffs gegen seine oder eine andere Person oder durch dessen rechtmäßige Abwehr eine gesundheitliche Schädigung erleidet, wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen auf Antrag eine Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des BVG.
129
Voraussetzung ist, dass eine durch einen schädigenden Vorgang[229] hervorgerufene gesundheitliche Schädigung rechtsrelevante Folgen hervorgerufen hat. Der schädigende Vorgang i.S. eines tätlichen Angriffs setzt nach der Rechtsprechung des BSG eine in strafbarer Weise unmittelbar auf den Körper eines Anderen abzielende Einwirkung voraus.[230] So stellt beispielsweise ein ärztlicher Eingriff einen vorsätzlichen, rechtswidrigen tätlichen Angriff dar, wenn dieser als vorsätzliche Körperverletzung strafbar ist.[231] Das ist bei nahezu allen Aufklärungspflichtverletzungen der Fall.
130
Eine unmittelbare Schädigung[232] liegt vor, wenn eine durch den schädigenden Vorgang bewirkte primäre gesundheitliche Beeinträchtigung erfolgt[233]. Reine Vermögensschäden oder Sachbeschädigungen sind, mit Ausnahme der gemäß Abs. 10 genannten Hilfsmittel, von einem Entschädigungsanspruch ausgeschlossen.
131
Beim Fehlen von Versagungsgründen nach § 2 OEG gewährt § 1 Abs. 1 S. 1 OEG einen Versorgungsanspruch in entsprechender Anwendung des BVG. Gemäß § 7 Abs. 1 OEG ist grundsätzlich der Rechtsweg zu den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit eröffnet.
132
Aktivlegitimiert sind unmittelbar oder mittelbar geschädigte natürliche Personen, aber auch der nasciturus. Zudem können nach Abs. 8 auch Hinterbliebene Ansprüche geltend machen.[234]
133
Die anspruchsbegründenden Voraussetzungen des § 1 Abs. 1–3 OEG hat der Antragssteller/Kläger zu beweisen. Der Versorgungsträger trägt dagegen die Beweislast für das Vorliegen von Versagungsgründen nach § 2 OEG.[235]
2. Kapitel Verjährung
A. Einleitung1 – 6
B. Kenntnis von einem schadenskausalen Behandlungsfehler7 – 68
I. Grundsatzentscheidungen zur Kenntnis von einem schadenskausalen Behandlungsfehler8 – 21
II. Feststellungen zum Zeitpunkt der Kenntnis, Fallgruppen22 – 51
1. Beweislasten25 – 28
2. Rückschluss auf Kenntnis aus Anspruchsanmeldung bzw. Anschuldigungen der Patientin/des Patienten29 – 38
3. Verhältnis von Kenntnis und herabgesetzter Substantiierungslast39
4. Rückschluss auf Kenntnis aus Behandlungsfehlervorwürfen im Klagverfahren40 – 44
5. Erkenntnisse im Rahmen der Nachbehandlung45 – 48
6. Kenntnis durch MDK-Gutachten oder Schlichtungsstellengutachten49 – 51
III. Mehrere Fehlervorwürfe, Behandlungseinheit oder selbstständige Nachteile52 – 57
IV. Kenntnis – Spannungsverhältnis von unklarer Kausalität und Beweiserleichterungen58 – 63
V. Kenntnis der vom Patienten beauftragten Anwälte und Wissensvertretung64 – 68
C. Kenntnis von unzureichender Risikoaufklärung oder Alternativaufklärung69 – 79
D. Grob fahrlässige Unkenntnis des geschädigten Patienten80 – 90
E. Besonderheiten bei der Kenntnis und grob fahrlässigen Unkenntnis von Sozialversicherungsträgern91 – 114
I. Grundsatzentscheidungen zur Kenntnis des SVT im Behandlungsfehlerbereich93 – 98
II. Kenntnis durch Hinweise des Versicherten99 – 101
III. Zumutbare Bemühungen um Klärung eines schadenskausalen Behandlungsfehlers102 – 109
IV. Keine Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis durch einen Behandlungsfehler verneinendes MDK-Gutachten110 – 113
V. Kenntniszurechnung bei einem Wechsel des SVT114
F. Hemmung der Verjährung115 – 163
I. Verjährungshemmung durch außergerichtliche Verhandlungen, § 203 S. 1 BGB115 – 143
1. Beginn der Verjährungshemmung116 – 118
2. Erstreckung der Verjährungshemmung auf angestelltes medizinisches und nicht medizinisches Personal119, 120
3. Ende der Verjährungshemmung:121 – 143
a) Ausdrücklicher Abbruch der Verhandlungen122 – 127
b) Einschlafen der Verhandlungen128 – 143
II. Verjährungshemmung während eines Verfahrens vor einer von den Ärztekammern eingerichteten Schlichtungs- bzw. Gutachterstelle nach § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB144 – 149
III. Arzthaftungsrechtliche Besonderheiten der gerichtlichen Verjährungshemmung150 – 163
1. Klagezustellung an einen Krankenhausarzt151
2. Fehlerhafte Trägerbezeichnung152 – 155
3. Verjährungshemmung durch Zuständigkeitsbestimmungsantrag156, 157
4. Keine Verjährungshemmung durch unzulässige Streitverkündung158, 159
5. Streitgegenstand und Hemmung nach § 204 BGB160 – 163
G. Das Gebot des sichersten Weges, Verjährungsdiskussionen und Einredeverzichte164 – 175
A. Einleitung
1
Das zentrale Problem der Verjährung in Arzthaftungssachen lag schon vor der Schuldrechtsmodernisierung und liegt seither mit der Umstellung auch der Verjährung der vertraglichen Ansprüche auf die 3-jährige, kenntnisabhängige Verjährung der §§ 195, 199 BGB darin, dass auf Patientenseite in aller Regel zunächst die Kenntnis fehlt, ob der negative Ausgang einer Behandlung auf die Grunderkrankung oder Behandlungsrisiken zurück geht oder auf ein fehlerhaftes Vorgehen der behandelnden Ärzte. Würde man den schlechten Ausgang der Behandlung für den Verjährungsbeginn ausreichen lassen, würden etliche Ansprüche ohne hinreichende Kenntnis der Patientenseite der Verjährung unterliegen.
2
Der BGH hat mit breiter Zustimmung schon nach § 852 Abs. 1 BGB a.F. zu den subjektiven Voraussetzungen des Verjährungsbeginns die Kenntnis vom schadenskausalen Abweichen vom ärztlichen Standard gerechnet und daran auch nach der Schuldrechtsmodernisierung zum Jahresbeginn 2002 festgehalten.[1]
3
Dass die mit der Schuldrechtsmodernisierung eingeführte Alternative der grob fahrlässigen Unkenntnis die Gerichte beschäftigen würde, war abzusehen. Inzwischen sind die daran anknüpfenden Fragen jedoch weitgehend geklärt. Geändert hat sich durch die Einführung der kenntnislosen Verjährung wegen grob fahrlässiger Unkenntnis nicht viel, weil Kenntnis von einem Behandlungsfehler in der Regel nicht ohne nennenswerten Aufwand zu erwerben ist.
4
Ich werde mich zunächst mit den Voraussetzungen der Kenntnis vom schadenskausalen Behandlungsfehler befassen und sodann mit der grob fahrlässigen Unkenntnis. Die Kenntnissituation bei Schadensersatzansprüchen aus unzureichender Risikoaufklärung bzw. unzureichender Aufklärung über Behandlungsalternativen ist, weil es nicht um das Abweichen vom ärztlichen Standard bei der Behandlung geht, sondern um Schäden aus einer rechtswidrigen Behandlung, gesondert zu beleuchten.
5
Kenntnis und grob fahrlässige Unkenntnis bei Sozialversicherungsträgern werden weitgehend analog zu den Verhältnissen bei den dort versicherten Patienten gesehen, weisen wegen der arbeitsteiligen Bearbeitung und wegen der Fragen der Kenntnisvertretung jedoch Besonderheiten auf, weshalb ich diesem Komplex einen eigenen Abschnitt widme.
6
Sodann wird es erforderlich werden, arzthaftungsrechtliche Besonderheiten bei Fragen der Verjährungshemmung anzusprechen.
B. Kenntnis von einem schadenskausalen Behandlungsfehler
7
Der Begriff der Kenntnis spielte vor der Schuldrechtsmodernisierung allein für deliktische Schadensersatzansprüche eine Rolle, geregelt in § 852 Abs. 1 BGB a.F. Das betraf damals vor allem die Schmerzensgeldansprüche und Ansprüche gegen vertraglich nicht selbst haftende, z.B. im Krankenhaus angestellte Ärzte oder Hebammen. Der Begriff der Kenntnis war damit auch im Arzthaftungsbereich mit der Schuldrechtsmodernisierung nicht neu, wurde aber mit der Abkürzung der Verjährungsfrist für materielle Schadensersatzansprüche auf drei Jahre ab Ende des Jahres, in welchem Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von den anspruchsbegründenden Umständen vorlag, für sämtliche Ansprüche aus Behandlungs- und Aufklärungsfehlern relevant, §§ 195, 199 Abs. 1 BGB.
I. Grundsatzentscheidungen zur Kenntnis von einem schadenskausalen Behandlungsfehler
8
In verjährungsrechtlichen Streitigkeiten wird noch heute eine ältere Entscheidung des BGH zum Verjährungsbeginn in Arzthaftpflichtsachen diskutiert, Urteil vom 20.9.1983[2], in welcher der BGH zwei Positionen aufstellt, die in einem dort nicht gelösten Spannungsverhältnis zueinander stehen. Zum einen wird konstatiert, dass es nur auf die Kenntnis der anspruchsbegründenden Tatsachen ankomme, nicht auf deren zutreffende rechtliche Würdigung „und erst Recht nicht darauf, ob der Geschädigte aus den ihm bekannten Tatsachen zutreffende Schlüsse auf den in Betracht kommenden naturwissenschaftlich zu erkennenden Kausalverlauf zieht“. Zum anderen hält der BGH aber schon dort fest, „dass es die Besonderheiten des Arzthaftpflichtprozesses gebieten, nicht vorschnell von der Tatsache, dass eine zum Schaden führende Verletzungshandlung offenbar ist, auf einen schuldhaften Behandlungs- (oder Aufklärungs-)fehler zu schließen.“ Wegen der bei ärztlichen Eingriffen häufig weder vorausschauend noch rückwirkend eindeutig feststellbaren Kausalverläufe würden Misserfolge und Komplikationen im Verlauf einer ärztlichen Behandlung nicht stets auf ein Fehlverhalten des behandelnden Arztes hinweisen. „Eine ausreichende Kenntnis des Patienten von Tatsachen, die ein derartiges Fehlverhalten nahelegen, setzt deshalb zum Beispiel die Kenntnis der wesentlichen Umstände des Behandlungsverlaufs, insbesondere auch etwaiger anatomischer Besonderheiten, eines vom Standard abweichenden ärztlichen Vorgehens, des Eintritts von Komplikationen und der zu ihrer Beherrschung ergriffenen Maßnahmen voraus.“
9
Unter diesem zweiten Gesichtspunkt hätte der BGH in dieser Entscheidung eigentlich nicht zu einer den Verjährungsbeginn auslösenden Kenntnis kommen können, denn es fehlen in den Urteilsgründen jegliche Anhaltspunkte dafür, dass der Patient in verjährungsrelevanter Zeit etwas vom Abweichen vom ärztlichen Standard wusste. Die Entscheidung wurde deshalb schon damals von Taupitz[3] als widersprüchlich kritisiert und wird heute durch die weitere Rechtsprechung des BGH als überholt angesehen[4].
10
Inzwischen tritt der Einwand, dass eine zutreffende medizinische Würdigung unerheblich sei, deutlich hinter das Erfordernis zurück, dass der Patient erkennen muss, dass der aufgetretene Schaden auf einem fehlerhaften Verhalten der Behandlerseite beruht.
11
Schon in seiner Entscheidung vom 23.4.1985[5] macht der BGH deutlich, dass es nicht ausreicht, dass die Klägerseite argwöhnt, der Beklagte habe etwas falsch gemacht, „weil bloße Vermutungen ohne tatsächliche Grundlage einer Kenntnis des tatsächlichen Verlaufs nicht gleichstehen“.
12
Nach der Entscheidung des BGH vom 23.4.1991[6] genügt es nicht schon, dass der Patient Einzelheiten des ärztlichen Tuns oder Unterlassens kennt, „vielmehr muss ihm aus seiner Laiensicht der Stellenwert des ärztlichen Vorgehens für den Behandlungserfolg bewusst sein. Deshalb beginnt die Verjährungsfrist nicht zu laufen, bevor nicht der Patient als medizinischer Laie Kenntnis von Tatsachen erlangt, aus denen sich ergibt, dass der Arzt von dem üblichen ärztlichen Vorgehen abgewichen ist oder Maßnahmen nicht getroffen hat, die nach ärztlichem Standard zur Vermeidung oder Beherrschung von Komplikationen erforderlich waren.“
13
Noch etwas einfacher drückt es der BGH in seiner Entscheidung vom 29.11.1995[7] aus: „Er (der Patient) muss vielmehr auch Kenntnis von einem ärztlichen Behandlungsfehler haben.“
14
In seiner Entscheidung vom 24.6.1999[8] ergänzt der BGH: „Der Hinweis sogar eines Arztes auf eine mögliche Schadensursache vermittelt noch keine Kenntnis der anspruchsbegründenden Tatsachen.“
15
In seiner ersten Entscheidung zum Verjährungsbeginn in Arzthaftungssachen nach der Schuldrechtsmodernisierung, also auf der Grundlage des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB n.F., hat der BGH diese Grundsätze unterstrichen und die erforderliche Kenntnis vom Abweichen vom ärztlichen Standard erst dann angenommen, „wenn die dem Anspruchsteller bekannten Tatsachen ausreichen, um den Schluss auf ein schuldhaftes Fehlverhalten des Anspruchsgegners und auf die Ursache dieses Verhaltens für den Schaden bzw. die erforderliche Folgeoperation als naheliegend erscheinen zu lassen (. . .). Denn nur dann wäre dem Geschädigten die Erhebung einer Schadensersatzklage, sei es auch nur in Form der Feststellungsklage, erfolgversprechend, wenn auch nicht risikolos, möglich (. . .).“[9]
16
Nach anhaltender Diskussion darüber, ob nicht doch die Kenntnis von den Behandlungsdaten und dem Behandlungsverlauf ausreiche, hat der BGH in seiner Entscheidung vom 8.11.2016[10] noch einmal klargestellt, dass Kenntnis von einem Behandlungsfehler vorliegen muss. Es ging in dieser Sache um einen im Jahr 2003 geborenen Kläger, bei dessen Geburt es bei einem Geburtsgewicht von 5.100 g durch eine Schulterdystokie während der vaginalen Entbindung zu einer Schädigung des Plexus brachialis links mit der Folge einer dauerhaften Parese gekommen war. Im Jahr 2006 hatte die Mutter des Klägers ein umfangreiches Gedächtnisprotokoll gefertigt, in welchem sie die Geburt detailliert beschrieb und auch Kritik an der angewandten geburtshilflichen Technik übte. Noch im September 2006 hatten die Prozessbevollmächtigten des Klägers die wesentlichen Teile der Dokumentation aus der stationären geburtshilflichen Behandlung erhalten. Das OLG Koblenz[11] hatte in diesem Fall daher der Mutter des Klägers als dessen Wissensvertreterin die für den Verjährungsbeginn maßgebliche Kenntnis von einem Behandlungsfehler unterstellt. Der BGH hat in seiner Entscheidung die Feststellungen des OLG zur Kenntnis von ärztlichen Behandlungsfehlern jedoch nicht ausreichen lassen. Zwar hätten die Rechtsanwälte des Klägers im August 2007 ärztliche Behandlungsfehler mit hinreichender Deutlichkeit angesprochen, sodass für diese Zeit die erforderliche Kenntnis zu unterstellen sei. Das Berufungsgericht habe aber keine Feststellungen dazu getroffen, ob diese Kenntnis schon im Jahr 2006 vorgelegen habe oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangt werden müssen. Die reine Kenntnis der Abläufe und der Behandlungsunterlagen haben dem BGH mithin für den Verjährungsbeginn nicht gereicht.