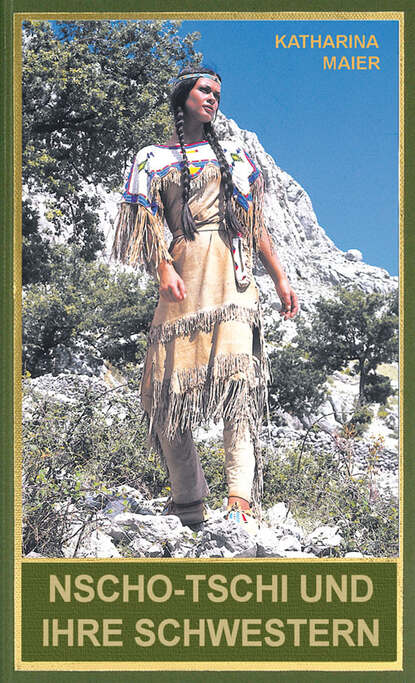Chronik eines Weltläufers

- -
- 100%
- +
Mir wollte die erwartete Ruhe nicht kommen. Als wir drei Stunden gelegen hatten, bemerkte ich, dass Old Death aufstand und fortging. Da erhob ich mich und ging ihm nach. Ich merkte, dass er etwas auf dem Herzen hatte, und nach einiger Zeit erzählte er mir, dass er eigentlich Eduard Harton hieß und der undankbare Bruder von Fred Harton sei, dessen ganzes Vermögen er verjubelt habe. Nun wolle er Frieden mit ihm schließen, wenn er ihn treffen würde. Sollte ihm aber vorher etwas zustoßen, solle dieser seinen Sattel aufschneiden und alles an sich nehmen, was sich darin befände. Kurz danach kehrte ich langsam zum Lager zurück und legte mich nieder.
Donnerstag, 12. Juli 1866:
Ein Apatsche nahm Tadeo Sandia hinter sich aufs Pferd; dann brachen wir auf. Gegen Mittag stellte der Gambusino Sandia fest, dass Harton einen Umweg eingeschlagen hatte. Auf einer grasbewachsenen Hochebene sahen wir die Fährte von über vierzig Reitern, die etwa eine Stunde alt war. Jetzt wurden die Sporen eingesetzt, und wir flogen über die Ebene dahin, freilich in ganz anderer Richtung, als die Chimarras geritten waren. Harton hatte sie nicht zum Eingang der Bonanza geführt, sondern zur hintersten Kante des Tals. Leider aber brach jetzt die Dunkelheit mit großer Schnelligkeit herein. Deshalb stiegen wir auch ab und gingen zu Fuß. Wir sahen in der Dunkelheit eine Gestalt zwischen uns und den Felsen dahinhuschen. Nach kurzer Zeit bemerkten wir einen unbestimmten Lichtschimmer, den Schein von Lampen, der durch die Decken eines Zeltes drang. Stimmen ertönten. Wir vier, Sandia, Old Death, Winnetou und ich, waren voran. Man erkannte von außen, an welcher Stelle sich der Eingang befand. Old Death trat als erster ein. Da fiel ein Schuss. Ich sah, wie sich der Scout mit beiden Händen an den Rahmen des Vorhangs krampfte, und sah zugleich mehrere Gewehre auf den Eingang gerichtet. Der Alte konnte sich nicht mehr aufrecht halten; er glitt zu Boden. „Schießt nicht!“, schrie ich auf. „Wir sind Freunde, Deutsche!“ Als die Leute des Lagers begriffen, dass wir keine Feinde, sondern Freunde waren, traten auch die beiden Langes ein, mit ihnen Sandia. Old Death war tot, gerade durchs Herz geschossen. Harton musste mir sagen, wie er entkommen sei. Außerdem galt es die nötigen Vorbereitungen zu treffen. So standen jetzt mehr als fünfzig Mann bereit, die Feinde zu erwarten, denen wir an Zahl gleich, an Waffen aber weit überlegen waren. Da kam einer der Leute, die wir vorgeschickt hatten. Er brachte zwei Weiße, die Señor Uhlmann ihre Aufwartung machen wollten. Dieser saß allein im Zelt, denn ich hatte mich mit den Langes, Winnetou und Harton in das Nebenabteil des Zeltes zurückgezogen. Da sah ich Gibson mit William Ohlert eintreten. Als sie saßen, trat ich aus meinem Versteck hervor; Harton folgte mir. Bei unserem Anblick fuhr Gibson auf. Ohlert saß wie gewöhnlich teilnahmslos da. Gibson aber fasste sich schnell. Er hatte sein Gewehr in der Hand und holte zum Kolbenhieb aus. Als ich ihn abwehrte, ging der Hieb zur Seite, der Kolben sauste nieder und traf den Kopf Ohlerts, der zusammenbrach. Im nächsten Augenblick drängten sich einige Arbeiter von hinten ins Zelt. Sie richteten ihre Gewehre auf Gibson. Ein Krach, und er stürzte, durch den Kopf getroffen, tot zu Boden. Als wäre der Schuss ein Zeichen gewesen, so erhob sich unweit des Zeltes wildes Indianergeheul. Als ich hinauskam, war das Gefecht schon entschieden. Die Feinde waren anders empfangen worden, als sie gedacht hatten. Die meisten von ihnen lagen tot oder verwundet am Boden. Die anderen flohen dem Ausgang zu.
Harton hatte noch keine Ahnung, wer auf unserer Seite der einzige Tote des heutigen Abends war. Ich ging mit ihm hinaus ins Tal und teilte ihm mit, was er erfahren musste. Fred Harton weinte wie ein Kind. Er hatte seinen Bruder trotz allem stets geliebt, hatte ihm alles vergeben. Ich musste ihm alles erzählen, von meinem ersten Zusammentreffen mit dem Scout bis zum letzten Augenblick, da den Reuigen die Kugel traf, die nicht für ihn bestimmt war. Erst nach mehr als einer Stunde gingen wir zum Zelt zurück.
Freitag, 13. Juli 1866:
Am anderen Morgen wurde Old Deaths Sattel herbeigeholt und aufgeschnitten. Wir fanden eine Brieftasche. Der Tote hinterließ seinem Bruder Bankanweisungen in bedeutender Höhe, und, was die Hauptsache war, die ausführliche Beschreibung und den peinlich genau bezeichneten Plan einer Stelle in der Sonora, wo Old Death eine vielverheißende Bonanza entdeckt hatte. Wir begruben Old Death und errichteten ihm ein Grabmal mit einem Kreuz aus silberhaltigem Erz. Sein Bruder trat aus dem Dienst Uhlmanns, um sich in Chihuahua einige Zeit auszuruhen. Groß war das Glück, das Uhlmann und seine Frau über die Ankunft ihrer beiden Verwandten empfanden. Sie waren liebe, gastfreundliche Leute, denen dieses Glück zu gönnen war. – Ohlert lebte zwar, aber er wollte nicht aus seiner Betäubung erwachen. Ich wollte so lange warten, bis es sein Zustand erlaubte, ihn nach Chihuahua in die Pflege eines tüchtigen Arztes zu geben.
Samstag, 14. Juli 1866:
Winnetou beschloss, mit seinen zehn Apatschen heimzureiten, denn seiner harrten nach Abschluss des Kampfes mit den Komantschen noch die Verhandlungen, die zwischen beiden Stämmen den Frieden sichern sollten. Auch der Neger Hektor reiste ab.
Samstag, 15. September 1866:
Und zwei Monate später saß ich bei dem guten Ordensmann Benito von der Bruderschaft El bueno Pastor in Chihuahua. Ihm, dem berühmten Arzt der nördlichen Provinzen, hatte ich meinen Kranken gebracht, und es war ihm gelungen, ihn völlig herzustellen. Es war, als sei mit dem Kolbenhieb in Ohlert die unglückliche Zwangsvorstellung, ein wahnsinniger Dichter zu sein, erschlagen worden. Er war munter und wohlauf und sehnte sich nach seinem Vater. Er wusste noch nicht, dass ich meinen Auftraggeber erwartete. Ich hatte ihm nämlich einen Bericht geschickt und darauf die Nachricht erhalten, dass der Vater selbst kommen werde, seinen Sohn abzuholen. Nebenbei hatte ich bei Mr. Josy Tailor um meine Entlassung gebeten. Heute saßen wir nun wieder beisammen: der Pater, Ohlert, Harton und ich. Da ließ der Diener einen Herrn herein, bei dessen Anblick William einen Freudenschrei ausstieß: Es war sein Vater, der Bankier Ohlert aus New York. Da gingen wir anderen still hinaus.
Ohlert brachte mir von Josy Tailor die erbetene Entlassung und den Gehaltsrest, dem der Bankier eine ansehnliche Sondervergütung beifügte.
Sonntag, 16. September 1866:
Jetzt hätte ich eigentlich mehr als genügend Mittel gehabt, um meine ursprüngliche Absicht, heimzukehren, endlich auszuführen. Aber ich sah ein neues Abenteuer winken, vor dem der Gedanke an die Heimat verblasste. Ich gab Fred Harton meine Zustimmung, ihn zu begleiten.
Mitte Dezember 1866:
Es kam auch jetzt wieder so, wie schon oft auf meinen Reisen: Ich blieb länger von zu Hause fort, als anfänglich mein Plan gewesen war. Es ist zu sagen, dass wir, allerdings unter großen Beschwerden und Gefahren, so glücklich waren, die von Old Death entdeckte Bonanza aufzufinden.
Bei meinen weiteren Streifzügen durch die Sonora, das nordöstliche Gebiet Mexikos, lernte ich einen Südamerikaner aus den La-Plata-Staaten kennen, der sich Pena nannte. Wir hatten uns einander angeschlossen, hatten Freud und Leid miteinander geteilt und mancherlei Abenteuer miteinander gemeinsam bestanden2. Ich musste ihm bei unserer Trennung versprechen, ihn in Tucuman zu besuchen, falls ich einmal nach Argentinien kommen sollte.
Samstag, 2. Februar 1867:
Nicht ganz ungefährlich gestaltete sich mein Weg nach St. Louis zu Mr. Henry, wo ich meinen Bärentöter und den Henrystutzen abholen wollte. Ich hielt mich kurz am Rio Pecos bei den Mescaleros auf, ritt dann durch den Llano Estacado zur Oase von Bloody-Fox. Danach ging es weiter nach Nordost, wo ich teilweise die Bahn benutzen konnte, bis ich bei Mr. Henry in St. Louis war, bei dem ich heute ankam. Er hatte sich ja vor mehr als einem halben Jahr bereit erklärt, meine beiden Gewehre, die allzu auffällig und mir daher bei der Verfolgung von Gibson und Ohlert hinderlich waren, bis zu meiner mutmaßlichen Rückkehr von New Orleans aufzubewahren. Hätte ich damals freilich geahnt, welch unerwünschte Ausdehnung die Verfolgung annehmen würde, so hätte ich die Gewehre mitgenommen. Ich musste Mr. Henry versprechen, mich einige Zeit bei ihm von meinen Strapazen zu erholen, bis ich wieder nach Deutschland zurückkehren würde, was ich auch gerne tat.
Donnerstag, 21. März 1867:
Ich hatte mir vorgenommen, mich auf dem Weg nach New York ein wenig in den Oststaaten umzusehen, da ich hier, außer bei meiner ersten Nordamerika-Reise, fast kaum etwas von der Landschaft und von den Städten gesehen hatte. Bis auf eine Begebenheit, die mich leicht das Leben hätte kosten können, ist nicht viel davon zu berichten. Dieses eine Ereignis geschah, als ich einen Abstecher zum Kanawha machte, einem Nebenfluss des Ohio in West Virginia. Dort wurde ich Zeuge, wie ein Ölbohrturm explodierte und die in der Nähe stehenden Arbeiter mit in den Tod riss. Ich werde dieses furchtbare Ereignis nie vergessen, denn ich war in unmittelbarer Nähe, aber doch glücklicherweise noch so weit entfernt, dass ich mit dem Schrecken davonkam. Wann und wie das meterhoch senkrecht in der Luft stehende lodernde Feuer gelöscht wurde, erfuhr ich nicht mehr, denn da war ich schon aus dem Kanawhatal heraus. Ich setzte danach meine Reise über die Industriestadt Pittsburg und über Philadelphia, wo ich mich etwas länger aufhielt, fort. In New York besuchte ich als erstes das Bankhaus Ohlert, wo ich von Vater und Sohn Ohlert freudig begrüßt wurde. William Ohlert hatte sich in der kurzen Zeit, in der er offiziell als Juniorchef im Bankhaus tätig war, gut eingearbeitet, wie mir sein Vater bestätigte. Selbstverständlich wurde ich eingeladen, während meines New Yorker Aufenthalts in ihrem Haus zu wohnen und mich so zu fühlen, als ob ich hier daheim wäre. Nach kurzem Zögern nahm ich das Angebot dankend an und fühlte mich dort die ganze Zeit recht wohl. Ich nahm dann auch noch Verbindung zur ‚New Yorker Staatszeitung‘ auf, die die Berichte meiner letzten Erlebnisse freudig annahm, denn solche Artikel bekam sie nicht jeden Tag. Natürlich nannte ich darin William Ohlert nicht bei seinem richtigen Namen, sondern veränderte die Angelegenheit etwas, sodass niemand auf den Gedanken kommen konnte, dass damit ein Angehöriger des Bankhauses Ohlert gemeint sei. In zwei Tagen wird ein Dampfer den New Yorker Hafen in Richtung Hamburg verlassen, auf dem mir Mr. Ohlert, obwohl ich das nicht wollte, eine Kabine erster Klasse gebucht hat. So nobel werde ich wohl nie wieder auf einem Schiff die Heimreise antreten. Ich hoffe, bis spätestens Ende dieses Monats wieder zu Hause anzukommen.
9. ROM-REISE (1867)1
Sonntag, 12. Mai 1867:
Ich habe mich ganz kurzfristig entschlossen, eine Rom-Reise anzutreten, und morgen früh werde ich abreisen. Wenn ich Glück habe, werde ich Papst Pius IX. sehen, der seit über zwanzig Jahren das Oberhaupt der katholischen Christen und nun schon 76 Jahre alt ist.
Pfingstsonntag, 9. Juni 1867:
Im Petersdom habe ich am Pfingstgottesdienst teilgenommen, einem feierlichen Pontifikalamt, das der Heilige Vater zusammen mit den in Rom anwesenden Kardinälen zelebrierte. Zu einer Audienz wurde ich leider nicht zugelassen.
Dienstag, 25. Juni 1867:
Heute bin ich von meiner eindrucksvollen Rom-Reise zurückgekommen. Es waren wunderschöne Tage, die ich dort verlebte. Ich habe die Heilige Stadt, die seit der Rückkehr von Papst Pius IX. aus dem Exil von Gaeta mit Hilfe der Franzosen wieder zum Kirchenstaat gehört, reichlich genossen. Nicht nur die wichtigsten christlichen Kirchen und Katakomben habe ich besucht, sondern bin auch regelrecht in den antiken Stätten herumgekrochen und habe die alte römische Zeit an mir vorüberziehen lassen.
10. ZWEITE ORIENT-REISE (1867)
Freitag, 19. Juli 1867:
Ich bin heute wieder auf der Reise in den Süden. Über Genua und Monaco, das durch seine Spielbank1 weltbekannt ist, will ich nach Marseille weiterreisen. Von hier werde ich nach Algier übersetzen und mich von dort aus über die Grenze nach Tunesien begeben.
Dienstag, 13. August 1867:2
Es war erst neun Uhr vormittags, und doch brannte die afrikanische Sonne schon stechend auf das vor uns liegende Tal herab. Wir kamen aus der Provinz Constantine, hatten gestern zwischen Dschebel Frima und Dschebel el Maallega die tunesische Grenze überschritten und waren dann quer durch das Wadi Melis gegangen. Wir wollten bis zum Abend Seraïa Bent erreichen. Mein Diener Achmed es Sallah war lange Zeit in Algier gewesen, stammte aber aus der Gegend, wo wir hinwollten, und war daher für mich der ideale Führer. Er hatte seine Heimat verlassen, da er arm war und Mochallah, die Tochter des Scheiks der Uëlad Sedira, liebte, die ihm dieser jedoch verweigerte. Er hatte in Algier viele Franken und Piaster verdient und nun konnte er dem Scheik bezahlen, was dieser für seine Tochter gefordert hatte.
Bei einer Gazellenjagd lernte ich den Obersten der Leibgarde des Herrschers von Tunis kennen, der als ‚Krüger Bei‘ bekannt und ein ehemaliger Bierbrauer aus Brandenburg war. Als ich ihn auf Deutsch ansprach, war er erst verblüfft, dann aber hocherfreut, dass er in mir einen Deutschen vor sich hatte. Und dann tauchte noch eine weitere Überraschung auf: Lord David Percy, der eigentümliche Sohn des Earl von Forfax, mein ehemaliger Reisegefährte in Indien.3 Beide wollten nach Seraïa Bent, um von Scheik Ali en Nurabi einige prächtige Pferde zu kaufen. Von den Reitern des Stammes wurden wir mit einer Fantasia begrüßt und vom Scheik zum Essen eingeladen. Wir machten ihm die geschossenen Gazellen zum Geschenk. Seine beiden Söhne waren mit einigen jungen Leuten unterwegs, um einen Überfall durch die Beni Hamema auf eine Karawane zu verhindern. Dann besichtigten wir die Pferde des Stammes. In der Herde befanden sich eine prachtvolle milchweiße Stute und ein noch kostbareres Bischarîn-Hedschîn. Während der Besichtigung kamen die beiden Söhne des Scheiks mit einem Gefangenen: Sâdis, der Krumir, der einen aus dem Stamm getötet und zwei andere verwundet hatte. Kaum waren wir im Lager, da stellte sich der Krumir hinter die Tochter des Scheiks und rief: „Ich bin der Beschützte!“ Die Versammlung der Ältesten beriet über das weitere Schicksal des Krumir. Achmed bat mich, ‚Schmiere‘ zu stehen, damit er sich heimlich mit der Tochter des Scheiks treffen konnte. Als ich das Liebespaar bewachte, sah ich eine verdächtige Gestalt. Es war der Krumir. Doch ich wurde von einigen anderen Personen niedergeschlagen, die mich fesselten und knebelten. Als ich aus der Bewusstlosigkeit erwachte, konnte ich aus ihrem Gespräch ihr weiteres Vorhaben hören. Sie wollten die Tochter des Scheiks entführen, das Bischarîn-Hedschîn und die weiße Stute stehlen. Trotz der Fesseln konnte ich einen meiner beiden Revolver erreichen und sechs Schüsse abgeben, sodass das ganze Duar geweckt wurde. Achmed hatte inzwischen einen der Hamema-Beduinen erschossen und einen zweiten verwundet, als sie auch meinen Hengst stehlen wollten. Es wurde beschlossen, dass ich mit Achmed, Lord Percy, dem Scheik und sechzig Beduinen die Verfolgung aufnehmen sollte, während hundertfünfzig Stammesangehörige unter der Leitung des Scheiksohnes der erwarteten Karawane entgegenreiten würden.
Mittwoch, 14. August 1867:
Krüger Bei, der Anführer der tunesischen Heerscharen konnte sich unserer Unternehmung nicht anschließen. Er kehrte mit seinen Begleitern nach el Bordsch zurück, wobei er eine große Strecke mit den Uëlad Sedira reiten konnte, die der Kâfila entgegengingen. Er nannte mich seinen Freund und mahnte, ich solle nicht vergessen, ihn in Tunis zu besuchen. Dann brachen wir auf, die einen nach Norden und wir anderen nach Süden. Wir ritten in Richtung des Bah Abida, den der Krumir übersteigen wollte. Später entdeckten wir, dass die Räuber sich getrennt hatten. Es waren vier verschiedene Spuren entstanden und es dauerte lange, bis ich endlich die gesuchten Hufeindrücke fand, die ich dem Krumir zuordnen konnte. Er schien mit der Tochter des Scheiks allein weiterzureiten. Nun aber ging es mit verdoppelter Eile auf der neu entdeckten Fährte weiter. Wir erreichten den Bah Abida nach dem Nachmittagsgebet und waren bei Sonnenuntergang auf seinem Gipfel.
Donnerstag, 15. August 1867:
Obwohl die Verfolgten der Spur nach nur zwei Stunden vor uns waren, mussten wir nach einigen Stunden feststellen, dass wir ihnen nicht näher gekommen waren, weil sie bessere Pferde besaßen. Deshalb trennten wir uns von unserem Trupp und wir vier, Achmed, Lord Percy, der Scheik und ich, ließen unsere Tiere doppelt ausgreifen. Nach stundenlangem Ritt sah ich weiße und farbige Punkte, die sich bewegten. Durch mein Fernrohr erkannte ich ein Kamel mit einer Atuscha und sieben Reiter, der eine von ihnen auf einer Milchstute. Als wir ihnen näher gekommen waren, blickte sich der Krumir um und erkannte, dass wir ihn einholen würden. Er ließ nur einen kurzen Augenblick halten, dann stob der Trupp auseinander, der Krumir geradeaus, das Hedschîn nach rechts und die anderen Reiter nach links. Ich eilte dem Krumir nach und hatte ihn beinahe erreicht, als er nach links abbog auf ein Beduinenlager zu. Der Krumir war gerettet, denn es waren Bekannte von ihm, die mich mit hundert Gewehren in Schach hielten. Da schwang ich mich vom Pferd und sprang auf zwei Frauen zu, die aus einem Zelt getreten waren. „Ich bin unter dem Schutz der Frauen!“, rief ich laut und huschte in das Zelt hinein. Die jüngere hieß Dschumeila und war die Nichte des Scheiks. Die Versammlung der Ältesten sah neben dem Krumir und mir auch den Scheik und den Engländer, die auch gefangen waren, als freie Menschen an, die das Lager jederzeit verlassen könnten, sprachen aber die geraubte Tochter des Scheiks dem Krumir zu. Mir gestand Scheik Mohammed er Rahman, dass ein Löwe schon einige Männer der Mescheer getötet und Kamele, Rinder und Schafe gerissen habe. Nun sei auch noch ein schwarzer Panther hinzugekommen. Da erbot ich mich, zusammen mit Lord Percy diese Raubtiere zu schießen. Ich ordnete an, wie die Herden der Pferde, Kamele, Rinder und Schafe in der Nacht zu stehen hätten, und machte mich zusammen mit Lord Percy ungefähr anderthalb Stunden vor Mitternacht auf, um unsere getrennten Positionen einzunehmen. Es verging eine lange Zeit, dann ein scharfes Prasseln und Krachen von Knochen, ein Schuss und noch einer, dann war es wieder still. Auf meinen Zuruf antwortete Lord Percy, dass er nicht wisse, ob er den Löwen richtig getroffen habe. Und dann waren plötzlich zwei Panther neben mir. Dem einen schoss ich ins rechte Auge, der Panther war tot. Für den anderen brauchte ich zwei Schüsse. Wir sahen die Blutspur des angeschossenen Löwen und wollten morgen seinen Weg verfolgen. Von den beiden Pantherfellen schenkte ich eines dem Scheik, das andere seiner Nichte Dschumeila.
Freitag, 16. August 1867:
Am nächsten Morgen brachen wir mit zweihundert Beduinen auf, um das Lager des Löwen zu finden, dessen Blutspur wir nachgingen. In einem Gebüsch fanden wir den toten Löwen, die Löwin mit ihren Jungen war weitergezogen zu einem Talkessel, wo wir sie stellten. Zwei meiner Schüsse trafen sie tödlich. Als wir wieder im Duar ankamen, war der Krumir fort und hatte Mochallah mitgenommen, in südlicher Richtung nach dem Dschebel Tiuasch zu. Und auch seine Kumpane, die Hamema-Beduinen, waren verschwunden. Wir nahmen die Verfolgung auf, doch es gelang uns nicht, die Räuber noch am ersten Tag zu erreichen.
Samstag, 17. August 1867:
Wir näherten uns jenen wenig besuchten Ländereien, in denen die Grenze zwischen Algerien und Tunesien strittig ist. So erreichten wir um die Mittagszeit die Berge von Schania, von denen man in das Gebiet der Schotts herabblicken kann. Auch heute holten wir den Krumir nicht ein.
Sonntag, 18. August 1867:
Wir kamen an eine Stelle, an der der Krumir mit seiner Gefangenen die Nacht zugebracht hatte. Gegen Mittag, blitzte es am fernen Himmelsrand hell und kristallisch auf; das war der Schott Rharsa. Wir sahen zwei Pferde, einen Falben und einen Schimmel: Mochallah und der Krumir. Auch er musste uns erkennen, denn er flog mit beiden Pferden davon. Wir näherten uns dem glänzenden Spiegel des Schotts immer mehr. Ich holte den Krumir mit meinem Lasso aus dem Sattel, doch er schwang sich hinter Mochallah auf deren Pferd und lenkte es auf die hell erklingende Salzdecke hinaus, ich hinter ihm her. Und Achmed folgte mir. Der Boden dröhnte, wankte, knirschte und prasselte. Der Tod flog mit uns, vor, neben, unter uns. Als der Krumir merkte, dass sein Pferd an Kraft verlor, weil es die doppelte Last zu tragen hatte, wollte er Mochallah herunterstoßen, doch die klammerte sich an ihm fest. Er aber schlug sie herunter, das flüssige Salz gab nach, sie sank. Doch in diesem Augenblick schoss mein Pferd an ihr vorüber, ich beugte mich tief hinab und fasste sie am Oberarm und zog sie hoch. Da endlich bemerkte ich einen dunklen Streifen, das war fester Boden, doch wir mussten springen, um auf ihm zu landen. Der Krumir war noch vor uns. Mein Rappe flog wie ein Vogel über den breiten, tief sumpfigen Rand hinweg, der die Salzkruste vom festen Boden trennte, und gleich hinter mir landete auch Achmed glücklich. Der Krumir aber lag regungslos im Sand. Seine ermüdete Stute war zu kurz gesprungen, und der aus dem Sattel geschleuderte Krumir hatte, mit dem Kopf zuerst aufschlagend, den Hals gebrochen. Wir banden den Toten auf sein Pferd, während Achmed Mochallah mit auf das seine nahm. Dann ritten wir unseren Gefährten entgegen. Später versenkten wir den Leib des Krumir unter die Salzkruste des Schotts Rharsa.
Donnerstag, 22. August 1867:
Wir blieben bis heute bei den Uëlad Mescheer, dann trennten wir uns von dem gastlichen Beduinen-Stamm. Achmed und Mochallah ritten mit ihrem Vater, dem Scheik Ali en Nurabi, zu den Uëlad Sedira zurück. Ich aber wollte über Sfax in meine Heimat, und Lord Percy, der mich noch ein Stück begleiten würde, wollte hinüber nach Algerien.
Dienstag, 10. September 1867:
In Sfax war in absehbarer Zeit kein Schiff nach Europa zu erwarten. Deshalb entschloss ich mich, mit einem Dampfer nach Tunis zu fahren, wo ich auf einen besseren Anschluss hoffen konnte. Hier machte ich mein Versprechen, Krüger Bei einmal in Tunis zu besuchen, schneller wahr als vorher gedacht. Draußen in Bardo, wo der ‚Herr der Heerscharen‘ seinen Sitz hatte, lernte ich auch seinen Adjutanten Selim kennen, der aber nur der alte ‚Sallam‘ genannt wurde. Krüger Bei freute sich riesig über mein unerwartetes Auftauchen. Natürlich musste ich ihn ausführlich über unser Abenteuer mit dem Krumir und dessen Ausgang informieren. Ich musste in seinem Haus Quartier nehmen und er wollte mich unbedingt länger hier behalten. Weil ich aber nach Hause wollte, erkundigte ich mich in Goletta, dem Hafen von Tunis, wann ein Schiff nach Marseille, Neapel oder Genua fahren würde, doch man konnte mir keinen konkreten Termin nennen.
Mittwoch, 11. September 1867:
Schon am frühen Morgen sah ich einen Frachtdampfer im Hafen liegen. Ich eilte hin, um mich nach dessen weiterem Reiseziel zu erkundigen. Doch nicht ein europäischer Hafen war sein nächstes Ziel, sondern Stambul in der Türkei. Am kommenden Tag, nachdem ein Teil der Fracht gelöscht und andere aufgenommen sei, werde das unter englischer Flagge fahrende Schiff wieder abdampfen. Enttäuscht kehrte ich zurück zu Krüger Bei. Sicher saß ich hier noch einige Tage fest, ohne in Richtung Heimat zu kommen. Dann aber kam mir die Idee: Warum nicht nach Stambul fahren? Ich hatte ja schon immer vor, eine Reise dorthin zu machen. Nun bot sich mir unverhofft die Gelegenheit dazu; warum sollte ich sie nicht nutzen, zumal ich ja einen Teil des Reisewegs sparen konnte? Bevor ich mein Quartier kündigte, nahm ich mit dem Kapitän des englischen Frachtdampfers Kontakt auf und dieser erklärte sich bereit, mich nach Stambul mitzunehmen. Ich solle spätestens heute Abend an Bord sein, denn schon beim ersten Morgengrauen wolle er ablegen.
Ende September 1867:
Der englische Frachter, auf dem ich mich mit Kurs auf Stambul befand, fuhr zwischen dem griechischen Festland und der Insel Kandia (Kreta) in das Ägäische Meer hinein und an den vielen größeren und kleineren Inseln vorbei, die größtenteils zu Griechenland gehörten, bevor wir den langen, engen Schlauch der Dardanellen passierten, um dann in das breitere Marmarameer einzufahren. Dahinter lag der Bosporus, der zum Schwarzen Meer hinführt. Der Kapitän erklärte mir, dass der Bosporus ungefähr siebenundzwanzig Kilometer lang sei und seine größte Breite etwa knapp zwei Kilometer betrage. Vom Schwarzen Meer her herrschte eine starke Strömung vor und jetzt im Herbst drückte ein starker Nordwind herein. Schließlich tauchte am südlichen Ende des Bosporus die Haupt- und Residenzstadt des Osmanischen Reiches, Konstantinopel, vor uns auf, von den Türken Istanbul, Stambul oder Ber-i-Veadet (Pforte des Glücks), von den türkischen Slaven auch Zarigrad (Kaiserburg) genannt. Nachdem unser Schiff in das Goldene Horn eingefahren war, legte es am nördlichen Ufer beim Stadtteil Galata an, wo der Handel und Verkehr von Konstantinopel seinen eigentlichen Brennpunkt hat.