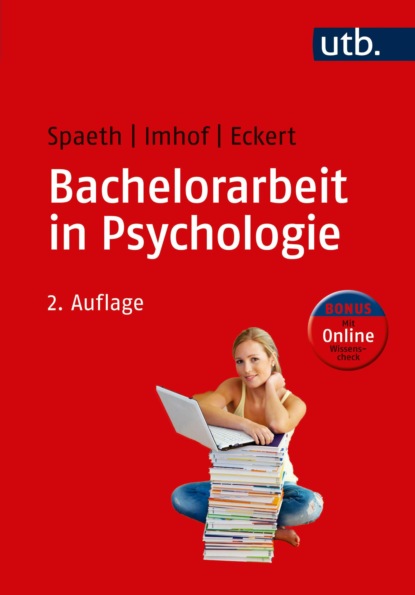- -
- 100%
- +


Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto facultas · Wien
Wilhelm Fink · Paderborn
Narr Francke Attempto Verlag / expert Verlag · Tübingen
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Ernst Reinhardt Verlag · München
Ferdinand Schöningh · Paderborn transcript Verlag · Bielefeld
Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart
UVK Verlag · München
Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
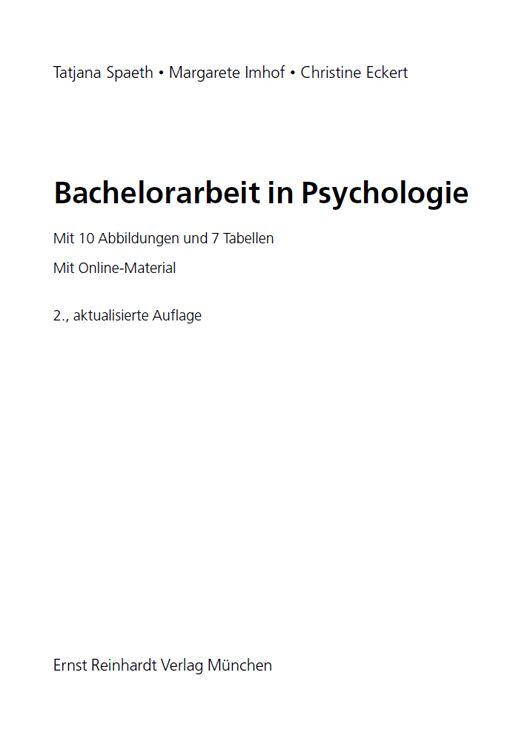
Dr. Tatjana Spaeth leitet das Zentrum für Lehrentwicklung an der Universität Ulm.
Prof. Dr. Margarete Imhof lehrt Psychologie in den Bildungswissenschaften an der Universität Mainz.
Dr. Christine Eckert lehrt Psychologie in den Bildungswissenschaften an der Universität des Saarlandes.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
ISBN 978-3-8252-5483-4 (Print)
ISBN 978-3-8385-5483-9 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-8463-5483-4 (EPUB)
2., aktualisierte Auflage
© 2020 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in EU
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
Covermotiv: © Gina Sanders, fotolia.com. Agenturfoto. Mit Model gestellt.
Satz: ew print & medien service gmbh, Würzburg
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: info@reinhardt-verlag.de
Inhalt
1 Die Bachelorarbeit
1.1 Psychologie als Wissenschaft
1.2 Wissenschaftlich arbeiten: Was bedeutet das?
1.3 Aufbau der Bachelorarbeit
1.4 Drei Beispiele für Bachelorarbeiten
1.4.1 Lernen mit Podcasts
1.4.2 Experimente im Chemieunterricht
1.4.3 Wahrnehmung von Unterrichtsstörungen
2 Die Fragestellung: Dreh- und Angelpunkt der Bachelorarbeit
2.1 Die Bedeutung der Forschungsfrage für die Bachelorarbeit
2.2 Von der Alltagsvermutung zur wissenschaftlichen Fragestellung
2.3 Von der Forschungsfrage zu den Hypothesen
2.4 Und wie geht’s weiter? Der wissenschaftliche Prozess
3 Literatur! Die theoretische Einbettung der Forschungsfrage
3.1 Die Einleitung: Was ist denn eigentlich das Problem?
3.2 Was gehört in den Theorieteil?
3.3 Exkurs: Literaturrecherche
3.3.1 Wo recherchieren?
3.3.2 Wie recherchieren?
3.4 Korrektes Zitieren in der Psychologie
3.4.1 Quellenhinweise im Text
3.4.2 Quellenhinweise im Literaturverzeichnis
4 Und wie jetzt? Methoden und Versuchspläne
4.1 Wie kommt man zu den Informationen im Methodenteil? Stichwort: Versuchsplanung
4.1.1 Echte Experimente, Quasiexperimente und Korrelationsstudien
4.1.2 Unabhängige Variablen, abhängige Variablen und Störvariablen
4.1.3 Operationalisierung von Variablen
4.1.4 Gütekriterien einer wissenschaftlichen Untersuchung
4.1.5 Was sollte man außerdem noch beachten? Ethische Grundsätze für empirische Untersuchungen
4.2 Die Überschriften im Methodenteil
4.2.1 Stichprobe und Design
4.2.2 Material
4.2.3 Ablauf
4.2.4 Kodierungen
5 Ergebnisse: Was kam raus?
5.1 Ein paar Grundregeln zum Schreiben des Ergebnisteils
5.2 Deskriptive Statistik: Daten beschreiben
5.2.1 Mittelwert und Standardabweichung
5.2.2 Range, Ausreißer, Decken- und Bodeneffekte
5.3 Inferenzstatistik: Schlussfolgerungen aus Daten ziehen
5.3.1 Signifikanz: Wie wahrscheinlich ist der Zufall?
5.3.2 Korrelation: Je mehr/weniger … desto mehr/weniger
5.3.3 t-Test: Unterschiede zwischen zwei Gruppen oder zwei Messzeitpunkten
5.3.4 Varianzanalyse: Unterschiede zwischen zwei oder mehreren Gruppen
5.3.5 Weitere statistische Tests
6 Diskussion: Ergebnisse erklären und in den wissenschaftlichen Diskurs einbringen
6.1 Welche Ziele hat der Diskussionsteil?
6.2 Wie schreiben Sie eine gute Diskussion?
7 Systematische und narrative Reviews
7.1 Systematische vs. narrative Reviews
7.2 Welche neuen Erkenntnisse kann man in einem Review gewinnen? Typische Fragestellungen
7.2.1 Welche Informationen werden ausgewertet?
7.2.2 Was soll mit dem Review bezweckt werden?
7.2.3 Wie positioniert sich der Autor/die Autorin?
7.2.4 Welche Bandbreite an Literatur wird berücksichtigt?
7.2.5 Wie ist der Text organisiert?
7.2.6 Für welche Zielgruppe ist der Text geschrieben?
7.3 Strategien für das Anfertigen von Reviews
7.4 Aufbau eines systematischen Reviews
8 Tipps zum Schluss: So klappt das Schreiben!
8.1 Tipps zum Schreiben guter wissenschaftlicher Texte
8.1.1 Was Sie schreiben: Text-Tipps
8.1.2 Wie Sie schreiben: Stil-Tipps
8.1.3 Was Sie mit dem, was Sie geschrieben haben, machen: Überarbeitungs-Tipps
8.2 Tipps für die Besprechungen mit Ihrer Betreuerin
8.3 Tipps zum Zeit- und Selbstmanagement
8.3.1 Die Grobplanung
8.3.2 Von SMARTen Zielen, Schreib-Stundenplänen und typischen Hindernissen
Literatur
Sachregister
Das Online-Material zu diesem Buch finden Sie auf den Homepages des Ernst Reinhardt Verlages und der UTB GmbH bei der Darstellung dieses Titels (Download unter: www.reinhardt-verlag.de und www.utb.de).
Hinweise zur Benutzung dieses Lehrbuches
Zur schnelleren Orientierung werden in den Randspalten Piktogramme benutzt, die folgende Bedeutung haben:






1 Die Bachelorarbeit
Mit der Bachelorarbeit schließen Sie Ihr Bachelorstudium ab. Sie stellt also einen wichtigen und bedeutsamen Schritt in Ihrer studentischen Karriere dar. Nach einem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10. Oktober 2003 dürfen Universitäten in ihren Prüfungsordnungen für Bachelorstudiengänge zwischen 6 und 12 ECTS-Punkte vergeben – der Arbeitsaufwand für die Anfertigung der Bachelorarbeit wird damit also mit 180–360 Stunden kalkuliert! In dieser Zeit sollen Sie zeigen, dass Sie in der Lage sind, eine Aufgabenstellung eigenständig durch wissenschaftliche Vorgehensweise zu lösen. Mit diesem Buch möchten wir Ihnen dabei helfen, sich auf die Aufgabe, eine Bachelorarbeit in der Psychologie anzufertigen, vorzubereiten und Sie dabei unterstützen, diese Aufgabe erfolgreich zu meistern.
Dabei richten wir uns mit diesem Werk insbesondere auch an Studierende mit Nebenfach Psychologie. Als Hauptfachstudierende mögen Ihnen daher die Informationen an der einen oder anderen Stelle sehr basal oder selbstverständlich vorkommen, da sie im Curriculum des Psychologiestudiums ihren festen Platz haben. Wir hoffen jedoch, auch Sie mit diesem Werk beim Anfertigen Ihrer Bachelorarbeit erfolgreich unterstützen zu können.
Dieses Buch führt Sie Schritt für Schritt durch die Phasen der Arbeit. Wir weisen Sie an geeigneten Stellen auf zusätzliche Materialien hin, die online verfügbar sind und die Sie dabei unterstützen, Ihr Wissen zu überprüfen, die Vorgehensweisen und Konventionen einzuüben, Ihre Schreibarbeit zu organisieren und Ihre Motivation zu stärken. Schauen Sie dort je nach Bedarf rein.
Nach diesem Kapitel …
…wissen Sie, welche Bandbreite an Forschungsthemen in der Psychologie denkbar sind.
…können Sie die wissenschaftliche Vorgehensweise in der Psychologie von der alltagspsychologischen Herangehensweise an Probleme unterscheiden.
…kennen Sie verschiedene Arten psychologischer Bachelorarbeiten.
…wissen Sie, wo Sie in diesem Buch und über weitere Quellen die wichtigsten Informationen für Ihre Bachelorarbeit finden.
…wissen Sie, wo Sie Unterstützung zur Planung, Durchführung und Organisation Ihrer Bachelorarbeit finden.
1.1 Psychologie als Wissenschaft
Couch?
Bei Psychologie denken die meisten Menschen sofort an kranke Menschen oder „Irre“;-). Die Psychologie wird als eine Art Medizin für geistige und seelische Störungen betrachtet und dabei darf in der Vorstellung auch die Couch als ultimatives Therapiegerät nicht fehlen. Doch Psychologie ist mehr:
Die Psychologie ist die Wissenschaft vom Verhalten, Denken und Erleben von Menschen.
Die Klinische Psychologie und Psychotherapie als Teildisziplin des Fachs ist dabei tatsächlich ein sehr großer Teilbereich, der innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs), der Vereinigung der in Forschung und Lehre tätigen Psychologinnen und Psychologen im deutschsprachigen Raum, die meisten Mitglieder hat.
Die Klinische Psychologie und Psychotherapie untersucht Ursachen und Bedingungen für Verhalten und Erleben, das außerhalb der Norm liegt und wie dieses durch therapeutische Maßnahmen und Interventionen günstig beeinflusst werden kann.
In der Summe weitaus größer ist jedoch die Anzahl der DGPs-Mitglieder, die sich in den anderen Teildisziplinen der Psychologie mit dem Verhalten, Denken und Erleben von Menschen beschäftigen. Die verschiedenen psychologischen Teildisziplinen zeigen sehr gut die große Bandbreite an Forschungsgebieten und -fragen auf, die in der Psychologie untersucht werden. Die Grundlagenfächer der Psychologie möchten dabei grundlegende Erkenntnisse gewinnen:
Grundlagenfächer
•Allgemeine Psychologie: Ziel ist, Erkenntnisse über grundlegende Prozesse der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, des Denkens, Sprechens, Lernens, Gedächtnisses, der Motivation und der Emotion zu gewinnen. Forschungsfragen, die in der Allgemeinen Psychologie untersucht werden, sind z. B. wie der Kontext die Gesichtererkennung beeinflusst (Meinhardt-Injac, Persike & Meinhardt, 2011).
•Biologische Psychologie und Neuropsychologie: Ziel dieses Grundlagenfachs ist es, die anatomischen, physiologischen und neuronalen Grundlagen und Bedingungen menschlichen Erlebens und Verhaltens zu untersuchen, also z. B. die Frage, welche Bereiche des Gehirns für bestimmte Aufgaben aktiv sind und wie das Gehirn bewegte Bilder verarbeitet (Berti, Haycock, Adler & Keshavarz, 2019).
•Differentielle Psychologie, Persönlichkeitspsychologie und psychologische Diagnostik: Diese Teildisziplin untersucht die individuellen Unterschiede und inwieweit diese durch relativ überdauernde Merkmale der Persönlichkeit erklärt werden können. Eine wichtige Frage ist dabei, wie diese Unterschiede gemessen werden können, wie kann z. B. ein Konstrukt wie Intelligenz oder Gewissenhaftigkeit messbar gemacht werden? Forschungsarbeiten aus dieser Teildisziplin untersuchen beispielsweise den Zusammenhang von Persönlichkeitsmerkmalen, Lernverhalten und Erfolg in Schule und Hochschule (z. B. Imhof & Spaeth-Hilbert, 2013; Spinath, Eckert & Steinmayr, 2014; Theobald, Bellhäuser & Imhof, 2018).
•Entwicklungspsychologie: Im Fokus stehen in dieser Teildisziplin Veränderungsprozesse über die Lebensspanne, also von der Zeugung bis zum Tod und wie sich in der Entwicklung das Erleben, Verhalten und Denken von Menschen verändern. Ein Beispiel für eine Forschungsfrage aus diesem Gebiet ist, wie Säuglinge lernen, Gesichter zu unterscheiden (Altvater-Mackensen, Jessen & Grossmann, 2017) oder ob bzw. wie sich die Wahrnehmung von Gesichtern über die Lebensspanne ändert (Meinhardt-Injac, Boutet, Persike, Meinhardt & Imhof, 2017).
•Sozialpsychologie: Diese psychologische Teildisziplin untersucht, wie das Verhalten, Erleben und Urteilen von Menschen durch den sozialen Kontext beeinflusst wird. Aus dieser Perspektive wird beispielsweise untersucht, wie Gruppen effektiv zusammenarbeiten (Borsch, 2005).
psychologische Anwendungsfächer
Die Anwendungsfächer der Psychologie nutzen die Erkenntnisse der Grundlagenfächer in spezifischen Kontexten:
•Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie: Dieses Anwendungsfach untersucht die Wechselbeziehungen zwischen Arbeits- und Organisationsbedingungen und menschlichem Erleben und Verhalten.
•Gesundheitspsychologie: Diese relativ junge psychologische Teildisziplin untersucht, welche Einflussfaktoren es auf die körperliche und seelische Gesundheit gibt. Eine aktuelle Frage aus diesem Bereich ist beispielsweise, inwieweit und wodurch Lehrerinnen und Lehrer Stressbelastung erleben und wie sie damit im Vergleich zu anderen Berufsgruppen dastehen (Schult, Münzer-Schrobildgen & Sparfeldt, 2014).
•Klinische Psychologie und Psychotherapie: Diese Teildisziplin haben wir ja oben bereits kurz beschrieben – meist denken Menschen vor allem an die Klinische Psychologie, wenn sie den Begriff Psychologie hören. Aktuell sind aber auch Themen wie Internet- oder Smartphone-Sucht (Duke & Montag, 2017).
•Medienpsychologie: Diese Teildisziplin untersucht menschliches Erleben und Verhalten im Zusammenhang mit der Nutzung von Medien. Eine aktuelle Forschungsfrage aus diesem Teilgebiet befasst sich mit der Effektivität von virtuellen Lernumgebungen (Makransky, Terkildsen & Mayer, 2019). Hilbert und Terrero (2012) untersuchten, wie gut Studierende aus Vorlesungsaufzeichnungen im Vergleich zur Präsenzvorlesung lernen können.
•Pädagogische Psychologie: Im Fokus dieser Teildisziplin stehen Kompetenzen, Fertigkeiten, Überzeugungssysteme und Werthaltungen, die durch pädagogische Maßnahmen beeinflusst werden können. Es geht also um das Lehren und Lernen im weitesten Sinne. Die Autorinnen dieses Buchs ordnen sich dieser Teildisziplin zu, weshalb auch viele Beispiele aus der Pädagogischen Psychologie kommen. Ein aktuell diskutiertes Thema in dieser Teildisziplin ist z. B., ob psychologische Kriterien für die Zusammenstellung von Lerngruppen Vorteile bringen (Bellhäuser, Konert, Müller & Röpke, 2018).
•Rechtspsychologie: In dieser Teildsiziplin der Psychologie wird die Anwendung psychologischer Theorien, Methoden und Erkenntnisse auf Fragestellungen, die sich aus der Ge-staltung und Anwendung des Rechts ergeben, untersucht (Goeckenjan & Oeberst, 2016).
•Umweltpsychologie: In der Umweltpsychologie geht es um die Einstellungen von Menschen zur Umwelt, wie und warum verhalten sich Menschen umweltbewusst, was denken sie über Umweltbelange?
•Verkehrspsychologie: Die Verkehrspsychologie untersucht den Menschen im Zusammenhang mit Mobilitätsfragen, aber auch hinsichtlich Verkehrstüchtigkeit und Verhalten im Verkehr (Labrie, Napper & Ghaidarov, 2012; Sullman, 2012).
Schließlich gibt es in der DGPs noch die Fachgruppe Geschichte der Psychologie, die die Entwicklung der Psychologie als eigenständige Wissenschaft nachvollzieht sowie die Methodenfächer (Fachgruppe Methoden & Evaluation der DGPs), die sich mit den Instrumenten der Erkenntnisgewinnung innerhalb der Psychologie beschäftigen.
Für die Grundlagen- und Anwendungsfächer benötigen Forscherinnen und Forscher die Erkenntnisse dieser Methodenfächer, um Daten zuihren Forschungsgegenständen zu erheben und auszuwerten, um Untersuchungen zu planen und um interpretieren zu können, inwieweit die gewonnenen Erkenntnisse verallgemeinert werden können.
empirische Wissenschaft
Die Psychologie versteht sich als eine streng empirische Wissenschaft, deshalb kommt den Methodenfächern eine ganz besonders wichtige Rolle zu.
Empirisch bedeutet, dass Erkenntnisse aus systematisch gewonnenen Erfahrungen (Daten) abgeleitet werden.
Die Methoden müssen hierfür wichtige Anforderungen erfüllen: (1) Sie müssen objektiv, also unabhängig von der Person oder den Personen sein, die die Daten sammeln und auswerten. (2) Sie müssen wiederholt anwendbar sein und (3) sie müssen nachweislich geeignet sein, den Gegenstand zu erfassen. Diese Anforderung kann nur durch eine systematische Planung und auch Dokumentation erfüllt werden. Die verwendeten Methoden folgen dabei naturwissenschaftlichen und auch sozialwissenschaftlichen Ansätzen. Vorherrschend sind quantitative Methoden, die sich auf Messungen und Skalierungen beziehen. Qualitative Forschung gibt es zu psychologischen Fragestellungen zwar auch, jedoch begegnet man dieser seltener. Mit welcher Methode auch immer: Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch Sie in Ihrer Bachelorarbeit empirisch forschen, also wissenschaftlich und strukturiert vorgehen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Aber was bedeutet wissenschaftlich arbeiten überhaupt?
1.2 Wissenschaftlich arbeiten: Was bedeutet das?
Wie wir bereits festgestellt haben, ist die Psychologie eine empirische Wissenschaft und erfordert deshalb eine systematische Vorgehensweise, die gut dokumentiert werden muss. Die wissenschaftliche Psychologie grenzt sich hier klar von der Alltagspsychologie ab.
Alltagspsychologie
Die Alltagspsychologie ist kein Teilgebiet der Psychologie. Gemeint sind damit die Erklärungen und Theorien, die Menschen zu ihrem eigenen Verhalten und dem ihrer Mitmenschen aufstellen. Das spiegelt sich in Sprichwörtern wider, wie z. B. „Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus“, mit dem erklärt wird, dass das Verhalten gegenüber anderen Personen dazu führen kann, dass sie sich entweder genauso nett verhalten oder aber genauso gemein wie ihr Gegenüber. Allgemein könnte man auch sagen, die Alltagspsychologie ist der gesunde Menschenverstand. Unsere alltagspsychologischen Kenntnisse erlauben uns häufig, uns richtig zu entscheiden und korrekte Vorhersagen zu treffen, wie sich andere Menschen verhalten werden. Warum brauchen wir aber noch eine wissenschaftliche Psychologie, wenn die Alltagspsychologie doch häufig funktioniert?
Die Alltagspsychologie basiert auf den Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen, auf dem, was wir von unseren Eltern, Lehrerinnen und Lehrern, Freunden oder anderen Personen lernen und auch auf unseren stellvertretenden Erfahrungen, die wir über Medien wie z. B. TV und Bücher machen. Schauen wir uns die Sprichwörter noch einmal an, sieht man schnell, dass sich diese teilweise auch widersprechen: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ kontradiktiert z. B. das ebenfalls bekannte „Man lernt nie aus“. Als Quelle für Entscheidungen und Erklärungen dienen Alltagsweisheiten also nur bedingt. Auch unsere eigenen Erfahrungen – oder die unserer Eltern oder TV-Helden – müssen nicht unbedingt dem entsprechen, was typisch ist.

Stellen Sie sich z. B. vor, ein Mensch hat im Jugendalter schlechte Erfahrungen mit einer unfreundlichen Person aus dem Schwäbischen (oder aus dem Sächsischen, Friesischen, mit blauen/grünen/braunen Augen, schwarzen/roten/blonden Haaren …) gemacht. Aus dieser Erfahrung leitet er die Theorie ab, dass alle Schwaben unfreundliche Menschen sind, denen man besser nicht vertrauen sollte. Obwohl ein für ihn spannender Studiengang nur an der Universität Ulm angeboten wird, entscheidet er sich deshalb für ein anderes Studienfach, Personen mit schwäbischem Dialekt gegenüber verhält er sich sehr vorsichtig und reserviert (weshalb diese denken, er wäre ein komischer Eigenbrötler und ihm eher aus dem Weg gehen) und als ihm später ein lukrativer Job in Stuttgart angeboten wird, lehnt er lieber ab, da er nicht zwischen lauter Schwaben wohnen möchte. Wenn Sie selbst Schwabe bzw. Schwäbin sind oder schwäbische Freunde haben, werden Sie jetzt vielleicht gleich sagen: „Moment mal, was soll das denn, das ist ja alles falsch, und die Schwaben sind eigentlich total nett!“ Wahrscheinlich ist, dass die Schwaben weder netter noch weniger nett sind als Bayern, Friesen oder Sachsen. Aber nur aufgrund der schlechten Erfahrungen, die unser Beispielmensch gemacht hatte, und die er alltagspsychologisch als im Wesen der „gemeinen“ Schwaben an sich begründet erklärt hatte, nimmt er sich die Chance, ein spannendes Studienfach zu studieren und einen guten Job anzutreten. Er gibt sich nicht einmal die Chance, seinen schlechten ersten Eindruck durch den Kontakt mit anderen Schwaben zu revidieren.
Wir sehen also, die eigene Erfahrung und Einzelbeispiele sind nicht unbedingt die zuverlässigste Quelle für gesicherte Theorien. Die Erfahrungen täuschen uns häufig falsche Tatsachen vor, die Datenbasis ist sehr selektiv und lückenhaft, und bei Beobachtungen und Schlussfolgerungen können uns leicht Fehler unterlaufen. Die Erfahrung als Quelle für Erkenntnisse ist außerdem anfällig für Selbsttäuschungen. In dem Beispiel war der Mensch schon so voreingenommen, wenn ihm andere Schwaben begegneten, dass er sich ihnen gegenüber misstrauisch und wortkarg gezeigt hat. Sie bestätigten seine Vorurteile, indem sie irritiert oder reserviert auf sein Verhalten reagierten.
wissenschaftliche Psychologie
Im Gegensatz zur Alltagspsychologie, die Beispiele und Erfahrungen (mehr oder weniger) plausibel interpretiert, ist es die Aufgabe der wissenschaftlichen Psychologie, möglichst zuverlässige und gültige Erkenntnisse zum menschlichen Erleben und Verhalten, wie es sich verändert und wodurch es beeinflusst ist, zu gewinnen. Das geht durch die angemessene Beschreibung, durch das Absichern mit geplanten und geeigneten Messungen. Tabelle 1.1 fasst die wichtigsten Unterschiede zwischen der Alltagspsychologie, die wir alle täglich in unserem Leben verwenden, und der wissenschaftlichen Psychologie, die gesicherte Erkenntnisse gewinnen möchte, zusammen.