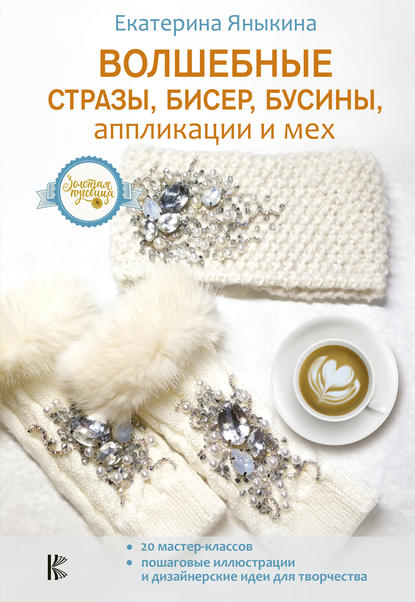Seewölfe Paket 22
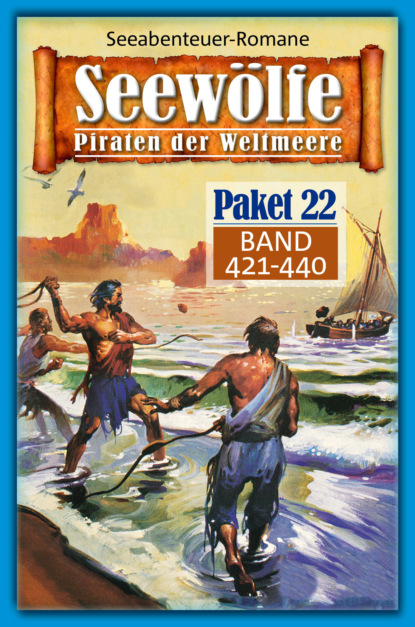
- -
- 100%
- +
John Killigrew, dieser gewalttätige Mann mit dem verschlagenen Gesicht, das eine bläulich-rote Knollennase zierte, begann hämisch zu lachen.
„Welch ein Geschwätz!“ stieß er hervor. „Was soll das ganze Theater mit dieser Gerichtsverhandlung? Natürlich habe ich den verdammten Dons ein bißchen in die Taschen gegriffen, das weiß jeder. Da ich vermeiden wollte, daß mir die anderen Gentlemen das Zeug abjagten, habe ich mich eben vom Verband abgesetzt. Na und? Was soll das ganze Hin- und Hergerede – unser Unternehmen hat eine Menge Geld gekostet, das sollte schließlich wieder reinkommen. Jeder von uns hat doch im stillen gehofft, bei der Sache den Rahm abschöpfen zu können, oder?“ Seine Augen ruckten fragend von einem zum anderen, und als er nur ablehnende Gesichter sah, zog er eine wütende Grimasse.
„Sie sind im Vergleich zu Sir Henry bemerkenswert offen, Sir John“, stellte Tottenham fest. „Sie haben soeben selber bestätigt, daß Sie sich hauptsächlich deshalb an der Jagd nach Philip Hasard Killigrew beteiligt haben, weil Sie Ihre persönlichen Geschäfte im Auge hatten. Sicherlich hatte es Ihnen dabei auch die Schatzbeute angetan, die Sir Hasard legal, im königlichen Auftrag, verwahrt.“
„Der Bastard hat doch genug Reichtümer gehortet!“ brüllte Sir John wütend. „Den hätte es nicht erschüttert, wenn wir ihm einen Teil davon abgejagt hätten.“
„Schweigen Sie jetzt!“ fuhr ihn Tottenham an. „Sonst muß ich Sie abführen lassen.“ Sofort traten zwei Männer auf den alten Killigrew zu und legten ihm die Hände auf die Schultern. Als er noch einen wilden Fluch ausstieß, packten sie ihn an den Oberarmen.
„Mit diesen Worten“, sagte Sir Edward, „haben Sie sich im Sinne der Anklage für schuldig bekannt. Indem Sie Sir Hasard selbst die Schatzbeute abjagen wollten, die er als Korsar Ihrer Majestät bis zur Übergabe zu verwalten hat, haben Sie sogar räuberisches Interesse am Eigentum der Königin bekundet.“
Sir John Killigrew murmelte abermals einen Fluch vor sich hin und bedachte Tottenham mit einem wilden Blick.
Der aber wandte sich jetzt an Charles Stewart.
„Sie, Mister Stewart“, begann er, „haben sich wegen Raubes, Meuterei und Vernachlässigung Ihrer Pflichten als Kommandant der ‚Dragon‘ zu verantworten.“
Charles Stewart hörte sich die Anklage mit einem spöttischen Grinsen an, zumal er kaum etwas zur Entkräftung vortragen konnte. Offiziere und Besatzung der „Orion“ und „Dragon“ waren Zeuge seiner verbrecherischen Handlungen geworden, daran ließ sich im Nachhinein nichts mehr ändern.
Wohl oder übel mußten sich die drei Angeklagten die weiteren Ausführungen Tottenhams, der jetzt auf die Einzelheiten einging, anhören. Lediglich Stewart und Killigrew mußten noch einmal zur Ruhe ermahnt werden.
Nach mehr als zwei Stunden zog sich das Gericht zur Beratung in die Kapitänskammer zurück, während die Angeklagten unter strenger Bewachung auf der Kuhl blieben.
Die Beratung dauerte eine knappe halbe Stunde, dann erschien das Kriegsgericht zur Urteilsverkündung. Ein kurzer Trommelwirbel wies auf das Erscheinen der Offiziere hin.
Die Mitglieder des Kriegsgerichtes zogen ernste Gesichter, als sie ihre Plätze einnahmen. Sir Henry hingegen schien noch nicht so recht an den Ernst der Sache zu glauben. Er setzte nach wie vor ein hochnäsiges Lächeln auf und warf den Offizieren überhebliche Blicke zu.
Charles Stewart stieß ein leises Knurren aus, und John Killigrew versuchte, verächtlich auf die Planken zu spucken. Er handelte sich jedoch dafür einen Rippenstoß seines Bewachers ein.
Sir Edward räusperte sich.
„Das Kriegsgericht Ihrer Majestät, der Königin von England“, sagte er mit lauter Stimme, „ist einstimmig zu dem Entschluß gelangt, daß sich die Angeklagten, Sir Henry of Battingham, Sir John Killigrew und Mister Charles Stewart, in allen Punkten der Anklage schuldig gemacht haben. Sie werden deshalb – ebenso einstimmig – zum Tod durch Erschießen verurteilt. Das Urteil ist sofort zu vollstrecken.“
Diese Worte schlugen ein wie eine Breitseite.
Besonders Sir Henry schien im Vertrauen auf seinen Adelsrang als Duke of Battingham nicht mit diesem Urteil gerechnet zu haben. Er hatte wohl geglaubt, daß es niemand wagen würde, Hand an ihn zu legen. Um so mehr schmetterte ihn jetzt dieses Urteil nieder.
Das hochnäsige Lächeln verschwand augenblicklich aus seinem Gesicht. Er wurde aschfahl, seine Lippen begannen zu beben. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn.
„Das ist ungeheuerlich!“ schrie er. „Ich bin Duke Henry of Battingham, und wer es wagt, mir auch nur ein Haar zu krümmen, wird sich in England verantworten müssen. Ich erkenne dieses Urteil nicht an!“
Auch Charles Stewart begann zu brüllen und überhäufte die Mitglieder des Kriegsgerichtes mit wüsten Flüchen und unflätigen Beschimpfungen.
Aber das alles half den drei Halunken nicht. Niemand beachtete ihre Proteste. Die Crewmitglieder, die Zeugen der Verhandlung geworden waren, trugen unbeteiligte Mienen zur Schau. Im stillen aber empfanden sie Genugtuung.
Sir Henry, Sir John und Charles Stewart waren rechtsgültig zum Tode verurteilt worden und wurden auf Befehl des Gerichts sofort auf eine Jolle gebracht. Eine weitere Jolle wurde dem Erschießungskommando zur Verfügung gestellt. Schließlich wurden die beiden Boote zum Ufer gepullt.
Wenig später dröhnten die Salven der Exekution über die Bucht. Die drei Männer, die beutelüstern und mit hinterhältigen Plänen in die Karibik aufgebrochen waren, hauchten ihr Leben unter den Schüssen des Pelotons aus. Sir Henry starb als Feigling, nämlich jammernd. Sir John und Stewart hingegen brüllten wie wilde Stiere, bevor die Kugeln sie zum Verstummen brachten.
Kurz vor der Mittagszeit hatte sich der Wolkenhimmel über den Pensacola Cays weiter verdichtet, die Schwüle nahm ständig zu. Den Männern auf den drei Schiffen brach der Schweiß aus allen Poren.
Als die beiden Jollen vom Ufer zurückkehrten, stand Sir Edward mit unbewegtem Gesicht auf dem Achterdeck und stützte sich auf den Handlauf der Querbalustrade. Nachdem man ihm den Vollzug des Todesurteils gemeldet hatte, wandte er sich Marc Corbett zu.
„Damit wurde ein weiterer Beitrag zur Wiederherstellung der Ehre Ihrer Majestät und der Ehre Sir Hasards geleistet“, sagte er.
Der Erste Offizier nickte mit ernstem Gesicht.
„Sie haben ihre Strafe verdient“, entgegnete er. „Es bleibt nur zu hoffen, daß sie dies vor ihrem Tod noch eingesehen haben.“
Sir Edward wandte sich um.
„Übernehmen Sie vorerst das Kommando, Mister Corbett. Ich werde mich für eine Weile in meine Kammer zurückziehen.“
„Aye, Sir.“
Marc Corbett blickte seinem Kapitän nach, als dieser auf die Achterdecksräume zuschritt. Sir Edward wirkte müde und erschöpft. Die Kriegsgerichtsverhandlung schien ihn ziemlich strapaziert zu haben.
Der Erste nahm die Zügel in die Hand, um zunächst dafür zu sorgen, daß alles an Bord wieder in gewohnten Bahnen verlief. Noch standen überall kleine Gruppen von Männern herum und debattierten über das Urteil. Aber es war niemand unter ihnen, der es nicht gebilligt hätte. Die gesamte Crew war sich darüber im klaren, daß die Hingerichteten den Bogen weit überspannt hatten. Alle hatten miterlebt, daß es sich nicht auszahlte, wenn man bestimmte Grenzen überschritt – selbst dann nicht, wenn man einen Adelstitel trug.
Marc Corbett gab einige Befehle, die Männer kehrten zu ihrer Arbeit zurück. Auch der Koch verholte mit seinen Helfern wieder in die Kombüse, denn es war an der Zeit, an das mittägliche Backen und Banken zu denken.
Corbett enterte wieder zum Achterdeck auf, doch dabei stoppte er abrupt seine Schritte. Irgendwo unter Deck war plötzlich ein Schuß gefallen. Das Geräusch war zwar nur gedämpft zu hören gewesen, aber er hatte es deutlich vernommen. Wenn ihn nicht alles täuschte, hatte es sich um einen Pistolenschuß gehandelt. Wer, zum Teufel, hatte diesen Schuß abgefeuert? Und warum? Marc Corbett fand dafür keine Erklärung.
Arthur Gretton, der sich noch auf dem Achterdeck aufhielt, sah Corbett fragend an.
„War das nicht ein Schuß, Mister Corbett?“
Der Erste Offizier nickte.
„Er könnte in den Achterdecksräumen gefallen sein. Wir sollten die Angelegenheit sofort überprüfen und notfalls Sir Edward Meldung erstatten.“
Die beiden Männer betraten wenig später den Gang, der das Achterkastell in zwei Hälften teilte. Doch dort war alles still, niemand schien sich in der Nähe aufzuhalten, auch die einzelnen Kammern waren leer.
„Merkwürdig“, sagte Arthur Gretton. „Vielleicht haben wir uns getäuscht.“
„Nein.“ Corbett schüttelte entschieden den Kopf. „Das war ein Schuß, daran gibt es keinen Zweifel. Am besten, wir befragen Sir Edward. Er müßte ihn ebenfalls gehört haben.“
Wenig später klopfte er an das Schott der Kapitänskammer. Aber es erfolgte keine Antwort. Sollte sich Sir Edward hingelegt haben und sofort eingeschlafen sein?
Corbett klopfte abermals, diesmal etwas kräftiger. Aber es rührte sich auch jetzt nichts. Die beiden Offiziere blickten sich fragend an.
„Sir Edward!“ rief Corbett dann. „Mister Gretton und ich möchten Sie gern sprechen!“
Alles blieb still, beinahe schon gespenstisch still.
Der Erste öffnete kurzentschlossen das Schott – und blieb wie angewurzelt stehen. Über seinen Rücken kroch ein eiskalter Schauer. Für einen Moment war er wie gelähmt.
Arthur Gretton, der ihm über die Schulter blickte, erging es nicht anders.
„Großer Gott“, murmelte er, „Sir Edward!“
In der Mitte des Raumes stand ein schwerer Eichentisch, der fest im Boden verankert war. Auf dem Stuhl davor saß Sir Edward Tottenham. Sein Oberkörper war nach vorn auf die Tischplatte gesunken. Die rechte Hand umklammerte noch den Griff einer Steinschloßpistole, aus einer Schläfenwunde sickerte Blut. Über dem Raum hing der Geruch von Pulverdampf.
Sir Edward Tottenham war tot. Die beiden Offiziere begriffen rasch, was hier geschehen war. Aber warum hatte sich ihr Kapitän eine Kugel durch den Kopf gejagt?
Mit bleichen Gesichtern näherten sie sich dem Tisch. Vor dem Toten lag ein Schriftstück, das mit einem Tintenfaß beschwert worden war.
„Er hat einen Brief hinterlassen“, murmelte Marc Corbett. „Wahrscheinlich geht daraus hervor, warum er das getan hat.“
Mit spitzen Fingern griff er nach dem Schreiben und begann mit gedämpfter Stimme vorzulesen:
„Pensacola Cays, am 30. August 1594. Was Sir Henry of Battingham, Sir John Killigrew und Mister Charles Stewart aus niedrigsten Beweggründen getan haben, verabscheue ich zutiefst und bedaure sehr, daß es überhaupt geschehen konnte. Doch diese drei Männer haben dafür mit dem Leben bezahlt. Der Gerechtigkeit wurde in ihrem Falle Genüge getan. Aber ich, Edward Tottenham, kann mich selbst von Schuld nicht freisprechen. Auch ich habe anfangs den Verleumdungen und Intrigen gegen Sir Philip Hasard Killigrew geglaubt und bin leichtfertig davon ausgegangen, daß sich tatsächlich eine schriftliche Order Ihrer Majestät in den Händen Sir Henrys oder Sir Andrews befände. Zu spät habe ich erkannt, daß ich wie die Kapitäne Rooke und Wavell dem Verband hätte den Rücken kehren sollen. Statt dessen wurde ich aus Leichtgläubigkeit, Gedankenlosigkeit und wohl auch aus Unwissenheit mitschuldig an dem, was geschehen ist. Da ich als Vorsitzender des Kriegsgerichtes darauf bestanden habe, daß die Verantwortlichen der Gerechtigkeit zugeführt werden, muß auch ich selber der Gerechtigkeit die Ehre geben und mich im Sinne der Anklage für schuldig erklären.
Ich bedaure von ganzem Herzen, daß die Intrigen, die – Gott sei’s geklagt – von England ausgegangen sind, einem Ehrenmann wie Sir Philip Hasard Killigrew beinahe das Leben gekostet hätten. Ich bitte ihn hiermit in aller Form um Vergebung.
Das Kommando über die spanische Kriegsgaleone übergebe ich hiermit meinem treuen und sachkundigen Ersten Offizier, Mister Marc Corbett, und bitte für meine Person um eine Bestattung auf See. Ich möchte nicht an Land in der Nähe jener Männer beigesetzt werden, die Englands Ehre, die Ehre Ihrer Majestät und die Ehre Sir Hasards so sehr beschmutzt haben. Ich kann leider nicht anders handeln und übernehme mit meinem Freitod die Verantwortung für das, was geschehen ist. Gott sei uns allen gnädig – Edward Tottenham.“
Die beiden Offiziere schluckten hart und schwiegen einen Moment. Dem Brief Sir Edwards war nichts mehr hinzuzufügen. Er hatte sich als ein Mann von Ehre erwiesen und als einziger freiwillig die Verantwortung übernommen. Obwohl sie den Schritt, den er getan hatte, sehr bedauerten, empfanden sie in diesem Augenblick einen tiefen Respekt vor diesem Mann.
Einige hatten es als Vorzeichen betrachtet, daß an diesem Tag düstere Wolken am Himmel aufgezogen waren, und fühlten sich jetzt in ihren Ahnungen bestätigt.
Auf den Decks der ehemals spanischen Galeone herrschte eine bedrückende Stille. Die Männer sprachen nur mit gedämpfter Stimme. Sie alle waren erschüttert von der Nachricht, die Marc Corbett übermittelt hatte.
Auch auf der „Caribian Queen“ und der „Isabella IX.“ hatte man die Kunde mit Betroffenheit vernommen.
Der Seewolf, der gerade mit Siri-Tong und Ben Brighton einige Pläne für die nächste Zukunft besprochen hatte, lehnte sich erschöpft in die Kissen zurück.
„Sir Edward hat wie ein Ehrenmann gehandelt“, sagte er mit nachdenklichem Gesicht. „Schade, daß er nicht mehr am Leben ist. Es wäre ein Segen für England, wenn es noch mehr solche Männer gäbe.“
Bereits am nächsten Tag, dem 1. September im Jahre des Herrn 1594, herrschte in der stillen Bucht Aufbruchsstimmung. Während die Galeone der Engländer unter dem Kommando Marc Corbetts die Anker lichtete, um nach England zurückzusegeln und die sterblichen Überreste Sir Edwards auf See zu bestatten, nahmen die „Caribian Queen“ und die „Isabella“ Kurs auf die Schlangen-Insel …
ENDE
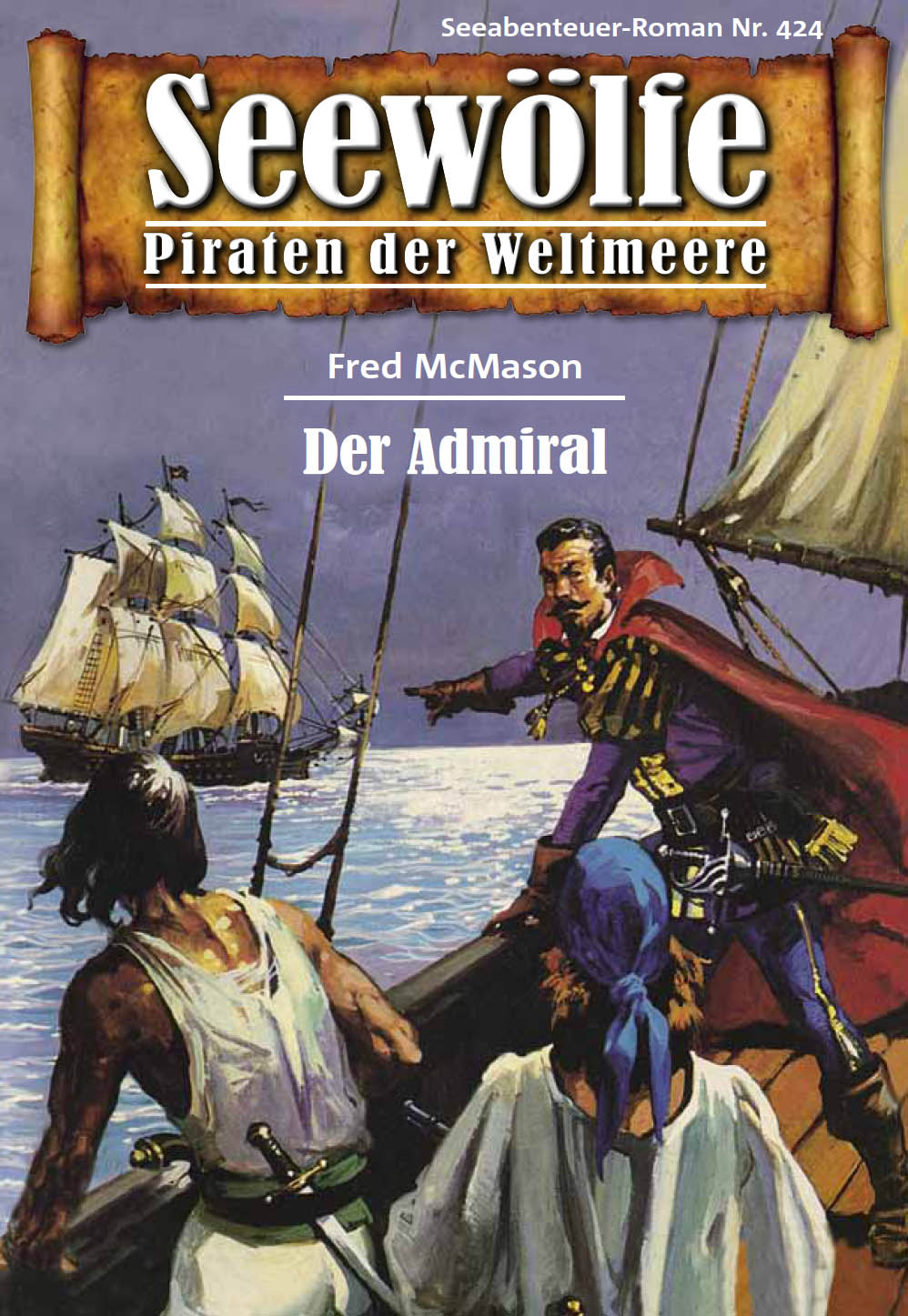
1.
Schlangen-Insel, 29. September 1594.
Es war ein Bilderbuchsonntag mit strahlendem Sonnenschein, wohliger Wärme und leisem Rauschen der See, die an die Felsen der Insel schlug.
Auf der Werft des alten Ramsgate wurde heute nicht gearbeitet. Die Männer hatten ihren freien Tag und vertrieben sich die Zeit mit Angeln in der Bucht, Streifzügen über die Insel oder Faulenzen. Ein paar, Unentwegte hockten oben in den Felsen in „Old Donegals Rutsche“, tranken kaltes Bier und palaverten.
Es gab kaum etwas zu tun.
Hasard war von der Schußwunde in den Rücken, die er von Sir Andrew Clifford heimtückischerweise erhalten hatte, wieder genesen und fühlte sich wohl.
Don Juan de Alcazar war mit seiner Crew und der Schebecke nach Spanien aufgebrochen. Dort wollte er über befreundete Mittelsmänner bei Hofe Anklage gegen den Gouverneur von Kuba, Don Antonio de Quintanilla, erheben und ihn auf diese Weise zur Strecke bringen.
Ein neues Schiff hatte der Bund der Korsaren ebenfalls dazugewonnen.
Es war die „Lady Anne“, die Karavelle des alten Schnapphahns Sir John Killigrew, der sein ruchloses Leben ebenso ausgehaucht hatte wie Sir Henry, Duke of Battingham, und Charles Stewart, der ehemalige Kommandant der „Dragon“. Ihr Leben hatte vor den Musketenläufen eines Pelotons englischer Seesoldaten ein Ende gefunden.
Auch die Goldladung der „Santa Cruz“, die sich Sir John unter den Nagel gerissen hatte, aber von Jean Ribault und seinen Mannen mit der „Lady Anne“ sicher zur Schlangen-Insel gebracht worden war, ruhte bereits in den unterirdischen Schatzhöhlen der Insel. So war alles wieder im Lot, und es herrschte prächtige Stimmung.
Auf der „Isabella“ hockten ein paar Seewölfe unter dem Sonnensegel auf der Kuhl und lauschten grinsend den Worten des Profos’ Edwin Carberry, der heute ganz besonders gute Laune hatte und groß an Deck herumtönte und haarsträubende Geschichten erzählte.
Der Kutscher blickte andächtig und mit starren Blicken pausenlos in den azurblauen Himmel, bis es dem Profos auffiel.
„Was stierst du so?“ fragte er. „Siehst du etwa quergestreifte Affenärsche am Himmel hängen?“
„Nein“, sagte der Kutscher ernst. „Ich sehe nur nach, ob der Himmel auch weiterhin so blau bleibt.“
„Klar bleibt er das. Warum auch nicht?“
„Nun, es gibt Leute, die lügen einfach das Blaue vom Himmel herunter, und dann wird er schwarz.“
„Du willst mir doch nicht den schönen Sonntag verderben, was, wie?“ fragte der Profos sanft. „Stell dir mal vor, wir müßten heute noch zur Beerdigung eines gewissen Kutschers. Das wäre doch ein recht betrüblicher Tag, vor allem für den gewissen Kutscher, der dann seinen letzten Knödel gebacken hätte.“
„Noch ist der Himmel ja blau“, sagte der Kutscher vorsichtig.
„Na, siehst du!“ entgegnete der Profos mit seiner durchschlagenden Logik. „Ein Zeichen, daß ich nichts als die Wahrheit sage und alles stimmt.“
„Auch, daß du Kakerlaken gejagt hast, die dreimal größer als Ratten waren?“
„Na klar!“
„Und die Art, wie du grüne Affen gefangen hast, stimmt auch?“
„Selbstverständlich. Ich habe mich in den Urwald gestellt und immer wieder die Stiefel an- und ausgezogen. Die Affen wurden schon ganz neugierig, und sie heißen ja auch deshalb Affen, weil sie alles nachäffen. Dann habe ich Kleister in die Stiefel gefüllt und sie einfach stehenlassen. Schwupp, war der erste Affe da, zog sich die Stiefel an und klebte fest. Ich brauchte ihn nur noch aus den Latschen zu pflücken.“
„Beachtlich“, murmelte der Kutscher, „sehr beachtlich. Und wie hast du den Kleister wieder aus den Stiefeln entfernt?“ fragte er hinterhältig.
„Ja, wie war das doch gleich? Ach ja, einer der Affen ist mit den Stiefeln einfach abgehauen. Wie er den Kleister wieder herausgekriegt hat, war ja nicht mein Problem, oder?“
„Ganz recht. Das war ein Affenproblem. Sicher latscht er heute noch in den Stiefeln herum.“
„Genau. Solltest du mal einem gestiefelten Affen begegnen, dann weißt du sofort, was los ist.“
Die anderen grinsten bis an die Ohren und lauerten darauf, daß der Profos-Kutscher-Dialog ernsthaftere Formen annahm. Doch der Dialog wurde plötzlich unterbrochen, denn Jean Ribault näherte sich der „Isabella“. Auch er schien ausnehmend gute Laune zu haben – wie all die anderen. Er trug eine zusammengedrehte Rolle unter dem Arm. In der Hand hatte er etwas, das im Sonnenlicht immer wieder grell aufblitzte. Es schien ziemlich schwer zu sein.
„Ist es gestattet und so weiter?“ fragte er grinsend.
„Aber gewiß doch, mein lieber Jean“, sagte der Profos ebenfalls grinsend. „Bringst du jetzt schon dein Zehrgeld mit, oder ist das etwa kein Goldbarren, den du uns großzügig als Geschenk anbietest, damit wir ihn umgehend versaufen können?“
Ribault setzte sich auf die Kuhlgräting und legte den Goldbarren auf die Planken.
„Ein schöner Barren! Oder nicht?“ fragte er.
„Doch“, bestätigte der Profos, „sehr schön. Was meint ihr?“
Die anderen fanden den Barren auch sehr schön, aber auch gleichzeitig etwas langweilig, denn sie hatten schon einige dieser Barren gesehen, gleich tonnenweise, wie sie versicherten.
Smoky nahm ihn schließlich der Höflichkeit halber in die Hand, drehte ihn um und legte ihn wieder hin.
„Richtig goldig“, sagte er grinsend. „Und schwer ist er auch.“
„Sonst fällt dir nichts auf?“ fragte der Franzose.
Keinem fiel etwas auf. Ein Goldbarren – na und? Die gab es in den unterirdischen Höhlen der Insel wie Sand am Meer.
„Doch – er glänzt so schön“, sagte Paddy Rogers. „Aber ein Pfannkuchen von diesem Gewicht wäre mir lieber.“
„Na, ihr glänzt heute nicht gerade“, sagte Jean seufzend. „Erzählt nur weiter euren Stuß. Ist euer Kapitän an Bord?“
Carberrys mächtiger Daumen wies nach achtern. Daraufhin setzte sich der Franzose in Bewegung.
„Käse“, sagte Ed, womit er den Goldbarren meinte. „Habe ich euch schon mal erzählt, wie mir damals die Großrah auf den Schädel fiel und glatt zersplitterte?“
„Nee, noch nicht“, sagte Jeff Bowie, „du hast nur erzählt, wie du den abgefeuerten Siebzehnpfünder mit den Händen gefangen hast. Und dabei sind dir nur die Flossen ein bißchen warm geworden.“
Inzwischen trat Ribault bei Hasard ein. Er fand den Seewolf bei bester Laune vor und begrüßte ihn freudig.
„Noch Beschwerden, Sir?“ fragte er, auf Hasards Rücken deutend.
„Nein, mir geht es wieder prächtig, Jean. Setz dich.“
Ribault nahm lächelnd Platz. Den Goldbarren legte er wie provozierend auf den schweren Tisch, die gerollte Karte direkt daneben.
„Aha“, sagte Hasard, auf den Goldbarren deutend, „soll das dein Sonntagsgeschenk sein?“
„Er stammt aus der Beute der ‚Santa Cruz‘. Sei bitte so gut und sieh ihn dir etwas genauer an. Deinen Arwenacks ist nichts aufgefallen, aber vielleicht fällt dir etwas auf.“
Hasard nahm den Barren verwundert zur Hand und betrachtete ihn. Er wußte zwar nicht, was an dem Barren dran sein sollte, aber er drehte ihn um und prüfte ihn.
Als er den Barren umgedreht hatte, fiel ihm ein Prägestempel auf. Jetzt blickte er mit zusammengekniffenen Augen genauer hin. Der Stempel war rund und um den Rand herum beschriftet.
Halblaut las er die Worte vor und übersetzte sie gleich aus dem Lateinischen: „Philipp der Zweite, König von Spanien und Westindien.“
„Richtig“, sagte Jean. „Quer über die Mitte ist aber noch ein anderes Wort eingeprägt.“
„Potosi steht da“, sagte Hasard. „Na und? Was ist das Besondere daran?“
Ribault verdrehte die Augen, blickte an die getäfelte Decke und ließ sich gleichzeitig ein wenig zurücksinken. Dann sah er wieder Hasard an, wobei er tief Luft holte.
„Weißt du nicht, wer oder was Potosi ist?“ fragte er verwundert. „Oder hast du heute deinen schlechten Tag, Sir?“
„Im Gegenteil“, versicherte Hasard freundlich. „Ich fühle mich ausgesprochen wohl. Das verpflichtet mich jedoch nicht, zu wissen, wer oder was Potosi ist. Ich habe es nie gehört.“
„Hm, wenn das so ist … Ich habe mich mit diesem Problem bereits beschäftigt, als ich mit Sir Johns ‚Lady Anne‘ zurückkehrte.“
„Demnach ist Potosi also ein Problem.“
„So kann man es sehen.“ Ribault hatte jetzt wieder sein verwegenes Grinsen drauf, ein Grinsen, das Hasard nur allzugut kannte. Der Kerl heckt wieder einmal etwas aus, dachte er.
„Ich habe mich sogar eingehend damit beschäftigt“, gab Ribault zu. „Dabei stieß ich auf etwas ganz Erstaunliches: Sobald die Spanier in der Neuen Welt irgendwo Gold- oder Silbervorkommen entdeckten, errichteten sie gleich an Ort und Stelle Münz- oder Scheideanstalten.“
„Ganz richtig, Jean, das ist mir bekannt.“
„Nun, da wurden also gleich Gold- und Silbermünzen geschlagen oder geprägt, aber es wurden auch die Barren gegossen und mit dem königlichen Stempel versehen, um auf diese Weise kundzutun, daß sie durch den Stempel Eigentum Seiner Allerkatholischsten Majestät seien.“
„Stimmt auch“, sagte Hasard lächelnd, „nur nehmen die ehrenwerten Señores in den Münzanstalten die Sache mit dem königlichen Eigentum nicht so genau. Sie stopfen sich gleich an der Quelle die Taschen voll.“
„Sehr richtig. Und weil wir gerade bei diesen ehrenwerten Señores sind – jene, die das edle Metall in dieser oder jener Form transportieren, langen auch noch einmal kräftig zu. Und auch die Kapitäne der nach Spanien zurücksegelnden Galeonen rupfen noch ein bißchen an dem Gold und Silber herum. Den letzten Aderlaß gibt es dann in Sevilla, wenn die kostbare Ladung endlich an Ort und Stelle ist. Die Beamten der Casa wollen natürlich auch nicht leer ausgehen, und so greifen auch sie noch einmal zu. Der Rest des Edelmetalls fällt dann, ziemlich gefleddert, Seiner Allerkatholischsten Majestät zu.“
Hasard lächelte, genau wie Ribault auch. Er goß seinem alten Kampfgefährten funkelnden Rotwein in ein Kristallglas und schob es zu ihm hinüber. Beide Männer tranken sich grinsend zu.
„Und wo liegt jetzt das Problem?“ fragte der Seewolf.
„In Potosi. Das ist nämlich jener Ort, wo die Dons das Gold in Barren gegossen haben, und genau diese Barren sollte die Galeone ‚Santa Cruz‘ nach Spanien bringen. Was da auf dem Tisch liegt, ist also ein Goldbarren aus Potosi. Die Ladung hatte sich Sir John unter den Nagel gerissen, und jetzt haben wir sie.“