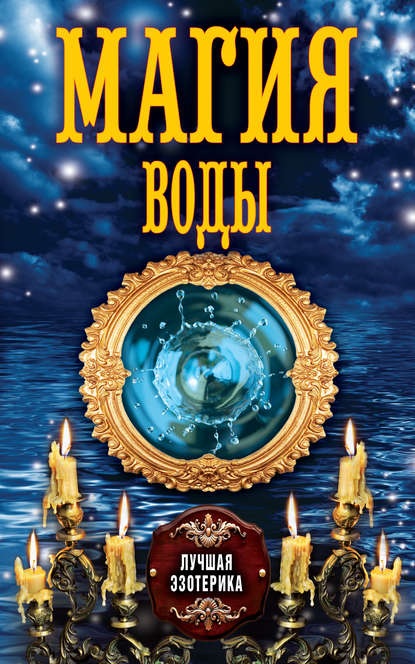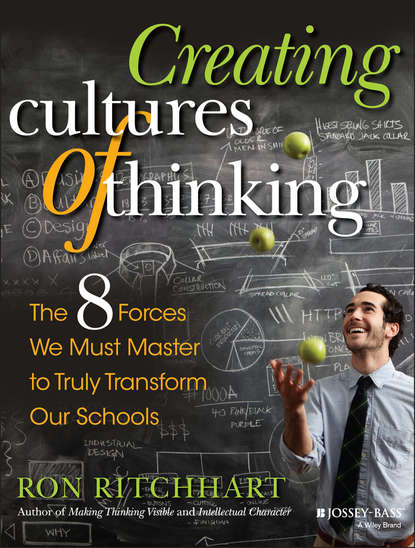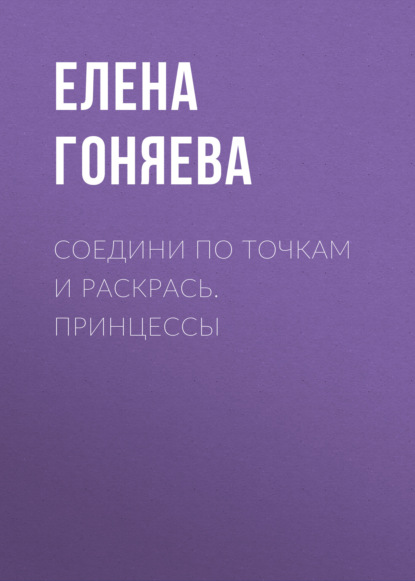- -
- 100%
- +
Der Auftragnehmer sollte neben der Schlussrechnung {Schlussrechnung} eine gesonderte schriftliche Fertigstellungsmitteilung versenden. Es empfiehlt sich die Schriftform, um im Streitfall besser Beweis führen zu können. Wer schreibt, der bleibt!
Eine fiktive Abnahme liegt auch dann vor, wenn der Auftraggeber eine abnahmereife Leistung in Gebrauch genommen hat. Wird keine Abnahme verlangt und ist nichts anderes vereinbart, gilt die Leistung nach Ablauf von sechs Werktagen als abgenommen. Von einer fiktiven Abnahme kann nicht ausgegangen werden, wenn der Auftraggeber die Abnahme berechtigterweise – ausdrücklich – verweigert. Hier hat der Auftraggeber seinen entgegenstehenden Willen eindeutig zum Ausdruck gebracht.
Gemäß § 12 Abs. 5 Nr. 2 Satz 2 VOB/B gilt die Weiterführung der Arbeiten für sich noch nicht als Abnahme. Beginnt der Generalunternehmer also nach Fertigstellung des Rohbaus mit dem Innenausbau, liegt darin noch keine Abnahmefiktion {Abnahmefiktion} gem. § 12 Abs. 5 Nr. 2 VOB/B vor. Auch bei der fiktiven Abnahme müssen Mängel vorbehalten werden. Dies muss spätestens zwölf Werktage nach schriftlicher Fertigstellungsmitteilung oder sechs Werktage nach Inbenutzungnahme {Inbenutzungnahme} erfolgen (§ 12 Abs. 5 Nr. 1 und Nr. 2 VOB/B). Zwar ist der Vorbehalt nicht formgebunden. Es empfiehlt sich jedoch die Schriftform {Schriftform} (Nachweisprobleme). Wiederum gilt: Wer schreibt, der bleibt!
Die fiktive Abnahme kann durch Regelungen im Vertrag (etwa durch Vereinbarung der förmlichen oder schriftlichen Abnahme) abbedungen werden. Auf eine vereinbarte, förmliche Abnahme kann jedoch stillschweigend verzichtet werden.
Siehe auch:

Gemäß § 12 Abs. 5 VOB/B ist eine fiktive Abnahme bei einem gekündigten VOB/B Vertrag ausgeschlossen (vgl. BGH BauR 2003, 689).
Fiktive Abnahme {Abnahme, fiktive} beim BGB-Werkvertrag?
Vor dem 01.01.2018 war die fiktive Abnahme im BGB nicht geregelt. Oftmals versuchten Auftragnehmer, in AGB durch entsprechende Klauseln diese Art der fiktiven Abnahme auch in den BGB-Bauvertrag zu übertragen.
So fanden sich oftmals in Fertighausverträgen, bei denen die VOB/B nicht wirksam vereinbart war, folgende Klauseln: „Bezieht der Bauherr das Gebäude vor der Abnahme, so gilt das Werk mit Ablauf von zwölf Werktagen als abgenommen.“
Derartige Klauseln sind jedoch AGB-widrig {AGB-widrig} und daher unwirksam. Sie verstoßen gegen das Klauselverbote §§ 309 Nr. 8b ff. BGB, weil es beim BGB-Vertrag bislang gerade keine Abnahmefiktion durch Inbenutzungnahme {Inbenutzungnahme} gab. Sie haben das Ziel, das gesetzliche Leitbild des BGB zulasten des Auftraggebers einseitig abzuändern. Hierdurch wird der Auftraggeber jedoch unangemessen benachteiligt (vgl. OLG Hamm, Az. 12 U 29/93).
Nunmehr ist die fiktive Abnahme allerdings auch im BGB-Vertrag in § 640 BGB geregelt. Mit dem 01.01.2018 wurde hier der neue Abs. 2 eingeführt. Demnach gilt das Werk als abgenommen, wenn der Unternehmer dem Besteller eine angemessene Frist zur Abnahme setzt und der Besteller die Abnahme nicht innerhalb dieser – angemessenen – Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert.
Ist der Besteller ein Verbraucher {Verbraucher}, so ist weitere Voraussetzung, dass der Unternehmer den Besteller zusammen mit der Aufforderung auf die Folgen einer nicht erklärten oder ohne Angabe von Mängeln verweigerten Abnahme hingewiesen hat. Dieser Hinweis muss in Textform {Textform} erfolgen, kann also nicht mündlich geschehen. Für die Mitteilung ist der Unternehmer im Zweifel beweispflichtig.

{Abnahme, förmliche}
Die förmliche Abnahme ist oftmals in Bauverträgen ausdrücklich vereinbart. Fehlt eine solche Vereinbarung, ist jedoch die VOB/B Grundlage des Bauvertrags, ergibt sich die Verpflichtung zur förmlichen Abnahme aus § 12 Abs. 4 VOB/B, wenn eine Vertragspartei dies verlangt. Im BGB ist eine förmliche Abnahme nicht vorgesehen, aber unter Nachweisgesichtspunkten anzuraten.
Über die förmliche Abnahme wird ein Protokoll gefertigt, in dem die festgestellten Mängel aufgeführt werden. Eine Vertragsstrafe muss ebenso vorbehalten werden, wenn sie nicht verfallen soll. Ein Anerkenntnis der vorbehaltenen Mängel oder der Vertragsstrafe ist durch die Aufnahme in das Abnahmeprotokoll {Abnahmeprotokoll} nicht gegeben – selbst dann nicht, wenn der Auftragnehmer das Abnahmeprotokoll vorbehaltlos unterschreibt.
Der Auftragnehmer sollte dennoch Mängel, die er nicht anerkennt, entsprechend im Protokoll vermerken (§ 12 Abs. 4 Nr. 1 Satz 4 VOB/B).
Oftmals findet eine förmliche Abnahme nicht statt, weil sie vergessen wird oder der Auftraggeber auf das Verlangen des Auftragnehmers nicht reagiert. Das Schweigen des Auftraggebers kann als Verzicht {Verzicht, auf Abnahme} auf die förmliche Abnahme gewertet werden. Dies gilt auch dann, wenn im Vertrag für Vertragsänderungen die Schriftform vorgesehen ist. Es müssen jedoch konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen.
Beispiele für einen solchen Verzicht: Der Auftragnehmer reicht die Schlussrechnung ein, der Auftraggeber prüft sie, Sicherheiten werden ausgetauscht, es wird bezahlt. Mängel werden nicht gerügt.
In vielen Subunternehmerverträgen {Subunternehmerverträge} ist geregelt, dass der Nachunternehmer {Nachunternehmer} die Abnahme erst verlangen kann, wenn das Gesamtvorhaben fertiggestellt ist oder der Nachunternehmer eine Mangelfreiheitsbescheinigung {Mangelfreiheitsbescheinigung} beibringt – die Abnahme im Nachunternehmerverhältnis wird also von der Abnahme im Verhältnis Auftraggeber zu Hauptunternehmer {Hauptunternehmer} abhängig gemacht. Beide Klauseln sind AGB-rechtlich unwirksam, da die den Nachunternehmer unangemessen benachteiligen.
Auch eine Klausel, die als Abnahmevoraussetzung {Abnahmevoraussetzung} eine behördliche Gesamtabnahme verlangt, ist unwirksam. Auf derartige Klauseln sollte bereits bei der Vertragsverhandlung geachtet werden.


{Abnahme, konkludente}
Häufig wird die konkludente Abnahme auch als stillschweigende Abnahme {Abnahme, stillschweigende} bezeichnet. Gibt der Auftraggeber durch sein Verhalten – konkludent – zu erkennen, dass er die fertige Leistung als im Wesentlichen vertragsgemäß und mangelfrei anerkennt, so liegt auch ohne explizite Erklärung eine rechtsgeschäftliche Abnahme vor. Dies kann beispielsweise durch Inbetriebnahme des Bauwerks bzw. der Anlage oder durch Erteilung der Schlussrechnung durch den Auftragnehmer und deren anstandslose Bezahlung durch den Auftraggeber erfolgen. Eine konkludente Abnahme scheidet jedoch i. d. R. aus, wenn ausdrücklich eine förmliche Abnahme vereinbart oder der Auftraggeber beim VOB-Vertrag diese ausdrücklich verlangt (Ausnahme: siehe


Im Rahmen von Leistungsketten (Bauherr – Bauunternehmer – Subunternehmer) stellt die rechtsgeschäftliche Abnahme {Abnahme, rechtsgeschäftliche} zwischen Bauherrn und Bauunternehmer nicht automatisch die Abnahme zwischen Bauunternehmer und Subunternehmer dar – auch nicht stillschweigend. Dies gilt auch dann, wenn der Bauherr die Gesamtleistung eines Generalunternehmers {Generalunternehmer} abnimmt. Alleine der Einzug in ein mit Mängeln behaftetes Einfamilienhaus stellt noch keine stillschweigende Abnahme dar, wenn der Bauherr ausdrücklich die Ablehnung der Abnahme erklärt. Zu so einem Fall kann es kommen, wenn der Bauherr etwa seine Mietwohnung gekündigt hat und quasi einziehen musste. Aus diesem Zwang kann kein Abnahmewille des Auftraggebers hergeleitet werden.
Die Rechtsprechung billigt dem Bauherrn hier auch eine gewisse Prüfungsfrist zu. Die Länge dieser Frist hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, insbesondere von der Komplexität der Werkleistung. Eine stillschweigende Abnahme durch Inbenutzungnahme {Inbenutzungnahme} liegt auch dann nicht vor, wenn der Auftraggeber vor Einzug die Abnahme der Bauleistung verweigert hat, die Abnahmeverweigerung aber nach Einzug nicht mehr wiederholt – sofern der Unternehmer zwischenzeitlich keine Mangelbeseitigungsarbeiten durchgeführt hat.
Hat der Auftragnehmer trotz Fristsetzung vorhandene Mängel nicht beseitigt und ist der Auftraggeber berechtigt, die Mängel selbst auf Kosten des Auftragnehmers zu beseitigen, wird der Werklohnanspruch des Auftragnehmers trotz fehlender Abnahme fällig, da das Nachbesserungsrecht {Nachbesserungsrecht} des Auftragnehmers entfallen ist. Der Werklohn ist allerdings entsprechend gemindert.
Siehe auch:


Das BGB-Werkvertragsrecht kennt die Teilabnahme {Teilabnahme} nicht. Daran hat sich auch durch das neue Bauvertragsrecht zum 01.01.2018 nichts geändert.
Hingegen ist in § 12 Abs. 2 VOB/B ein Anspruch auf eine Teilabnahme für in sich abgeschlossene Teile der Leistung enthalten. In sich abgeschlossene Teile sind dann gegeben, wenn sie als funktional selbstständig und unabhängig anzusehen sind und sich in ihrer Gebrauchsfähigkeit beurteilen lassen. Da hierfür die Anforderungen sehr hoch sind, ist nur in Ausnahmefällen eine „in sich abgeschlossene Teilleistung {Teilleistung}“ anzunehmen. In der Regel sind Leistungsteile innerhalb eines Gewerks keine in sich abgeschlossene Teile der Leistung {Leistung, in sich abgeschlossener Teil}.
In sich nicht abgeschlossene Teile der Leistung können abgenommen werden, wenn sie durch die weitere Ausführung der Nachprüfung entzogen werden und so eine spätere Abnahme nicht möglich ist (§ 4 Abs. 10 VOB/B).
Liegen in sich abgeschlossene Teile der Leistung vor, kann eine „echte Abnahme“ mit allen rechtlichen Folgen verlangt und durchgeführt werden. In den Fällen des § 4 Abs. 10 VOB/B handelt es sich hingegen nicht um eine „echte Abnahme“. Es erfolgt lediglich eine technische Abnahme, die zu Beweissicherungszwecken {Beweissicherungszweck} erfolgt und sich auf die tatsächlichen Gegebenheiten bezieht, die für die spätere Prüfung der Leistung von Bedeutung sind.
Die rechtlichen Wirkungen der Abnahme treten im Falle des § 4 Abs. 10 VOB/B erst ein, wenn entweder nach § 12 Abs. 1 VOB/B das Gesamtwerk oder nach § 12 Abs. 2 VOB/B ein in sich abgeschlossener Teil der Leistung, in welchem die vorzeitig technisch abgenommene Leistung liegt, abgenommen wird.
Siehe auch:

Eine Heizungsanlage ist ein in sich abgeschlossener Teil eines Bauwerks, nicht jedoch ein Stockwerk eines mehrgeschossigen Gebäudes. Die Heizungsanlage ist – im Gegensatz zu einem Stockwerk – funktional selbstständig und unabhängig. Sie lässt sich auch – selbst wenn das Hauptgewerk noch nicht abgeschlossen ist – in ihrer Funktionsfähigkeit prüfen. Gleiches gilt beispielsweise für Klimaanlagen, Aufzüge etc.

{Abnahme, technische}
Die technische Abnahme ist ebenfalls von der rechtsgeschäftlichen Abnahme {Abnahme, rechtsgeschäftliche} zu unterscheiden. Es handelt sich um eine Prüfung unter technischen Gesichtspunkten zur Vorbereitung der rechtsgeschäftlichen Abnahme und damit lediglich um eine Vorbereitungshandlung. Die Abnahmewirkungen {Abnahmewirkung} treten durch sie nicht ein. Es ist also immer noch eine eigenständige rechtsgeschäftliche Abnahme erforderlich. Eine technische Abnahme erfolgt meist im Rahmen der Objektüberwachung des Architekten unter Mitwirkung anderer an der Planung und der Überwachung fachlich Beteiligter.
Wichtig für die Praxis: Die Abnahmewirkungen treten erst mit der rechtsgeschäftlichen Abnahme ein. Dies gilt auch für die Fälligkeit der Vergütung {Vergütung, Fälligkeit der} sowie für den Lauf der Verjährung der Mängelansprüche. Eine anderslautende – falsche – Ansicht ist leider in der Baupraxis weit verbreitet.
Oftmals finden sich auf Protokollen Vermerke wie „Begehung zur technischen Abnahme“ o. Ä. Sollte es sich tatsächlich um eine rechtsgeschäftliche Abnahme handeln, so ist darauf zu achten, dass dies auch entsprechend auf dem Protokoll vermerkt ist. Ansonsten ist Streit vorprogrammiert.

{Abnahmebefugnis}
Grundsätzlich muss der Auftraggeber die Abnahme selbst durchführen. Nur er ist abnahmebefugt, da die Abnahme eine Hauptpflicht {Hauptpflicht, des Auftraggebers} des Auftraggebers darstellt. Er kann sich jedoch durch andere Personen vertreten lassen. Der Auftragnehmer muss unbedingt sicherstellen, dass die Person, die die Abnahme auf Auftraggeberseite durchführen will, auch dazu bevollmächtigt ist. Eine Abnahme durch eine nicht bevollmächtigte Person ist unwirksam. Die Abnahmewirkungen {Abnahmewirkung} treten nicht ein. Dies hat für den Auftragnehmer weitreichende Folgen, da der Werklohn nicht fällig wird und auch die Gefahrtragung und die Beweislast für die Mangelfreiheit beim Auftragnehmer verbleiben.
Relevant in der Praxis sind die Abnahmen durch den Architekten, den Bauleiter, die Behörden und öffentliche Auftraggeber.
Siehe hierzu:


{Abnahme, durch Architekt}
Wie einen Architekten kann der Bauherr auch einen Sachverständigen mit der Abnahme {Abnahme, durch Sachverständigen} beauftragen. Es ist jedoch darauf zu achten, und dies sollte ggf. schriftlich nachgewiesen werden, dass der Sachverständige auch zur Abnahme bevollmächtigt ist. Idealerweise nimmt der Auftragnehmer eine Kopie der Vollmacht {Vollmacht} zu seinen Akten – wiederum unter Nachweisgesichtspunkten –, um für einen eventuellen späteren Streit „gerüstet“ zu sein, da die Beweispflicht {Beweispflicht} hier beim Auftragnehmer liegt.

Ist der Architekt mit der Bauüberwachung {Bauüberwachung} (Leistungsphase 8) beauftragt, stellt dies nicht zugleich eine Vollmacht zur rechtsgeschäftlichen Abnahme für den Auftraggeber dar. Hierzu bedarf es einer ausdrücklichen gesonderten Vollmacht. Der Auftragnehmer muss hierauf achten und sich ggf. Nachweise vorlegen lassen.
Entsendet der Bauherr zu einer förmlichen Abnahme seinen Architekten, bringt er damit zum Ausdruck, dass der Architekt bevollmächtigt ist, die Abnahme zu erklären. Die entsprechende Vollmacht kann auch durch schlüssiges Verhalten erteilt werden. Um späteren Streit zu vermeiden, sollte sich der Auftragnehmer jedoch auch hier vergewissern, dass eine entsprechende Vollmacht gegeben ist.
Der Bauherr kann sich nicht auf die fehlende Vollmacht {Vollmacht} und die fehlenden Abnahmewirkungen berufen, wenn der Architekt während der Bauphase die Aufsicht führte und er für den Auftraggeber die gesamte Vertragsabwicklung übernommen hat. Hat sich die Tätigkeit des Architekten nicht nur auf die technische Beurteilung bezogenen und stehen auch sonstige Gründe nicht entgegen, ist ggf. von einer Rechtsscheinvollmacht des Architekten auszugehen. Wegen der bestehenden Unsicherheiten sollte sich der Auftragnehmer hierauf jedoch nicht verlassen.
Diese Ausführungen gelten für die Abnahme {Abnahme, durch Bauleiter} durch den Bauleiter entsprechend.
Die Abnahme für einen öffentlichen Auftraggeber kann grundsätzlich von einem insoweit zuständigen Beamten des Bauamts durchgeführt werden. Eine Erklärung des Bürgermeisters, seines Stellvertreters oder des Gemeindedirektors ist nicht erforderlich.
In der HOAI ist die technische Abnahme Bestandteil der Grundleistungen, die der Architekt im Rahmen der Leistungsphase 8 zu erbringen hat. In Anlage 10 zu § 34 Abs. 4 HOAI heißt es: „Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den Auftraggeber.“
Weiter heißt es: „Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran.“
Der Architekt hat mithin nach der HOAI die Abnahme – die rechtsgeschäftliche Abnahme {Abnahme, rechtsgeschäftliche} – vorzubereiten und dem Bauherrn hierfür eine Empfehlung auszusprechen. Der Architekt soll mit seinem technischen Sachverstand beurteilen, ob die Abnahme erklärt werden soll oder nicht.

{Abnahmeverweigerung}
VOB/B-Vertrag
Die Abnahmeverweigerung ist in § 12 Abs. 3 VOB/B geregelt. Hiernach ist der Auftraggeber nur wegen wesentlicher Mängel zur Abnahmeverweigerung berechtigt. Dagegen besteht das Abnahmeverweigerungsrecht nicht bei unwesentlichen Mängeln. Eine Regelung, wann ein Mangel wesentlich ist, enthält die VOB/B nicht. Dies hängt letztlich von der Art und dem Umfang des Mangels ab. Ferner sind auch die Auswirkungen auf das Bauvorhaben zu berücksichtigen.

Kommt man hingegen bei der Abwägung der gegenseitigen Interessen dazu, dass der Mangel dem Auftraggeber zumutbar und eine zügige Abwicklung des Vertragsverhältnisses nicht gefährdet ist, darf eine Abnahme nicht verweigert werden. Der Auftraggeber darf die Abnahme also nicht verweigern, wenn ihm zugemutet werden kann, die Werkleistung als im Wesentlichen vertragsgemäß zu akzeptieren.
Anhaltspunkte für die Beurteilung können sein:
• Art und Ausmaß des Mangels • Art und Ausmaß der Gebrauchsbeeinträchtigung • Höhe der MangelbeseitigungskostenJedoch kann auch eine Vielzahl für sich gesehen unwesentlicher Mängel den Auftraggeber berechtigen, die Abnahme zu verweigern. Auch hier kommt es jedoch auf die Beurteilung des Einzelfalls an. Irgendwann macht es die Masse.
Unwesentliche Mängel {Mangel, unwesentlicher} nach der Rechtsprechung sind beispielsweise:
• ein uneben verlegter Teppichboden • einzelne lose Dachziegel, sofern die Dichtigkeit des Daches nicht betroffen und ein Herunterfallen ausgeschlossen ist • ein nicht gängiger Rollladen an einem schlüsselfertigen HausDer Auftraggeber muss die Abnahmeverweigerung auch ausdrücklich erklären. Es handelt sich um eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Eine bestimmte Form muss nicht eingehalten und sie kann auch mündlich erklärt werden. Es ist dem Auftraggeber allerdings zu raten, die Abnahmeverweigerung schriftlich zu erklären. Ansonsten riskiert der Auftraggeber, eine Abnahmeverweigerung später nicht mehr nachweisen zu können.
Es gilt: Wer schreibt, der bleibt!
Folge einer berechtigt erklärten Abnahmeverweigerung ist, dass die Abnahmewirkungen {Abnahmewirkung} nicht eintreten. Auch eine fiktive oder konkludente Abnahme scheidet aus.
Siehe auch:



BGB-Vertrag