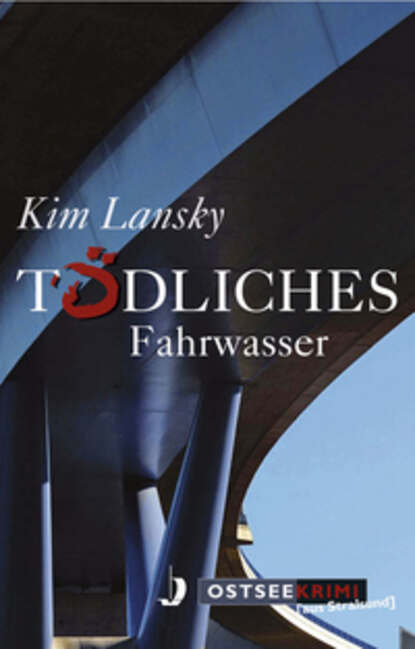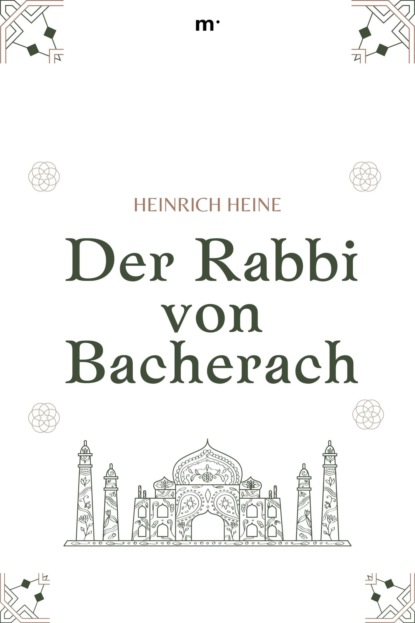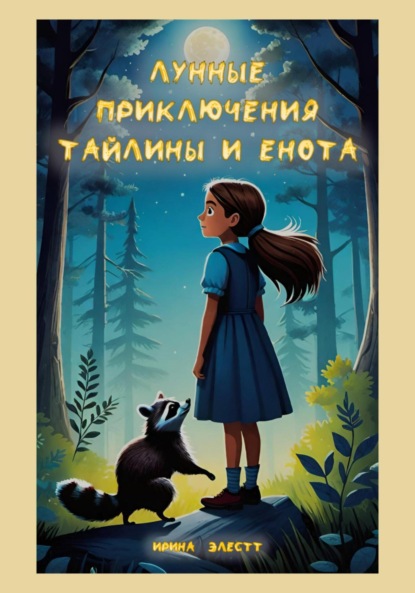- -
- 100%
- +
Auch beim BGB-Vertrag ist der Auftraggeber nur bei Vorliegen wesentlicher Mängel zur Abnahmeverweigerung berechtigt. Es gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

{Abnahmewirkung}
Die rechtsgeschäftliche Abnahme hat die im Folgenden einzeln aufgezählten Wirkungen für Auftraggeber und Auftragnehmer:
• Ende des Erfüllungsstadiums und Beginn des Gewährleistungsstadiums • Übergang der Vergütungs- und Leistungsgefahr {Vergütungs- und Leistungsgefahr} auf den Auftraggeber • Übergang der Beweislast {Beweislast} für das Vorliegen von Mängeln auf den Auftraggeber • Beginn der Verjährungsfrist für Mängelgewährleistungsansprüche • Beginn des Abrechnungsstadiums • Verlust der nicht vorbehalten Vertragsstrafenansprüche {Vertragsstrafenansprüche} • Verlust von Gewährleistungsansprüchen für erkennbare Mängel, die bei der Abnahme nicht vorbehalten wurden
{Erfüllungsstadium}
Vor der Abnahme ist der Auftragnehmer vorleistungspflichtig. Er muss grundsätzlich die Leistung erbringen, bevor er eine entsprechende Gegenleistung – abgesehen von Abschlagszahlungen – erhält. Bei der Abnahme endet die Vorleistungspflicht {Vorleistungspflicht}. Ist die Abnahme erklärt, kann der Auftraggeber eine Zahlung grundsätzlich nicht davon abhängig machen, dass der Auftragnehmer zuvor weitere Leistungen erbringt. Hinzu kommt, dass der Auftraggeber nach Abnahme nicht den gesamten Werklohn zurückbehalten kann, sondern lediglich einen Betrag in Höhe der voraussichtlichen Mängelbeseitigungskosten zuzüglich Druckzuschlag {Druckzuschlag} einbehalten werden können. Im Übrigen wird die Schlussrechnung {Schlussrechnung, Fälligkeit der} fällig.
Siehe auch:


{Vergütungs- und Leistungsgefahr}
Vor der Abnahme liegt die Vergütungs- und Leistungsgefahr beim Auftragnehmer. Das heißt, er trägt das Risiko der Zerstörung oder Verschlechterung der Werkleistung und läuft Gefahr, bei Zerstörung oder Verschlechterung {Verschlechterung, des Werks} des Werks keine Vergütung zu erhalten. Wird vor der Abnahme also das Werk beschädigt oder zerstört, muss der Auftragnehmer das Werk instand setzen oder ggf. auch neu erstellen – ohne zusätzliche Vergütung. Es liegt dann an ihm, beim Schädiger Regress zu nehmen.
Mit der Abnahme geht die Vergütungs- und Leistungsgefahr auf den Auftraggeber über. Er muss den Auftragnehmer bezahlen, und zwar auch dann, wenn nach der Abnahme das Werk zerstört oder verschlechtert wird.

In § 7 VOB/B findet sich hierzu eine Sonderregelung. Ausnahmsweise geht die Vergütungsgefahr schon vor Abnahme auf den Auftraggeber über, wenn die vom Auftragnehmer ausgeführten Leistungen aufgrund höherer Gewalt, Krieg, Aufruhr oder anderer objektiv unabwendbarer Ereignisse zerstört werden – also Ereignisse, auf die weder der Auftraggeber noch der Auftragnehmer Einfluss haben. In diesem Fall soll das Risiko nicht beim Auftragnehmer liegen.

{Beweislast}
Vor der Abnahme muss grundsätzlich der Auftragnehmer beweisen, dass das Werk vollständig erbracht und mangelfrei ist. Nach der Abnahme kehrt sich diese Beweislast um. Dann muss der Auftraggeber nachweisen, dass die von ihm gerügten Mängel tatsächlich vorhanden sind. Im Rahmen eines Bauprozesses hat dies zur Folge, dass vor der Abnahme der Auftragnehmer die Beweislast trägt, mit der Folge, dass er den Vorschuss für den Sachverständigen einbezahlen muss. Nach der Abnahme liegt die Beweislast beim Auftraggeber.

{Mängelgewährleistungsfrist}
Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist zu laufen. Unter beweistechnischen Gesichtspunkten ist dem Auftragnehmer dringend anzuraten, eine förmliche Abnahme durchzuführen, da dann auf dem Abnahmeprotokoll der Beginn und das exakte Ende der Mängelgewährleistungsfrist vermerkt werden kann. Beispielsweise bei einer konkludenten Abnahme kann der Abnahmezeitpunkt oftmals nicht exakt bestimmt werden.
Verweigert der Auftraggeber die Abnahme zu Unrecht und hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Frist zur Abnahme gesetzt, treten die Abnahmewirkungen {Abnahmewirkung} mit Ablauf dieser Frist ein – vorausgesetzt, es liegt eine abnahmereife Werkleistung vor. Die Gewährleistungsfrist beginnt ab diesem Zeitpunkt zu laufen.
Beruft sich der Auftragnehmer im Bauprozess auf eine zu Unrecht verweigerte Abnahme, so ist er hierfür beweispflichtig. Das bedeutet, dass er in diesem Fall – um das Vorliegen einer abnahmereifen Leistung zu beweisen – dennoch den Sachverständigenvorschuss einbezahlen muss.

Mit der Abnahme tritt die Schlussrechnungsreife {Schlussrechnungsreife} ein. Der Auftragnehmer ist berechtigt, seine Schlussrechnung zu stellen. Die Abnahme ist Fälligkeitsvoraussetzung für die Schlussrechnung. Weitere Voraussetzung für die Fälligkeit ist die Prüfbarkeit der Schlussrechnung {Schlussrechnung, Prüfbarkeit der}. Diese muss dem Auftraggeber zugegangen und die Prüffrist nach § 16 Abs. 3 VOB/B muss abgelaufen sein (gilt für den VOB/B-Vertrag).

{Vertragsstrafenansprüche, Verlust der}
Ist im Bauvertrag eine Vertragsstrafe wirksam vereinbart, verliert der Auftraggeber den Anspruch auf Bezahlung der Vertragsstrafe – sofern die übrigen Voraussetzungen vorliegen –, wenn er sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe nicht bei der Abnahme vorbehalten hat.

{Gewährleistungsansprüche, Verlust der}
Die Abnahme hat ferner zur Folge, dass sich der Auftraggeber nicht auf Mängel berufen kann, die bei der Abnahme bekannt waren und er sich diese nicht vorbehalten hat. Die Beweislast für die Kenntnis beim Auftraggeber trägt der Auftragnehmer. Dieser Beweis ist in der Praxis problematisch zu führen.
Bei der Erklärung des Vorbehaltes {Vorbehalt, Erklärung des} handelt es sich um eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Diese muss dem Auftragnehmer auch zugegangen sein. Hierfür ist der Auftraggeber beweispflichtig. Unter Nachweisgesichtspunkten sollte der Auftraggeber den Mangelvorbehalt {Mangelvorbehalt} schriftlich erklären. Es gilt – wie so oft: Wer schreibt, der bleibt!
Beachte: Der Auftraggeber verliert zwar in diesem Falle das Recht auf Nacherfüllung {Nacherfüllung, Recht auf} und Minderung. Das Recht auf Schadensersatz ist jedoch nicht ausgeschlossen. Dies gilt dann, wenn der Auftragnehmer die Mängel zumindest fahrlässig und damit schuldhaft herbeigeführt hat.
Für den Auftragnehmer ist der Schadensersatzanspruch {Schadensersatzanspruch} zumeist ungünstiger als die eigentliche Mangelbeseitigung. Hat der Auftragnehmer den Mangel allerdings nicht selbst verschuldet, entfällt auch dieser Schadensersatzanspruch.
Der Auftragnehmer baut eine Tür ein, die zunächst keine Schäden erkennen lässt. Noch während der Bauausführung, aber nach dem Einbau zeigt sich, dass die Beschichtung der Türen fehlerhaft ist. Der Auftraggeber hat hiervon bei der Abnahme Kenntnis, behält sich den Mangel bei der Abnahme jedoch nicht vor. Hier steht dem Auftraggeber bei unterlassenem Vorbehalt kein Schadensersatzanspruch zu, da der Auftragnehmer die Mängel beim Einbau nicht erkennen konnte. Er handelte nicht zumindest fahrlässig und damit nicht schuldhaft.

{Abrechnung}
Unter Abrechnung versteht die VOB die Feststellung des Rechnungsergebnisses möglichst unter gemeinsamer Mitwirkung von Auftraggeber und Auftragnehmer, soweit es sich um den Vergütungsanspruch des Auftragnehmers für die von ihm ausgeführten Vertragsleistungen handelt. Die Abrechnung hat also die Berechnungen und Feststellung der Hauptleistungspflicht {Hauptleistungspflicht} des Auftraggebers aus dem Bauvertrag zum Gegenstand. In der VOB sind die Abrechnungen in § 14 VOB/B geregelt. Andere abzurechnende Ansprüche des Auftragnehmers oder des Auftraggebers, die nicht die Vergütungen betreffen, sind nicht in § 14 VOB/B geregelt.
Im BGB kommt der Begriff „Abrechnung“ lediglich in § 782 BGB vor. Erfasst wird hier jede unter Mitwirkung von Gläubiger und Schuldner stattfindende Feststellung des Rechnungsergebnisses. Erfasst ist mithin auch die Abrechnung von Bauleistungen. Eine Regelung, wie die entsprechende Abrechnung ausgestaltet sein muss, enthält die Vorschrift jedoch nicht, sodass sie hier nicht weiter erläutert wird.
Siehe auch:


{Abrechnung, Prüfbarkeit der}
Die Abrechnung muss vom Auftragnehmer prüfbar erstellt werden, sodass sie für den Auftraggeber nachvollziehbar ist. Der Auftraggeber muss genau nachvollziehen können, welche Leistungen der Auftragnehmer erbracht hat und wie sich die entsprechend abgerechneten Preise zusammensetzen.
BGB-Vertrag
Beim BGB-Bauvertrag ist die Vorlage einer prüffähigen Schlussrechnung {Schlussrechnung, Prüfbarkeit der} an sich von Gesetzes wegen nicht gefordert. Daran hat sich durch das neue Bauvertragsrecht zum 01.01.2018 nichts geändert. Dies hat jedoch nicht zur Folge, dass der Auftraggeber seine Abrechnung nicht nachvollziehbar darstellen muss. Es ist so, dass auch im BGB-Bauvertrag die Möglichkeit bestehen muss, die Abrechnung des Unternehmers nachzuvollziehen. Es entspricht mithin der herrschenden obergerichtlicher Rechtsprechung – auch beim BGB-Bauvertrag – dass der Auftragnehmer eine Aufstellung (Rechnung) sowie die Belege über den Werklohnanspruch vorlegen muss, um eine prüffähige Abrechnung zu erstellen und die Fälligkeit des Werklohnanspruchs herbeizuführen. Man wird sich hier an den Vorgaben der VOB/B orientieren (indirekt bestätigt dies das OLG Düsseldorf, Baurecht 1999, 655). Bestätigt wird dies auch durch die Regelung des § 286 Abs. 3 BGB, wonach der Auftraggeber 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleichartigen Zahlungsaufstellung automatisch in Zahlungsverzug {Zahlungsverzug} kommt.
VOB/B-Vertrag
Beim VOB-Vertrag ergibt sich die Pflicht, prüffähig abzurechnen, unmittelbar aus § 14 Abs. 1 VOB/B. Die Rechnung ist übersichtlich zu gestalten, und es ist die Reihenfolge der Posten einzuhalten, sowie die im Vertrag verwendeten Bezeichnungen zu verwenden. Im Einzelfall kann von der Reihenfolge abgewichen werden, wenn dies die Prüffähigkeit der Rechnung nicht beeinträchtigt. Die zum Nachweis der erbrachten Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeichnungen sowie Belege sind beizufügen. Vertragsänderungen und Ergänzungen sind gesondert aufzuführen bzw. kenntlich zu machen, etwa durch einen Extraabschnitt für Nachträge.
Beim Pauschalpreisvertrag {Pauschalpreisvertrag} ist davon auszugehen, dass es ausreicht, nur die Endsumme des vereinbarten Pauschalpreises im Rahmen der Schlussrechnung zu nennen sowie Abschlagszahlungen in Abzug zu bringen. Anders ist dies zu beurteilen, wenn sich die Vertragsleistung geändert hat oder der Pauschalpreisvertrag vorzeitig beendet wurde. Im Falle der vorzeitigen Beendigung müssen Teilleistungen gem. § 648 BGB (2018) abgerechnet werden.
Siehe auch:

Hat der Architekt des Auftraggebers die Abrechnung geprüften und sie als prüfbar bezeichnet, so kann sich der Auftraggeber – ihm wird die Kenntnis eines Architekten zugerechnet – nicht auf die fehlende Prüffähigkeit {Prüffähigkeit, fehlende} berufen. An das Ergebnis der Prüfung durch den Architekten ist er jedoch nicht gebunden (vgl. BGH BauR 2002, 613; 2005, 94). Es ist also zwischen der Prüffähigkeit und der inhaltlichen Richtigkeit der Schlussrechnung zu unterscheiden.
Legt der Auftragnehmer keine prüfbare Schlussrechnung vor, ist der Anspruch auf Schlusszahlung nicht fällig. Der Auftraggeber gerät weder nach § 286 Abs. 1 oder Abs. 3 BGB noch gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B in Verzug. Die Fälligkeit tritt jedoch ein, wenn der Auftraggeber nicht binnen der zweimonatigen Prüffrist die fehlende Prüffähigkeit rügt.
Will der Auftraggeber die fehlende Prüffähigkeit der Schlussrechnung rügen, muss er vortragen, welche Informationen ihm aus der Rechnung für die Prüfbarkeit fehlen. Er kann also nicht einfach pauschal behaupten, die Rechnung sei nicht prüffähig.

Kommt der Auftragnehmer seiner Verpflichtung zur Stellung einer Schlussrechnung {Schlussrechnung, Frist} aus § 14 Abs. 1 VOB/B nicht nach, so kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Frist zur Stellung der Schlussrechnung setzen. Diese Frist muss angemessen sein. Dies richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, etwa nach Art und Umfang der Bauleistung. Im Gegensatz dazu sind auch die berechtigten Interessen des Auftraggebers an der alsbaldigen Rechnungsstellung zu berücksichtigen. Ist diese gesetzte Frist abgelaufen, so kann der Auftraggeber selbst auf Kosten des Auftragnehmers eine entsprechende Aufstellung fertigen. Die Aufforderung an den Auftragnehmer bedarf keiner besonderen Form. Sie kann auch mündlich erfolgen. Aus Gründen der späteren Nachweisbarkeit empfiehlt sich jedoch auch hier dringend die Schriftform.
Siehe auch:


Stellt der Auftragnehmer seine Schlussrechnung nicht oder nicht rechtzeitig, kann der Auftraggeber unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 4 VOB/B die Schlussrechnung anstelle der Auftragnehmerseite stellen – auch auf deren Kosten. Gleiches gilt, wenn der Auftragnehmer zwar eine Rechnung eingereicht hat, diese aber nicht prüffähig ist.
Die Rechnungsstellung durch den Auftraggeber muss selbstverständlich den Vorgaben des Vertrags entsprechend geschehen. Gegebenenfalls muss der Auftraggeber hier sogar ein Aufmaß fertigen. Auch diese Kosten kann er jedoch dem Auftragnehmer in Rechnung stellen (vgl. BGH BauR 2002, 313). In der Praxis spielt § 14 Abs. 4 VOB/B allerdings keine große Rolle, da die Schlussrechnung keine Bindungswirkung zulasten des Auftragnehmers entfaltet.
Siehe auch:

Im BGB findet sich – auch nach dem neuen Bauvertragsrecht nach dem 01.01.2018 – keine entsprechende Regelung.

{Abrechnung, nach freier Kündigung}
Im Falle der freien Kündigung kann der Auftragnehmer grundsätzlich die vertraglich vereinbarte Vergütung verlangen – und zwar unabhängig davon, ob die Leistungen abgeschlossen sind oder nicht. Er muss lediglich das in Abzug bringen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart hat oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Betriebs erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Dies ergibt sich sowohl aus § 8 Abs. 1 Nr. 2 VOB/B als auch aus § 648 Satz 2 BGB (2018). Im BGB war diese Regelung vor dem 01.01.2018 in § 649 enthalten. Durch das neue Bauvertragsrecht zum 01.01.2018 ist die Regelung zwar unverändert geblieben, jedoch in § 648 BGB gerutscht.
Ein abzugsfähiger Füllauftrag liegt dann vor, wenn der Auftragnehmer einen Auftrag annimmt, den er aufgrund fehlender Kapazität ohne die Kündigung nicht hätte ausführen können.
Grundsätzlich kann der Auftragnehmer also dasjenige abrechnen, was er bereits erbracht hat – und zwar zuzüglich beauftragter und ausgeführter Nachträge. Für die gekündigte Leistung – die kündigungsbedingt nicht erbrachte – beschränkt sich dies auf den im Kündigungszeitpunkt bestehenden Auftragsumfang. Notwendige Zusatzleistungen nach ab § 1 Abs. 4 Satz 1 und § 2 Abs. 6 VOB/B finden keine Berücksichtigung, wenn die Leistungen zum Kündigungszeitpunkt noch nicht angeordnet waren. Es lag ja in diesem Zeitpunkt noch keine Vereinbarung und damit noch keine vereinbarte Vergütung vor.
Die ersparten Kosten – aufgrund der Kündigung – hat der Auftragnehmer in die Schlussrechnung aufzunehmen und prüfbar aufzuschlüsseln. Es ist dann Sache des Auftraggebers, dem Auftragnehmer nachzuweisen, dass er darüber hinaus Kosten erspart hat oder andere Einnahmequellen böswillig nicht wahrgenommen hat.
BGB-Vertrag
§ 648 Satz 3 BGB (2018) – früher § 649 BGB – enthält eine erhebliche Vereinfachung der Kündigungsabrechnung. Es wird vermutet, dass dem Auftragnehmer für die noch nicht erbrachten Leistungen 5 % der vereinbarten Vergütung zustehen. Die Vorschrift enthält daher die Vermutung, dass dem Auftraggeber durch die Kündigung 95 % der Kosten erspart bleiben. Diese Vermutung kann jedoch vom Auftraggeber wie auch vom Auftragnehmer widerlegt werden. Die Vorschrift des § 648 Satz 3 BGB (2018) ist auch auf VOB-Verträge anwendbar.
Grundsätzlich muss der Auftragnehmer eine zweigeteilte Abrechnung erstellen. Im ersten Teil muss er die erbrachten Leistungen prüffähig abrechnen. Im zweiten Teil muss er sodann die Leistungen abrechnen, die zwar beauftragt, jedoch kündigungsbedingt nicht erbracht sind. Dies muss in nachprüfbarer Form geschehen. Er muss hier – gemäß seiner Urkalkulation – die ersparten Kosten von den nicht ersparten Kosten trennen.
Eine derart zweigeteilte Abrechnung ist in Ausnahmefällen entbehrlich. Dies ist z. B. der Fall, wenn die Leistung entweder nahezu vollständig erbracht ist oder nahezu vollständig fehlt.

Regelmäßig werden für den nicht erbrachten Teil Lohnkosten, Materialkosten und Gerätekosten abzuziehen sein, soweit diese Kosten aufgrund der Kündigung eingespart werden können. Nicht eingespart werden können regelmäßig die Allgemeinen Geschäftskosten (AGK) und der kalkulierte Gewinn (vgl. BGH BauR 1999, 642, 644). Kann der Auftragnehmer allerdings Material, das er für den gekündigten Auftrag vor der Kündigung bestellt hatte, nicht anderweitig verwenden – etwa weil es individuell ist – und es nicht zurückgeben, so kann er auch dieses als nicht ersparte Aufwendungen abrechnen.
Umstritten ist, ob der Auftragnehmer die kündigungsbedingt ersparten Kosten nach Maßgabe der Auftragskalkulation oder nach tatsächlichen Kosten abrechnen muss. Die früher ständige Rechtsprechung stellt auf die Angebotskalkulation ab. Nunmehr hat der Bundesgerichtshof jedoch in mehreren Entscheidungen entschieden, dass auf die tatsächlichen Kosten abzustellen sei, wenn feststeht, dass die kalkulierten Kosten unauskömmlich sind. Diese Rechtsprechung ist in der Literatur allerdings umstritten, da der Auftragnehmer in diesem Fall durch die Kündigung bessergestellt wird – er hätte ja bei Auftragsdurchführung auch nur die kalkulierten Kosten erhalten.

{Pauschalpreisvertrag, Abrechnung nach Kündigung}
Besonderheiten bestehen bei einem gekündigten Pauschalpreisvertrag. Hier ist zwischen dem Detailpauschalpreisvertrag {Detailpauschalpreisvertrag} und dem Globalpauschalpreisvertrag {Globalpauschalpreisvertrag} zu unterscheiden. Beim Detailpauschalpreisvertrag gilt im Wesentlichen das zum Einheitspreisvertrag Gesagte. Bei der Abrechnung muss die bis zur Kündigung erbrachte Leistung in ein Verhältnis zu der beauftragten und geschuldeten Gesamtleistung gesetzt werden. Die ausgeführte Teilleistung muss auf der Basis der Angebotskalkulation mit einer entsprechenden Teilvergütung abgerechnet werden. Im zweiten Teil der Rechnung sind dann wieder die beauftragten, jedoch aufgrund der Kündigung nicht erbrachten Leistungen abzurechnen. Diese sind mit dem verbleibenden Rest der Pauschalvergütung auszuweisen. Hiervon sind die ersparten Aufwendungen nach Maßgabe der Angebotskalkulation abzuziehen.
Beim Pauschalpreisvertrag findet eine mengenunabhängige Abrechnung statt. Es sind folglich die Soll-Mengen, also die vertraglich vereinbarten Mengen, zugrunde zu legen, da auch bei vollständiger Abwicklung des Vertrags lediglich die Soll-Mengen berücksichtigt werden. Auch bei einem gekündigten Pauschalpreisvertrag bleiben zu geringe Vordersätze außer Betracht. Andernfalls würde der Auftragnehmer beim gekündigten Pauschalpreisvertrag bessergestellt als bei Durchführung des Pauschalpreisvertrags. Beim Pauschalpreisvertrag trägt mithin der Auftragnehmer das Risiko der Massenmehrungen {Massenmehrung}.
Auch bei einem Globalpauschalpreisvertrag muss der Auftragnehmer eine Teilpauschale {Teilpauschale} für die erbrachten Leistungen (die bis zur Kündigung erbrachte Leistung) abrechnen, die er auf Basis der Kalkulation ermittelt und ins Verhältnis zu der geschuldeten Gesamtleistung setzt. Von der übrigen Vergütung (für die nicht erbrachten Leistungen) muss er wiederum die ersparten Kosten abziehen. Oftmals fehlt beim Globalpauschalpreisvertrag jedoch eine brauchbare Angebotskalkulation, etwa, weil der Auftragnehmer den Preis „über den Daumen gepeilt“ hat. In diesem Fall muss er eine – schlüssige – Angebotskalkulation im Nachhinein fertigen und der Abschlussrechnung zugrunde legen. Dem Auftragnehmer ist daher anzuraten, auch bei einem Globalpauschalpreisvertrag seine Kosten und den Preis genau und gründlich durchzukalkulieren.