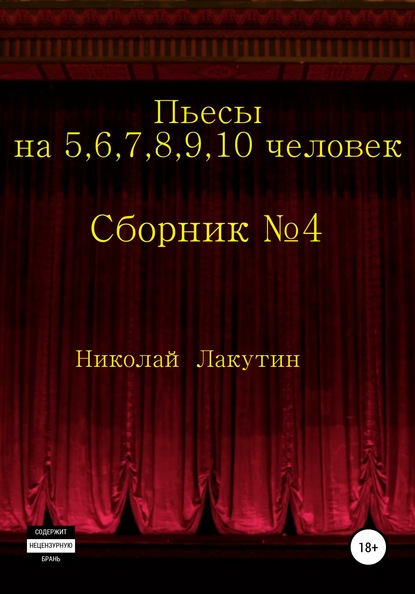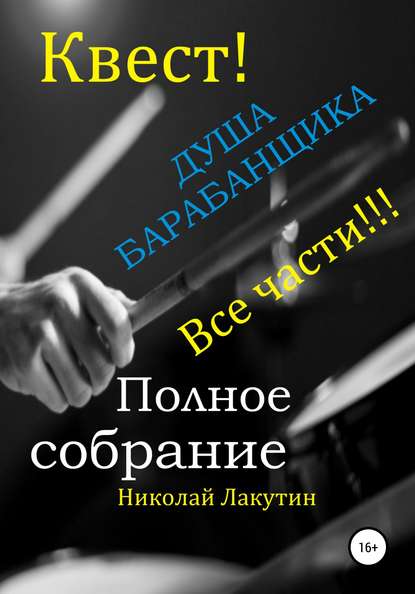- -
- 100%
- +
Kündigt der Auftraggeber den Pauschalpreisvertrag noch vor Ausführungsbeginn {Ausführungsbeginn, Kündigung vor}, ist fraglich, wie der Auftragnehmer abzurechnen hat und welche Angaben in die Rechnung aufzunehmen sind. Es gilt, dass die Abrechnung dem Auftraggeber ermöglichen muss, nachzuprüfen, ob der Auftragnehmer die ersparten Kosten auf der Grundlage der konkreten, dem Bauvertrag zugrunde liegenden Kalkulation korrekt berücksichtigt hat. Es reicht also grundsätzlich aus, wenn der Auftraggeber dies für seine Urkalkulation darlegt. Für den Fall, dass der Auftragnehmer einen Einheitspreisvertrag mit einem Zuschlag auf die Herstellungskosten kalkuliert hat und dieser bereits die sonstigen Faktoren und den Gewinn enthält, so kann er auf dieser Basis gegenüber dem Auftraggeber abrechnen – allerdings nur bei freier Kündigung vor Ausführungsbeginn.
In der Praxis ist die Abrechnung von Pauschalpreisverträgen – insbesondere Globalpauschalpreisverträgen – sehr problematisch. Oftmals haben Auftragnehmer bei Globalpauschalpreisverträgen keine oder nur eine unzureichende Kalkulation im Vorfeld angefertigt. Sie müssen dann bei der Abrechnung eine neue Kalkulation anfertigen. Diese sowie die Erstellung einer prüffähigen Schlussrechnung gelingen in der Praxis selten. Auch bei Pauschalpreisverträgen ist dem Auftragnehmer daher anzuraten, diese gründlich durchzukalkulieren.
Es gilt jedoch: Prüft der Auftraggeber die Abrechnung des Auftragnehmers, so kann er sich im Nachhinein nicht darauf berufen, die Rechnung sei nicht prüffähig. Dies wäre widersprüchliches Verhalten des Auftraggebers.

{Abschlagszahlung}
Sowohl die VOB/B als auch das BGB sehen das Recht des Auftragnehmers vor, Abschlagszahlungen zu verlangen.
BGB-Vertrag
Im BGB ist dies noch relativ neu. Vor dem 01.05.2000 enthielt das BGB noch keine Regelung hinsichtlich der Abschlagszahlungen. Der Auftragnehmer war daher in vollem Umfang vorleistungspflichtig. Werklohn wurde erst mit der Abnahme der Werkleistung fällig (siehe

VOB/B-Vertrag
Für die VOB/B sind Abschlagszahlungen in § 16 Abs. 1 VOB/B geregelt.
Um eine Abschlagszahlung verlangen zu können, muss der Auftragnehmer seine Leistung vertragsgemäß erbringen, und beim Besteller muss ein entsprechender Wertzuwachs {Wertzuwachs} vorhanden sein. Es kommt hierbei insoweit auf die anteilige vereinbarte Vergütung und nicht auf den objektiven Wertzuwachs an.
Was ist nun, wenn die Leistung des Auftragnehmers mangelhaft ist? Das neue Bauvertragsrecht ab dem 01.01.2018 enthält hierzu eine Regelung: Wenn die Leistung des Auftragnehmers mangelhaft ist, kann der Auftraggeber einen angemessenen Teil der Vergütung einbehalten. Da zu diesem Zeitpunkt – das Werk ist ja noch nicht vollendet – eine Abnahme noch nicht vorliegt, trägt der Unternehmer die Beweislast dafür, dass das Werk entgegen der Behauptung des Auftraggebers mangelfrei ist.
Siehe auch:


BGB-Vertrag
Vor dem 01.01.2018 fehlte bei Abschlagszahlungen eine eindeutige Regelung. Dass der Druckzuschlag {Druckzuschlag} auch bei Abschlagszahlungen vorgenommen werden kann, ergab sich vielmehr aus den Gesetzesmaterialien (vgl. hierzu Pause, BauR 2009, Seite 898, 899).
Für den Verbraucherbauvertrag ist besonders der neu eingeführte § 650m BGB (2018) zu beachten. Hiernach darf der Gesamtbetrag der Abschlagszahlungen einschließlich der Vergütung für Nachtragsleistungen 90 % der vereinbarten Vergütung einschließlich Nachtragsleistungen nicht übersteigen (§ 650m Abs. 1 BGB).
Zu beachten ist ferner, dass dem Verbraucher bei der 1. Abschlagszahlung eine Sicherheit {Sicherheit} für die rechtzeitige Erstellung des Werks ohne wesentliche Mängel in Höhe von 5 % der vereinbarten Gesamtvergütung zu leisten ist. Hat sich die Vergütung infolge von Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags oder infolge von Anordnungen des Verbrauchers nach § 650b und c BGB um mehr als 10 % erhöht, ist dem Verbraucher bei der nächsten Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit in Höhe von 5 % des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Auf Verlangen des Unternehmers kann dies auch durch einen Einbehalt von der Abschlagszahlung bis zum Gesamtbetrag der geschuldeten Sicherheit erfolgen.
VOB/B-Vertrag
Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 VOB/B kann der Auftragnehmer in möglichst kurzen Zeitabständen oder zu den vereinbarten Zeitpunkten Abschlagszahlungen in Höhe des Werts der jeweils nachgewiesenen Vertragsleistungen – vertragsgemäßen Leistungen – einschließlich anteiliger Umsatzsteuer verlangen. Die Abschlagszahlungen erfolgen also entweder nach Baufortschritt {Baufortschritt} oder nach vereinbartem Zahlungsplan {Zahlungsplan} – in vielen Bauverträgen wird ein fester Zahlungsplan vereinbart. Zahlungspläne können entweder nach bestimmten Leistungsmerkmalen oder nach zeitlichen Merkmalen vereinbart werden. Sie stellen keinen Eingriff in die VOB/B dar.
Siehe auch:

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 VOB/B muss der Auftragnehmer seine Leistungen durch eine prüfbare Aufstellung nachweisen.
Siehe auch:

Mithin ist die Abschlagsforderung aus der Differenz zwischen der vereinbarten Vergütung und der Vergütung über erbrachte, nachgewiesene Leistungen zu berechnen.
Eine Abschlagsrechnung kann dann nicht mehr gestellt werden, wenn die Bauleistung abgenommen ist und der Auftragnehmer seine Schlussrechnung gestellt hat. Dann besteht Schlussrechnungsreife {Schlussrechnungsreife} (vgl. BGH, BauR 2009, 1724; 2004, 1146).
Beim BGB-Werkvertrag wird der Anspruch auf Abschlagszahlungen sofort fällig. Eine entsprechende Regelung hierzu gibt es zwar nicht. Es gelten jedoch die allgemeinen Bestimmungen des § 271 Abs. 1 BGB, der die sofortige Fälligkeit anordnet. Dies wird praktischen Bedürfnis nicht gerecht, da dem Auftraggeber zumindest eine angemessene Prüfungsfrist gewährt werden muss.
Im VOB-Werkvertrag ist die Abschlagszahlung hingegen nicht sofort fällig. Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 i. V. m. Nr. 3 VOB/B ist die Abschlagsforderung 18 Werktage nach Vorlage einer prüfbaren Aufstellung fällig. Auch beim VOB-Vertrag gelten die Regelungen des § 641 Abs. 2 BGB zur Durchgriffsfälligkeit.
Auch bei Abschlagszahlungen ist der Auftraggeber grundsätzlich berechtigt – sofern eine entsprechende Vereinbarung besteht –, Skonto {Skonto} abzuziehen.
Ein Einbehalt kann auch wegen Mängeln vorgenommen werden. Hier ist durch das neue Bauvertragsrecht zum 01.01.2018 ein Gleichlauf zwischen VOB und BGB hergestellt worden. Der Auftraggeber ist berechtigt, gem. § 641 Abs. 3 BGB das Doppelte der Kosten der voraussichtlichen Mängelbeseitigung einzubehalten – auch bei Abschlagszahlungen. Dies gilt auch bei wesentlichen Mängeln.
Siehe auch:

Auch Abschlagszahlungen sind im Falle des Verzugs zu verzinsen. Dies setzt Fälligkeit und Verzug voraus. Verzug tritt zum einen durch Mahnungen des Auftragnehmers nach Fälligkeit verbunden mit einer Fristsetzung zur Zahlung und dem Ablauf dieser Frist ein. Alternativ kommt der Auftraggeber gem. § 286 Abs. 3 BGB spätestens Verzug {Verzug}, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung {Zahlungsaufstellung} leistet.
Beim VOB-Vertrag tritt Verzug erst ein, wenn die fällige Zahlung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist angemahnt wird (§ 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B). Nach Ablauf einer Nachfrist kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug. Einer Mahnung mit Nachfrist bedarf es dann nicht, wenn eine endgültige und ernsthafte Zahlungsverweigerung vorliegt. Da § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B eine Sonderregelung enthält, geht diese den Regelungen des BGB beim VOB-Vertrag vor.
Im Falle der Zahlungsverweigerung {Zahlungsverweigerung} ist der Auftragnehmer berechtigt, die Arbeiten einzustellen. Dies ergibt sich beim BGB-Werkvertrag aus dem allgemeinen Leistungsverweigerungsrecht nach § 320 BGB. Beim VOB-Werkvertrag ist dies eindeutig in § 16 Abs. 5 Nr. 5 VOB/B geregelt.
Siehe auch:

Die unberechtigte Zahlungsverweigerung – bei Abschlagszahlungen – des Auftraggebers kann den Auftragnehmer zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigen. Er muss dem Auftraggeber zuvor eine angemessene Frist unter Kündigungsandrohung gesetzt haben.
Beim VOB/B-Vertrag ist die Kündigung in § 9 Abs. 1 VOB/B unter den dortigen Voraussetzungen geregelt.
Siehe auch:


{Allgemeine Geschäftsbedingungen}
Allgemeine Geschäftsbedingungen unterliegen der Inhaltskontrolle nach dem BGB. Die VOB/B kann hierzu selbst keine Regelungen enthalten, da die VOB/B-Regelungen selbst als Allgemeine Geschäftsbedingungen zu qualifizieren sind. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen dann vor, wenn Vertragsklauseln nicht nur für einen Vertrag individuell ausgehandelt werden, sondern für eine Vielzahl von Verträgen – es reichen drei Verträge aus – vorgesehen sind und von einer Partei einseitig gestellt werden. Dies dürfte bei der überwiegenden Zahl der Muster-Bauverträge der Fall sein.
Verstößt eine Klausel dieses Bauvertrags nach dem AGB-Recht gegen Klauselverbote nach § 305 ff. BGB oder benachteiligt den Vertragspartner des Verwenders unangemessen gem. § 307 BGB, so ist sie unwirksam. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt die gesetzliche Regelung. Hingegen ist sie nicht unwirksam, wenn sie den Verwender selbst unangemessen benachteiligt. Dieser bedarf – er hat die Klausel ja selbst eingeführt – keines besonderen Schutzes.
Bei Bauverträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher finden die einzelnen Klauselverbote der §§ 305 ff. Anwendung. Bei Klauseln, die in Verträgen zwischen zwei Unternehmern hingegen verwendet werden, geht es lediglich darum, ob die Klausel den Vertragspartner des Verwenders gem. § 307 BGB unangemessen benachteiligt. Die Klauselverbote der §§ 305 ff. BGB sind hierbei nicht unmittelbar anwendbar, sind jedoch ein Indiz für eine Benachteiligung nach § 307 BGB. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Vordrucke, z. B. gedruckte Vertragsmuster oder zusätzliche Vertragsbedingungen.
Die formularmäßige Verwendung von Texten in einer Ausschreibung, die jedoch gegenüber mehreren Bietern verwendet wird, aber nur mit dem einmaligen Ziel des Abschlusses dieses einen Vertrags, stellt hingegen keine AGB dar. Hier ist nicht die Verwendung für eine Vielzahl von Verträgen beabsichtigt. Hier soll ja nur ein Vertrag zustande kommen.
Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nicht automatisch. Sie müssen wirksam in den Vertrag einbezogen werden. Im Regelfall wird die Einbeziehung schriftlich im Vertrag fixiert. Hierbei sind bei Kaufleuten geringere Anforderungen zu stellen. Anders ist dies bei AGB, die gegenüber einem Verbraucher verwendet werden. Für eine Verwendung gegenüber Verbrauchern müssen die AGB nicht nur einbezogen sein. Sie müssen dem Vertrag auch beigefügt sein. Bei der Verwendung unter Kaufleuten reicht hingegen zumeist ein Hinweis auf bestehende AGB.
Zu beachten ist noch Folgendes: Führt ein Vertragspartner für ihn selbst nachteilige AGB in einen Vertrag ein, kann er sich nicht auf die Unwirksamkeit berufen. Lediglich der Vertragspartner des Verwenders kann sich auf die Unwirksamkeit der Klauseln wegen eines AGB-Rechtsverstoßes stützen.
Verstößt eine Klausel gegen §§ 307, 308 oder 309 BGB, ist sie gänzlich unwirksam. Eine teilweise Erhaltung der Klausel, eine sog. geltungserhaltende Reduktion, findet nicht statt.
Ein Beispiel für unwirksame Klauseln {Klausel, unwirksame}:
Eine Klausel, nach der der Auftragnehmer generell für das Baugrundrisiko einzustehen hat – entgegen § 645 BGB – oder er die Bodenverhältnisse ohne besondere Vergütung erkunden muss, ist jedenfalls beim Einheitspreisvertrag nach § 307 BGB AGB-widrig und damit unwirksam.
Eine Klausel, die bei Mengenänderungen {Mengenänderung} eine Preisänderung {Preisänderung} ausschließt, ist beim Einheitspreisvertrag – sie würde § 2 Nr. 3 VOB/B ändern – unwirksam (vgl. BGH BauR 1993, 723).

{Privilegierung der VOB/B}
Bei der VOB/B handelt es sich ebenfalls um Allgemeine Geschäftsbedingungen {Allgemeine Geschäftsbedingungen}. Entgegen der allgemeinen Meinung handelt sich nicht um ein Gesetz. Würde man nunmehr die einzelnen Klauseln der VOB/B der Inhaltskontrolle nach §§ 307, 308 und 309 BGB unterziehen, wären zahlreiche Klauseln – isoliert betrachtet – AGB-widrig und damit unwirksam. Dies würde jedoch zur Unanwendbarkeit der VOB führen – was nicht gewollt ist.
Ist mithin die VOB/B in Bauverträgen als Ganzes vereinbart, d. h., es ergibt keinerlei Eingriffe in die VOB durch Vertragsklauseln, so ist die VOB der Inhaltskontrolle nach §§ 307 - 310 BGB entzogen – sofern sie nicht gegenüber einem Verbraucher angewandt werden soll. Dies wird damit begründet, dass die Gesamtheit der VOB/B-Regelungen ausgewogen ist und keiner der Vertragspartner insgesamt unangemessen benachteiligt wird.
Wird nunmehr jedoch – und sei es nur geringfügig – in die VOB eingegriffen, etwa durch einzelvertragliche Klauseln, so ist dieses Gleichgewicht gestört. Dies hat zur Folge, dass nicht nur die Klausel, die der Regelung der VOB entgegensteht, AGB-rechtlich geprüft wird, sondern dass der gesamte Vertrag – also auch die VOB Regelungen – unter dem Gesichtspunkt des AGB-Rechts geprüft werden. Die Privilegierung der VOB als Ganzes ist damit entfallen. Die entsprechenden Klauseln – auch die VOB/B-Regelungen – sind dann unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders unangemessen benachteiligen. Auch hier gilt: Ist der Benachteiligte selbst Verwender, wird die Klausel nicht unwirksam. Der Verwender hätte die Klausel ja nicht verwenden müssen. Er bedarf keines Schutzes.
Der Auftragnehmer hat bei einem VOB/B-Vertrag die Schlussrechnung des Auftraggebers geprüft – der Auftraggeber ist Verwender. Er hat die Schlusszahlung geleistet und auf die Auswirkungen der vorbehaltlosen Annahme der Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Ziff. 2 VOB/B hingewiesen. Der Auftragnehmer hat den Vorbehalt zu spät erklärt.
Der Auftraggeber kann sich dennoch nicht auf die Ausschlusswirkung {Ausschlusswirkung} nach § 16 Abs. 3 Nr. 5 VOB/B berufen, wenn die VOB nicht als Ganzes vereinbart ist. Hat der Auftraggeber etwa zusätzliche Vertragsbedingungen in den Vertrag mit einbezogen, die Abweichungen zur VOB/B enthalten – dies ist bei öffentlichen Auftraggebern besonders häufig der Fall –, unterfällt auch die Regelung des § 16 VOB/B der AGB-Inhaltskontrolle. Da sie dieser Kontrolle nach ständiger Rechtsprechung nicht standhält, ist sie unwirksam. Das BGB kennt hingegen keine Ausschlussregelung {Ausschlussregelung} vergleichbar mit § 16 VOB/B. Der Auftraggeber kann sich mithin nicht darauf berufen.
In der Praxis wird es kaum Bauverträge geben, die nicht Abweichungen von der VOB/B enthalten. Der Verwender wird daher häufig mit einer Überprüfung der Klausel nach den Vorschriften der AGB-Inhaltskontrolle zu rechnen haben. Der Auftragnehmer als Verwender sollte dabei darauf achten, dass die Verträge so gestaltet sind, dass auch bei der AGB-Inhaltskontrolle die Kernregelungen erhalten bleiben, die seinem Sicherheits- und Risikointeresse entsprechen.
Auftraggeber und Auftragnehmer sollten sich mithin stets gut überlegen, ob sie in einen VOB-Vertrag zusätzliche Regelung mit aufnehmen und in die VOB eingreifen.

Nach § 1 Abs. 1 Satz 2 VOB/B gelten allgemeine technische Vertragsbedingungen als Bestandteil des VOB/B-Vertrags. Dies wird durch die Bezugnahme auf die VOB/C ausdrücklich klargestellt.
Die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen sind in Teil C der VOB in einzelne DIN-Normen untergliedert. Hier findet sich zu Beginn der BOB/C die allgemeine DIN 18299 (Allgemeine Regelungen für Bauleistungen jeder Art) befindet. Die folgenden DIN-Normen beschäftigen sich sodann mit einzelnen speziellen Gewerken. Sie beinhalten spezielle, gewerkespezifische Sonderregelungen und gehen der allgemeinen DIN 18299 vor.
Siehe auch:



{Abnahme, Anfechtung der}
Wegen arglistiger Täuschung oder Irrtum kann die Abnahme grundsätzlich nach herrschender Meinung nicht angefochten werden, jedenfalls soweit es um Mängel und die damit einhergehenden Abnahmewirkungen geht. Zwar handelt es sich bei der Abnahmeerklärung auch um eine Willenserklärung. Hier gehen die werkvertraglichen Regelungen sowie die Regelungen der VOB/B, insbesondere in Bezug auf Erfüllungs- und Gewährleistungsregeln, vor.
Anders ist dies bei Sachverhalten zu sehen, die außerhalb der Erfüllung oder der Mängelhaftung liegen. Auch eine Anfechtung wegen Irrtums über die Abnahmereife {Abnahmereife} kann nicht durchgehen, wenn der Auftraggeber die Abnahme erklärt, obgleich eine abnahmereife Leistung nicht vorliegt.


{Anordnungsrecht}
Auch nach Abschluss des Bauvertrags hat der Auftraggeber die Möglichkeit, den Auftragsumfang sowie den Bauablauf zu beeinflussen. Die VOB/B sieht ein Anordnungsrecht des Auftraggebers bereits seit geraumer Zeit vor. Im BGB ist dies erst mit dem neuen Bauvertragsrechts zum 01.01.2018 eingeführt worden. Davor galt im BGB-Bauvertrag „pacta sunt servanda“.
VOB/B-Vertrag
Gemäß § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B hat der Auftraggeber das Recht, geänderte und zusätzliche Leistungen anzuordnen. Er kann diese Anordnung einseitig vornehmen und durchsetzen. Ein solches Anordnungsrecht {Anordnungsrecht} war dem BGB vor dem 01.01.2018 nicht bekannt. Seit dem 01.01.2018 ist ein solches Anordnungsrecht in § 650b BGB geregelt.
Gemäß § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B sind die vereinbarten Preise aufgrund geänderter und zusätzlicher Leistungen anzupassen. Der Auftragnehmer muss mithin eine geänderte oder zusätzliche Leistung selbstverständlich nicht vergütungsfrei erbringen. Er kann hierfür eine zusätzliche Vergütung verlangen. Er muss hier einen entsprechenden Preis aus der Urkalkulation – der Kalkulation, die er seinen Vertragspreisen zugrunde gelegt hat – entwickeln.
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen geänderten und zusätzlichen Leistungen {Leistung, zusätzliche} deshalb, weil der Auftragnehmer seinen Anspruch auf Mehrvergütung {Mehrvergütung, Anspruch auf} im Falle der Anordnung einer zusätzlichen Leistung durch den Auftraggeber vor Leistungserbringung zwingend ankündigen muss. Anders ist es lediglich bei Anordnungen, die keine zusätzlichen Leistungen sind oder den Bauentwurf nicht ändert. Keiner Ankündigung des Anspruchs auf Mehrvergütung bedarf es bei der Anordnung von Baueinstellung und Arbeitsunterbrechung durch den Auftraggeber, da hier lediglich Rahmenbedingungen geändert werden, die nicht im Risikobereich des Auftragnehmers liegen. Eine solche Änderung liegt auch dann vor, wenn der im Vertrag vorgesehene Aufzug nicht für den Materialtransport verwendet werden kann und deshalb vom Auftraggeber angeordnet wird, das Material anders zu transportieren, etwa über die Treppe. Hier bedarf es keiner ausdrücklichen Ankündigung der Mehrvergütung. Gegebenenfalls ist Behinderung anzumelden. Auch eine Vergütung für die Mehrung der vertraglich vereinbarten Leistungspositionen ist anzukündigen – vor Ausführung der zusätzlichen Leistungen –, wenn der Auftraggeber eine Mehrung der vertraglich vereinbarten Leistungspositionen verlangt. Der Auftraggeber verlangt in diesem Fall mehr als ursprünglich vereinbart, also eine zusätzliche Leistung. Das Anordnungsrecht betrifft mithin Änderungen des Bauentwurfs, nicht die Änderung der Bauumstände.
Der Auftraggeber darf geänderte oder zusätzliche Leistungen {Leistung, geänderte} anordnen. Das Anordnungsrecht bezieht sich nicht auf andere als die vertraglich vereinbarten oder sogar neue selbstständige Leistungen. Derartige Anordnungen braucht der Auftragnehmer nicht auszuführen.
Liegt keine zusätzliche Leistung vor, so soll ein neuer Preis vor Ausführung der Arbeiten vereinbart werden. Die vorherige Vereinbarung ist mithin nicht Voraussetzung für die spätere Geltendmachung der Vergütung. Anders ist dies bei zusätzlichen Leistungen. Eine Ausnahme besteht dann, wenn ein Notfall die unverzügliche Ausführung der Arbeiten notwendig macht. Grundsätzlich – und dies ist bei dem Auftragnehmer auch anzuraten – sollte vor Ausführung der Arbeiten über die zusätzliche Vergütung eine Einigung erzielt werden. Dies hilft, Streitigkeiten zu vermeiden.
Dem Auftragnehmer ist anzuraten, seine Mehrvergütungsansprüche {Mehrvergütung, Ankündigung} grundsätzlich anzukündigen – und zwar vor Ausführung der Arbeiten –, insbesondere dann, wenn nicht eindeutig ist, ob es sich um eine geänderte oder zusätzliche Leistung handelt. Der Auftragnehmer ist dann stets auf der sicheren Seite. Er sollte dies auch schriftlich tun, um spätere Beweisprobleme zu vermeiden.