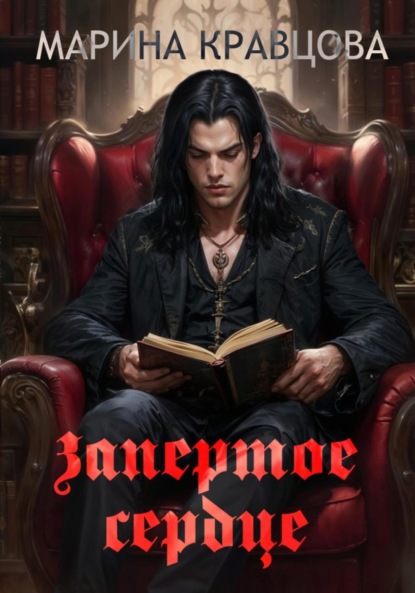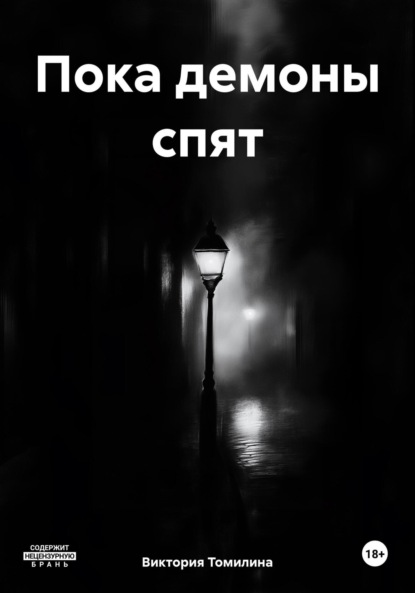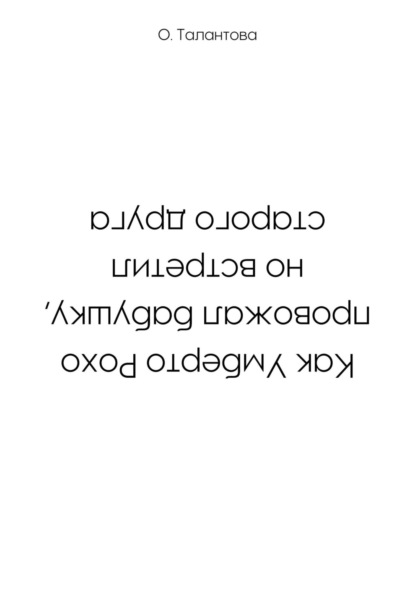- -
- 100%
- +
BGB-Vertrag
Seit dem 01.01.2018 ist auch im BGB-Werkvertrag ein Anordnungsrecht {Anordnungsrecht} des Auftraggebers enthalten. Hiernach kann der Auftraggeber eine Änderung des Werkerfolgs anordnen oder eine Anordnung treffen, die zur Erreichung des Werkerfolgs erforderlich ist.
Die Parteien sollen hier – vor Ausführung der Arbeiten – Einvernehmen über die Mehr- oder Mindervergütung erzielen, wobei der Auftragnehmer verpflichtet ist, ein Angebot über die Leistung nebst Mehr- oder Mindervergütung zu erstellen. Dies gilt – selbstverständlich – nicht, wenn ihm die Änderung der Werkleistung (§ 650b Abs. 1 Ziff. 1 BGB (2018)) unzumutbar ist.
Ist der Auftraggeber für die Planung verantwortlich, muss er dem Auftragnehmer die entsprechenden Planungen zur Verfügung stellen. Ansonsten ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, ein entsprechendes Angebot vorzulegen. Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Gründe für die Unzumutbarkeit der Vertragsänderung verantwortlich, muss er diese auch nachweisen.
Führen die Vertragsparteien Verhandlungen, so gilt die Einigung als nicht erzielt, wenn spätestens 30 Tage nach Zugang des Angebots keine abschließende Einigung vorliegt. In diesem Fall kann der Auftraggeber die Ausführung der Leistung anordnen (§ 650b Abs. 3 BGB (2018)).
Die aus der Anordnung resultierende Vergütungsanpassung {Vergütungsanpassung} ist in § 650c BGB (2018) geregelt. Demnach kann der Auftragnehmer die tatsächlich entstehenden Kosten nebst Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn verlangen. Er kann hierbei auf seine Urkalkulation oder auf die vereinbarungsgemäß hinterlegte Urkalkulation zurückgreifen, wobei vermutet wird, dass die auf Basis der Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der auf Grundlage der tatsächlichen Kosten ermittelten Vergütung entspricht.

{Arbeiten an Bauwerken}
Vor Inkrafttreten der VOB/B 2006 fand eine Unterscheidung zwischen Arbeiten an einem Bauwerk und Arbeiten an einem Grundstück statt. Diese Unterscheidung ist seit Inkrafttreten der VOB/B 2006 weggefallen. Die Verjährungsfrist {Verjährungsfrist} für Arbeiten an Bauwerken ist in § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B geregelt. Sie beträgt vier Jahre, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Abnahme, sofern nichts anderes vereinbart ist. Abweichende Vereinbarungen sind möglich. Für Werke, deren Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache besteht, und für die vom Feuer berührten Teile von Feuerungsanlagen beträgt die Frist zwei Jahre (vgl. § 13 Abs. 4 Nr. 1 Satz 1 VOB/B).
Andere Gewerke als Bauwerks sind solche, die nicht mit der Bauwerkserrichtung in Zusammenhang stehen. Es handelt sich um Arbeiten beispielsweise am Grund und Boden, ohne mit einer Bauwerkserrichtung selbst im Zusammenhang zu stehen (z. B. bloße Gartengestaltung, für sich allein vorgenommene Baggerarbeiten, Sanierungsarbeiten, u. U. Abbrucharbeiten).
Ferner handelt es sich um Arbeiten an einem Bauwerk, die nicht die Funktionsfähigkeit des Bauwerks betreffen. Als Arbeiten an anderen Gewerken als einem Bauwerk gelten auch solche, die an einem auf dem Grundstück bestehenden Gebäude vorgenommen werden, aber wegen der Eigenart nicht Arbeiten an einem Bauwerk sind, da sie nicht in das Bauwerk oder die Bausubstanz eingreifen. Beispiele hierfür sind bloße Ausbesserungsarbeiten, Instandsetzungsarbeiten wie etwa Malerarbeiten im Innenbereich. Ein weiteres Beispiel ist der bloße Umbau einer vorhandenen Beleuchtungsanlage.
Oftmals werden in einem einheitlichen Bauvertrag auch Arbeiten an einem Bauwerk und Arbeiten an einem Grundstück gleichzeitig erfasst. Hier handelt es sich dann insgesamt um Arbeiten an einem Bauwerk mit der hierfür maßgeblichen längeren Verjährungsfrist.
Liegen hingegen Arbeiten an anderen Gewerken als einem Bauwerk vor, beträgt die Verjährungsfrist nur zwei Jahre.
Bei Feuerungsanlagen betrifft die kurze Verjährungsfrist hier lediglich die Teile, die vom Feuer berührten werden. Es muss sich mithin um eine Feuerungsanlage und bei dieser wiederum um diejenigen Teile handelt, die von dem Feuer erreicht werden.
Ein Sonderfall betrifft Arbeiten an maschinellen und elektrotechnischen/elektronischen Anlagen. Hier gilt zunächst die kurze Verjährung von zwei Jahren. Wird jedoch für die Dauer der Verjährungsfrist ein Wartungsvertrag abgeschlossen, bleibt es bei der ursprünglichen Verjährungsfrist von vier Jahren für die maschinellen und/oder elektrotechnischen/elektronischen Anlagen bzw. Teile der Bauleistung. Der Grund dafür liegt darin, dass derartige Bauteile einer erhöhten Wartungsanfälligkeit unterliegen. Der Werkunternehmer, der die entsprechenden Bauteile installiert hatte, soll während seiner Mängelhaftung auch die laufende Kontrolle der entsprechenden Teile in der Hand behaltenen.

{Aufmaß}
VOB/B-Vertrag
Nach § 2 Abs. 2 VOB/B ist das Aufmaß Basis der Vergütung und soll nach § 14 Abs. 2 VOB/B gemeinsam von Auftragnehmer und Auftraggeber vorgenommen werden. Aufbauend auf dem Aufmaß wird die Mengenermittlung durchgeführt. Hierbei sind Abrechnungsbestimmungen in technischen Vertragsbestimmungen sowie anderen Vertragsunterlagen stets zu beachten. Oftmals ist es so, dass Leistungen bei Weiterführung der Arbeiten durch den Auftragnehmer nur schwer feststellbar sind. Hier hat der Auftragnehmer kurzfristig und rechtzeitig auf eine gemeinsame Feststellung hinzuwirken – man denke etwa an Arbeiten an der Entwässerung, die später von einer Erdschicht überdeckt sind.
Das Aufmaß enthält die vom Auftragnehmer ausgeführten Bauleistungen (Anzahl, Maß und ggf. Gewicht). Die Ausgestaltung des Aufmaßes ergibt sich aus den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen, welche jeweils in den einschlägigen DIN-Vorschriften in Teil C der VOB festgehalten sind. Grundsätzlich ist es Aufgabe des Auftragnehmers, ein richtiges und nachvollziehbares Aufmaß zu erstellen und zur Grundlage seiner Abrechnung zu machen. Ein gemeinsames Aufmaß ist nicht zwingend – es sei denn, es ist ausdrücklich vereinbart. Ein vom Auftragnehmer allein erstelltes Aufmaß kann in jedem Fall Grundlage der Abrechnung sein.
Folgende Fallgestaltungen sind gängig:
• Es besteht ein gemeinsames Aufmaß {Aufmaß, gemeinsames}. In diesem Fall ist das Aufmaß für beide Vertragsparteien bindend, unabhängig davon, ob es ein öffentlicher oder privater Auftraggeber ist. • Das Aufmaß {Aufmaß, alleiniges} wird vom Auftragnehmer allein erstellt. In diesem Fall trägt er die Beweislast für die Richtigkeit. Er kann sich jedoch auf das Aufmaß stützen, auch wenn ein gemeinsames Aufmaß im Bauvertrag vereinbart wurde. Das Beweisrisiko liegt allerdings beim Auftragnehmer. Gefährlich ist dies insbesondere dann, wenn Leistungen wegen fortschreitender Arbeiten nicht mehr nachgeprüft werden können. Um hier kein Risiko einzugehen, sollte der Auftragnehmer ein gemeinsames Aufmaß herbeiführen. • Der Auftraggeber hat die Mitwirkung beim Aufmaß {Aufmaß, Mitwirkung verweigert} verweigert. Der Auftragnehmer hat es daraufhin alleine erstellt. Wegen Verstoßes gegen die Kooperations- und Mitwirkungspflicht nach § 642 BGB trägt der Auftraggeber in diesem Fall das volle Risiko hinsichtlich der Unrichtigkeit des vom Auftragnehmer erstellten Aufmaßes (einschließlich Beweisrisiko).Feste Zeitabstände zwischen einzelnen Aufmaßen sieht die VOB/B nicht vor. Der Auftragnehmer sollte jedenfalls dann eine neue Aufmaßnahme verlangen, wenn die Gefahr besteht, dass die folgenden Arbeiten die Erstellung eines Aufmaßes nicht mehr möglich machen oder die Arbeiten nicht mehr nachvollziehbar sind. Man denke hier insbesondere an Tiefbauarbeiten.
Hat der Auftraggeber seinen Architekten eingeschaltet, kann der Auftragnehmer davon ausgehen, dass dieser zur Aufmaßnahme berechtigt ist. In diesem Fall liegt ein gemeinsames Aufmaß vor. Diese Situation ist von der Situation einer Abnahme durch die Architekten zu unterscheiden.
Siehe auch:

Ist bei einem Einheitspreisvertrag festgelegt, dass nach Aufmaß und Einheitspreis abzurechnen ist, so ist – die Abnahme vorausgesetzt – der Werklohn erst dann fällig, wenn ein entsprechendes Aufmaß der Rechnung beigefügt ist. Hierauf kann sich der Auftraggeber berufen. Ist seit Rechnungsstellung ein Jahr vergangen, ohne dass ein Aufmaß vorgelegt bzw. nachgereicht wurde, verliert der Auftraggeber das Recht, die Zahlung aufgrund fehlenden Aufmaßes zu verweigern – sofern die Rechnung im Übrigen prüfbar ist.
Die Rechnung ist hingegen dennoch zur Zahlung fällig, wenn vereinbart ist, dass die Bauleistungen durch ein gemeinsames Aufmaß ermittelt werden sollen, der Auftraggeber jedoch ein einseitiges Aufmaß vorlegt. Fälligkeit der Vergütung liegt vor, wenn die Leistung abgenommen ist und eine prüfbare Rechnung vorliegt. Die Rechnung kann auch aufgrund eines einseitigen Aufmaßes geprüft werden. Lediglich das Beweisrisiko liegt beim Auftragnehmer. Auf die Risikoverteilung hatten wir oben bereits hingewiesen. Ein gemeinsames Aufmaß ist mithin keine Voraussetzung für die Fälligkeit der Vergütung.
BGB-Vertrag
Im BGB finden sich – auch nach der Reform des Bauvertragsrechts zum 01.01.2018 – keine Regelungen zum Aufmaß. Da der Auftragnehmer jedoch beim BGB-Vertrag ebenfalls prüffähig abzurechnen hat, ist auch hier ein Aufmaß der erbrachten Massen erforderlich. Es gelten die Grundsätze des Aufmaßes beim VOB/B-Vertrag entsprechend.

{Auftragsänderung}
Sowohl beim VOB/B-Vertrag als auch – neuerdings seit dem 01.01.2018 – beim BGB-Vertrag kann sich der Auftragsumfang nachträglich durch geänderte oder zusätzliche Leistungen ändern. In der VOB/B sind geänderte und zusätzliche Leistungen {Leistungen, geänderte} in § 1 Abs. 3 und 4 VOB/B geregelt. Aus der geänderten oder zusätzlichen Leistung muss auch eine Anpassung der Vergütung resultieren. Dies ist in § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B geregelt.
Im BGB ist eine ähnliche Regelung mit dem neuen Bauvertragsrecht zum 01.01.2018 in § 650b BGB eingeführt worden. Die entsprechende Anpassung der Vergütung ist in § 650c BGB geregelt.
Siehe auch:




{Auftragsentzug}
Bei Vertragsverhältnissen auf dem Bau besteht gelegentlich die Notwendigkeit, dem Auftragnehmer den Auftrag zu entziehen. Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Auftragnehmer seiner Leistungspflicht nicht nachkommt oder sonst das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien gestört wird. Häufigstes Mittel der Auftragsentziehung ist die Kündigung. Die Kündigung kann zum einen als freie Kündigung erklärt werden. Die freie Kündigung ist in § 648 BGB (früher § 649 BGB) geregelt. In der VOB ist eine entsprechende Regelung in § 8 Abs. 1 VOB/B enthalten.
Ferner kann eine Kündigung aus wichtigem Grund erklärt werden. Entsprechende Regelungen finden sich ebenfalls in § 8 VOB/B sowie in § 648a BGB.
Gemäß § 8 Abs. 6 VOB/B sowie § 650h BGB (2018) muss die Kündigung {Kündigung} schriftlich erfolgen. Dies ist insbesondere unter Nachweisgesichtspunkten zu begrüßen.
Siehe auch:



{Auskunftsrecht}
Während der Ausführung der Arbeiten stehen dem Auftraggeber Zutrittsrechte, Einsichtsrechte und Auskunftsrechte zu. Der Auftragnehmer muss dem Auftraggeber die Möglichkeit geben, durch Informationen den Bauablauf überwachen zu können. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer Gefahr läuft, Betriebsgeheimnisse zu verraten. Man denke hier beispielsweise an bestimmte Verfahrenstechniken oder Formeln usw.
Erteilt der Auftragnehmer dennoch – trotz dieser Risiken – derartige Auskünfte, macht sich der Auftraggeber u. U. schadensersatzpflichtig, wenn er diese erlangten Informationen an Dritte weitergibt – auch nach Beendigung des Auftrags. Unter Umständen bestehen auch Unterlassungsansprüche {Unterlassungsansprüche}. Sowohl Auftragnehmer als auch Auftraggeber sollten mit derartigen Auskünften und Informationen sensibel umgehen.
Umgekehrt bestehen auch Auskunftsansprüche des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber.
Der Auftragnehmer hat den Auftrag nach verbindlichen Vertragsfristen zu beginnen, zu fördern und zu vollenden. Sind Fristen nicht vereinbart, muss der Auftragnehmer Auskunft über den voraussichtlichen Beginn der Arbeiten erteilen. Der Auftragnehmer muss sodann innerhalb von zwölf Werktagen nach Aufforderung mit der Arbeit beginnen. Der Auftraggeber soll so in die Lage versetzt werden – trotz fehlender Vertragsfristen –, den Beginn und den Ablauf der Arbeiten planen zu können.

{Schlusszahlung, Ausschlusswirkung der}
In § 16 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B ist die Schlusszahlungserklärung geregelt. Nimmt der Unternehmer die Schlusszahlung des Auftraggebers im Rahmen eines VOB/B-Vertrags vorbehaltlos an, kann er keine Nachforderungen mehr geltend machen (§ 16 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B). Das umfasst alle Ansprüche des Unternehmers aus dem Bauvertrag. Ausgeschlossen sind deshalb auch alle Zusatz- und Nachtragsaufträge sowie Forderungen aus Pflichtverletzung und Verzug. Gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 4 VOB/B sind auch früher gestellte Forderungen, die noch nicht ausgeglichen sind, ausgeschlossen, wenn sie nicht nochmals vorbehalten werden. Hingegen gelten die Ausschlussfristen nicht für ein Verlangen nach Richtigstellung der Schlussrechnung {Schlussrechnung} und -zahlung wegen Aufmaß-, Rechnungs- und Übertragungsfehlern.
Die Regelungen des § 16 Abs. 3 Nr. 2 und 5 VOB/B halten einer AGB-Inhaltskontrolle nicht stand. Dies ist die höchstrichterliche Rechtsprechung des BGH.
Siehe auch:

Der Vorbehalt {Vorbehalt, gegen Rechnung} muss innerhalb von 28 Tagen (früher 24 Werktage) nach Zugang der Schlusszahlungsmitteilung (§ 16 Abs. 3 Nr. 2 und 3 VOB/B) erklärt werden, und es muss innerhalb von weiteren 28 Tagen eine prüfbare Rechnung über die vorbehaltenen Forderung eingereicht oder, wenn dies nicht möglich ist, der Vorbehalt eingehend begründet werden (§ 16 Abs. 3 Nr. 5 VOB/B). Dies wird in der Praxis jedoch relativ großzügig gehandhabt. Will der Unternehmer im Gegensatz zum Auftraggeber die in einer prüffähigen Schlussrechnung enthaltene Positionen beibehalten, bedarf es keiner näheren Begründung des Vorbehalts.
Ist die VOB/B nicht als Ganzes vereinbart, hält § 16 Abs. 3 Nr. 2 der isolierten Inhaltskontrolle nicht stand, mit der Folge, dass sich der Auftraggeber nicht auf die Ausschlusswirkung berufen kann.
Die vorbehaltlose Annahme der Schlusszahlung führt jedoch nicht zum Wegfall des Anspruchs. Dieser verlängert lediglich seine Durchsetzbarkeit. Dies hat zur Folge, dass der Auftragnehmer seinen Anspruch dennoch gegen etwaige Ansprüche des Auftraggebers aufrechnen kann.
§ 16 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B ist auch für den Fall anzuwenden, indem der Auftraggeber nach Prüfung der Schlussrechnung eine Überzahlung feststellt.
Zu beachten ist – wie so oft –, dass der Vorbehalt nicht gegenüber dem Architekten zu erklären ist, und zwar auch dann nicht, wenn der Architekt die Rechnung geprüft hat. Der Vorbehalt muss gegenüber dem Auftraggeber erklärt werden. Unter Umständen kann der Architekt jedoch zur Entgegennahme des Vorbehalts bevollmächtigt sein. Dies hängt jedoch von den Umständen des Einzelfalls ab. Der Auftragnehmer sollte sich hierauf nicht verlassen.

{Ausschlusswirkung}
Ein erfolgreicher Schlusszahlungseinwand ist an folgende Voraussetzungen gebunden:
• das Vorliegen einer Schlussrechnung • eine Schlusszahlung des Auftraggebers und eine schriftliche Unterrichtung hiervon • ein schriftlicher Hinweis über die Ausschlusswirkung • der unterlassene oder verspätete Vorbehalt des UnternehmersDer Auftraggeber muss schriftlich auf die Ausschlusswirkung seiner Schlusszahlung hinweisen. Dies ist Wirksamkeitsvoraussetzung für seinen Schlusszahlungseinwand. Er muss auf die Schlusszahlung sowie auf den Umstand hinweisen, dass eine vorbehaltlose Annahme dieser Schlusszahlung den Ausschluss der Forderung bewirken kann. Es ist auch auf die Rechtsfolgen des § 16 Abs. 3 Nr. 4 und 5 VOB/B zu erstrecken. Zudem müssen auch die Fristen und Maßnahmen, die der Unternehmer einhalten bzw. ergreifen muss, benannt werden.
BGB-Vertrag
Bei einem BGB-Vertrag gibt es eine Schlusszahlungserklärung {Schlusszahlungserklärung} sowie eine entsprechende Ausschlusswirkung nicht.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.