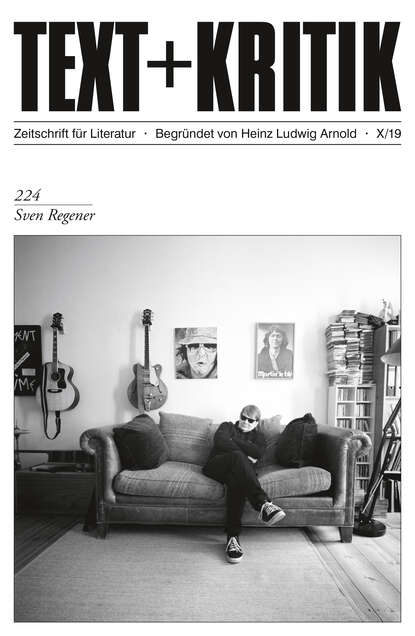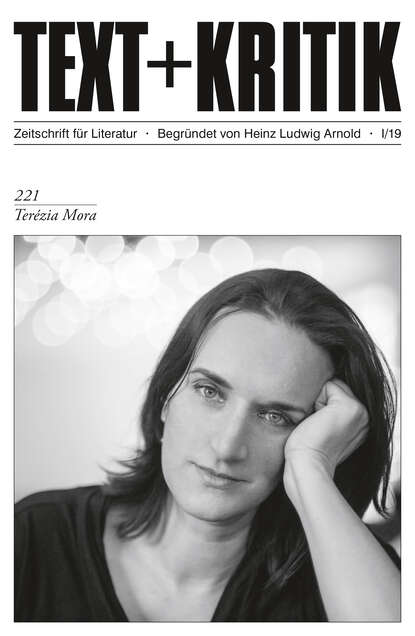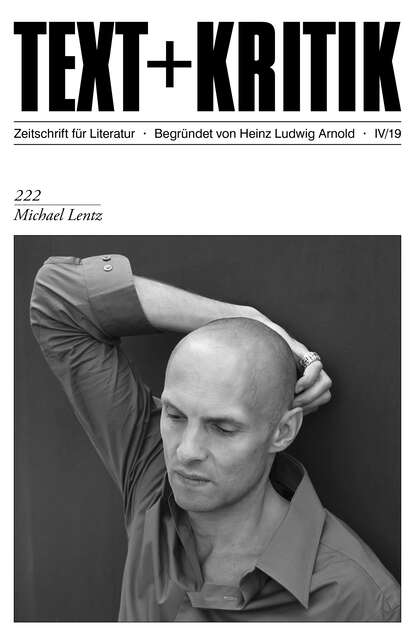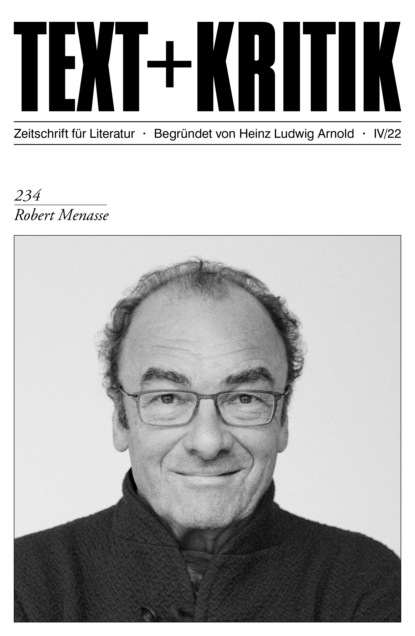TEXT + KRITIK 231 - Thomas Meinecke

- -
- 100%
- +
Du meinst Post-Dubstep, Footwork und so?
Zum Beispiel, ja. Der Bass spielt da eine andere Rolle, der steht manchmal als Cluster da oder glitcht irgendwo in so subsonische Bereiche ab, wo man merkt: Das ist auch irgendwie schön, dass er in so einer Art befreitem Taumel ist. Relativ unwichtig, aber sehr schön, und da sind wir auch wieder bei Adorno. Schade, dass er das nicht hören konnte, dass Adorno nicht merken konnte, was die Bebopper machen. Es ist so schade, weil es auch in seinem Sinne eine Dislocation gewesen wäre, eine auf jeden Fall progressivere Bewegung, als sich noch weiterhin mit der Zweiten Wiener Schule zu beschäftigen.
Jazz war für ihn ja eigentlich nur Big Band Swing …
Ich habe mal eine ganze Radiosendung gemacht, in der ich diesen Vortrag Adornos über Jazz – und wie schlimm das alles sei –, mit Jazzstücken durchsetzt habe, die ihm womöglich gefallen hätten. Ich habe zum Beispiel Thelonious Monk gespielt als etwas, wofür er schon einen Sinn hätte haben können. Aber das stimmt dann eben trotzdem nicht, weil auch – nein, Swing vielleicht eben nicht, aber auch das, was vor Swing gewesen war, der Jazz der 1920er Jahre, den hätte er kennen können, der war schon ganz schön vorneweg. Und Leute wie Kurt Weill haben es auch genommen und transkribiert in die Konzertmusik oder Igor Strawinsky, Darius Milhaud und wer auch immer. Auf jeden Fall – macht nichts, gibt es ja auch nichts zu betrauern. Ich verpasse ja auch vieles, weil ich zum Beispiel nichts mit Heavy Metal anfangen kann. Jeder hat seine Idiosynkrasien, und Adorno mochte dies und das irgendwie nicht, aber ich arbeite mich jetzt dahin, ihn auch richtig zu mögen.
Um noch auf eine andere Aktualität zu sprechen zu kommen: Was bedeutet der Berliner Literaturpreis für dich?
Der Berliner Literaturpreis, inklusive der damit verbundenen Gastprofessur, fiel praktisch vom Himmel, wie aber ehrlich gesagt alles, was ich jemals an Auszeichnungen gekriegt habe. Und es hat mich einfach gefreut, dass da was kommt, wo auch das Feuilleton und so weiter aufhorcht, weil man das irgendwie braucht, wenn man da draußen unterwegs ist und schreibt und liest und Bücher rausbringt. Manchmal ist es besonders toll, wie letztes Jahr diese Einladung zur Ricarda-Huch-Poetikdozentur der TU Braunschweig, die als Genderdozentur formuliert ist. Da hat mich das genauso gefreut, weil dort die Begründung so formuliert war, dass ich mich wie kaum je zuvor erkannt fühlte, in dem, was ich selber will, dass ich dann sagte: »Mit denen, die mich da einladen, will ich auch reden.« Dann sind diese Vorlesungen eben im Dialog mit der Wissenschaftshistorikerin Bettina Wahrig, der Mediävistin Regina Toepfer und der Komparatistin Carolin Bohn gehalten worden.
Wie wirst du diese Gastprofessur-Aufgabe in Berlin lösen? Also wieder, habe ich gerade daraus verstanden, im Dialog mit anderen? Oder wird dort nicht eher eine ›richtige‹ Vorlesung erwartet? Du kannst ja eigentlich nicht »Ich als Text« 2.0 machen, oder? Was ist die Idee?
»Ich als Text« war ja schon eine Verlegenheitslösung, nachdem ich ungefähr ein Vierteljahr daran gesessen hatte, den Leuten erklären zu wollen, was ein Pastiche oder ein Palimpsest ist, bis mir klar wurde, das wird an Unis sowieso gelehrt, das brauche ich denen ja nicht zu erklären, in Anwendung auf meine Position. Das hatte mich damals dazu bewegt, nur aus Zitaten die ganze Vorlesungsreihe aufzubauen. In Berlin ist es jetzt keine Reihe, sondern eine große Vorlesung, anderthalb Stunden, die man einmal hält, am Anfang nämlich, und dann mit den Studierenden weitermacht, in einer direkten Arbeit an ihren Texten. Wo ich übrigens wie zuletzt ganz oft – in St. Andrews zum Beispiel oder in Braunschweig und in Köln – den Ansatz ›Palimpsest‹ in der direkten Arbeit an den Texten verfolge. Dieses Überschreiben von bereits Vorhandenem, das ist dann auch bei der Praxisarbeit sozusagen zentraler Ansatz. Das entbindet auch die, die mitmachen – in Braunschweig war es zum Beispiel nicht so, dass sich da nur Leute melden durften, die selbst Ambitionen haben, schriftstellerisch tätig zu werden, sondern auch andere –, das entbindet die so ein bisschen vom Kunstzwang. Jetzt in Berlin werden sich aber nur welche bewerben, die auch wirklich den Anspruch haben, literarisch zu schreiben. Und mit der Vorlesung habe ich das Gefühl, dass Frankfurt jetzt schon so lange her ist, dass ich jetzt tatsächlich – weil es sich dann schon wieder ein bisschen abhebt von meinem damaligen Stand des Wissens oder der Erkenntnisse – für ein bis anderthalb Stunden was Kluges oder Interessantes zu bieten habe. Ich werde darüber reden, wie mir zum Beispiel eben diese Mediävistinnen und Mediävisten die ganze Zeit erklären, dass meine Art zu schreiben für sie so besonders interessant ist. Also auch inwiefern das Postmoderne und das Prämoderne da vielleicht zusammenfinden und man sich dann Gedanken darüber machen kann, was eigentlich die Moderne verändert hat und wie auch der Gedanke der Aufklärung, des Buchdrucks, der Französischen Revolution und so weiter für Frauen nicht unbedingt Vorteile gebracht hat, sondern zum Teil eben auch Einschränkungen. Und die Vorstellung von einem geschlossenen erzählenden Subjekt, die natürlich eine vom Mann ist, mit der Moderne, mit Buchdruck und Aufklärung forciert wurde, man aber davor eben ein schon eher fluides kollektives Autorensubjekt hatte.
Wie etwa im Bereich der oralen Literatur, wo Urheberschaft ja schwerlich festzumachen ist und im Prozess des Wieder- und Weitererzählens die Texte nicht nur tradiert, sondern auch modifiziert werden.
Oder bei handschriftlicher Abschrift und Überschreibung, genau. Was dann eben meiner Vorstellung von Schreiben entspricht, dass dann da nicht ein geschlossenes autonomes Subjekt wirkt, sondern auch das Nicht-Souveräne dieses Subjektes das Thema des Textes selbst sein kann. Das hat mich jetzt so viel mit Mediävistinnen zusammengebracht und das würde ich ganz gerne als so eine Art Nacherzählung dessen, was in den letzten Jahren geschah, präsentieren, wo ich auch in der Art, wie andere mein Schreiben einschätzen, gelernt habe, was daran vielleicht noch zu verfeinern sein könnte. Weil ich da auch ein bisschen was dazu gelernt oder anders darüber nachzudenken gelernt habe, was der Fortschritt, zum Beispiel in der Aufklärung bedeutet oder eben was der Buchdruck vielleicht auch bewirkt hat.
Allerdings sollte man bei allen problematischen Effekten des Buchdrucks auch nicht unterschlagen, dass er andererseits natürlich ganz wichtig war etwa für eine Popularisierung von Literatur und dafür, dass überhaupt breitere Bevölkerungsschichten lesen konnten, vor allem, dass dann auch verstärkt Frauen lesen konnten. Was dann im 18. Jahrhundert ja diese große Debatte um die, aus männlicher Sicht, schädlichen Auswirkungen der weiblichen ›Lesewut‹ und damit um die Funktion des Lesens – Unterhaltung versus Bildung – und die Wertung von Literatur – gute Texte, schlechte Texte – ausgelöst hat.
Ich wäre der Letzte, der den Buchdruck verteufeln würde. Ich finde es nur interessant, dass er überhaupt auch problematische Dinge mit sich bringen konnte … Und die Vorstellung von lesenden Frauen führte auch dazu, dass sie dadurch hysterisch würden, und die Bibliomanie ist natürlich auch ein Riesending, was wir dann auch noch im 19. Jahrhundert haben, ein Flaubert’sches Ding sozusagen …
Klar, das setzt sich fort und diese Ausdifferenzierung vom Mann als Produzenten und der Frau als Rezipientin ist natürlich hochgradig heikel. Aber andererseits sollte man nicht unterschätzen, dass die verbesserte Zugänglichkeit von Literatur für Frauen natürlich doch auch eine tolle Möglichkeit war, Impulse zu bekommen, ihre Sphäre zu erweitern. Und auch diese Idee des Lesens als Vergnügen finde ich ganz wichtig.
Absolut wichtig. Und dann ist es ja auch hier so wie anderswo bei den Folgen für Marginalisierte und Unterdrückte in Sachen Kunst. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Jazz als eine Folge einer postkolonialen Unterdrückung von Afroamerikanern sehe oder Camp und Voguing als eine hoch differenzierte Kulturform, die mit der Unterdrückung schwuler Männer zusammenhängt, dann gibt es immer ja auch mit dem, was du gerade sagtest, bei Frauen so etwas – wenn sie schon selbst nicht schreiben sollten, dass sie dann aus dem Ausgeschlossensein ganz großartige Dinge wie den Briefroman entwickelten, wo wir jetzt erst merken: Das ist ja eigentlich noch viel toller als so ein oller Goethe. Nehmen wir mal »Die Günderrode«, was da alles stattfinden konnte: »Die Günderrode« ist eigentlich ein riesiges Kompendium von Werken, sowohl von Bettina von Arnim als auch von der Karoline Günderrode, und es wird gar nicht klargemacht, wer gerade spricht. Es ist wie eine Werkausgabe zwischen zwei Buchdeckeln, trägt aber den Namen der Frau, die die meisten Texte darin sozusagen ›hat‹, aufgeschrieben aber von der Autorin von Arnim. Das ist eine unglaubliche Geschichte, die erst heute als reine Tugend erzählbar ist, während das damals eine Art Notlösung war, genau wie Voguing oder Minstrelsy oder eben auch Jazz, dass man praktisch ausweicht vor Restriktionen. Dieses weibliche Schreiben hat sich ja daraus entwickelt, dass es dieses Verbot gab, und es wurde etwas, bei dem ich das Gefühl habe, erst von da, wo jetzt politisch hingedacht wurde, kann man das eigentlich als vorbildlich, wegweisend und komplett revolutionär begreifen. Bisher wurde es immer als Manko – »Ja, es sind halt nur Briefe …« – gesehen. Aber was sich da im Hubert Fichte’schen Sinne auch an Empfindlichkeiten zum Ausdruck bringen konnte, ist einfach viel interessanter als die Empfindsamkeit dieser leidenden Genies, männlichen. Für meine Begriffe jedenfalls. Und da gibt es noch so viel zu entdecken.
Utrecht, 14.12.2019
Beat Mazenauer
»Weg mit dem Gehüstel der Geschichtenerzähler« Thomas Meinecke – Poetik und Werk
In der Literaturzeitschrift »Akzente« beschrieb Thomas Meinecke 2016 einen seiner Arbeitstage. An dem besagten 10. Dezember 2015 rief als Erster der Anglist und Übersetzer Werner von Koppenfels an, um über einen gemeinsamen literarischen Abend zu D. H. Lawrence zu sprechen. Dabei kam das Gespräch auch auf den gemeinsamen Freund Marcel Beyer. Bis drei Uhr morgens, fährt der Text fort, habe der Autor noch für den im Entstehen begriffenen Roman »Selbst« (2016) eine Quelle abgetippt, um mit ein paar Bemerkungen überzuleiten zu einer Lesung mit Frank Witzel, für die er auf seiner »Facebook Wall« noch ein Velvet-Underground-Cover gepostet hat. Er würde, während Witzel vorliest, Schallplatten aus dem Jahr 1969 vorspielen. Damit ist Meinecke bei der Musik angelangt. Neben der Arbeit am Text für »Akzente« suchte er Platten für ein DJ Set zusammen – »Besonders schön: Levon Vincents neue 12-inch aus pinkem durchsichtigem Vinyl« –, danach würde er eine »Zündfunk«-Radiosendung vorbereiten und sich dann zu einem Gesprächsabend an der Ludwig-Maximilians-Universität aufmachen.1
Die zweitseitige Beschreibung klingt gänzlich unspektakulär und gibt vielleicht gerade deshalb Einblick in das Werk und Wirken Thomas Meineckes. Der gerafft wiedergegebene Tagesablauf demonstriert, wie sich bei ihm Grenzen auflösen und in ein fließendes Kontinuum geraten: Schreiben und Diskutieren, Literatur und Musik, Arbeit und Freundschaft. Abschließend weist auch der Titel der abendlichen Veranstaltung »Männer schreiben Frauen auf« darauf hin, dass Meinecke seit je die traditionellen Geschlechterrollen hinterfragt. In einem Video anlässlich einer Braunschweiger Poetikvorlesung im Mai 2019 bezeichnet er sich selbst als »feministischen Romancier«, der seit über 20 Jahren als Autor geprägt sei durch die Gender Studies, »wo die Idee einer geschlossenen Persönlichkeit, eines Subjekts, die einen Text verfasst, eigentlich auch unter die Lupe gelegt wird«.2
Im inzwischen legendären Essay »Cross the Border. Close the Gap« hielt der US-Literaturwissenschaftler Leslie A. Fiedler 1968 den Vertretern der literarischen Moderne ein neues ästhetisches Konzept entgegen. Mit Rückgriff auf den französischen Trompeter, Sänger und Schriftsteller Boris Vian plädierte er für eine »Überbrückung der Kluft zwischen Eliten- und Massenkultur«, ohne sich vor den »Formen des Pop« wie Western, Science Fiction oder Pornografie zu scheuen. Es gelte die traditionelle ästhetische (Rang-)Ordnung zu zerschlagen, mit diesem Ziel sei die Pop Art »subversiv, ungeachtet ihrer erklärten Absichten, und eine Bedrohung für alle Hierarchien, weil sie wider die Ordnung ist«.3
Leslie A. Fiedlers Ruf nach einer ästhetischen und poetischen, zugleich »komischen, respektlosen und vulgären«4 Kritik erreichte die deutschsprachige Literatur schon vor Thomas Meinecke, doch in ihm hat sie ihren leidenschaftlichsten und konsequentesten Verfechter gefunden. 1994 erschien von ihm im »Spiegel Spezial« ein Aufsatz mit dem lakonischen Titel »Alles Mist«. Darin nimmt Meinecke, der wie Vian auch Trompete spielt und singt, Fiedlers Faden auf, allerdings argumentiert er nicht literarisch, sondern musikalisch. »Guter Pop war zu allen Zeiten ein Bastard, unrein, im besten Sinn volkstümlich, populär«, schreibt er und wendet sich so gegen »den Schwachsinn einer eigenständigen deutschen Popkultur«. Der deutschen Musik, insbesondere der deutschen Volksmusik, falle es schwer, sich von traditionalistischen Sentimentalitäten zu trennen, weshalb alles Mist oder Kitsch sei, was in diesem Bereich produziert werde. »In Amerika haben sie das besser gemacht«, kommt Meinecke zum Kern der Sache. »Amerikanische Folkmusic, ob Jazz, Bluegrass oder Zydeco, entsteht gerade durch das Gegenteil von musealer Traditionspflege, chauvinistischer Wurzelsuche oder des bei uns so unheilvoll grassierenden Authentizitäts- und Identitätswahns, sondern vielmehr durch das Vertrauen auf produktive Missverständnisse, nicht zuletzt durch migratorische Entwurzelung.«5 Damit hat er den Dreh- und Angelpunkt auch seines eigenen Schaffens formuliert. Im Umfeld der Zeitschrift »Mode & Verzweiflung«, für die er ab 1978 erste Texte schrieb, entstand 1980 die von Meinecke zusammen mit Michaela Melián, Justin Hoffmann und Wilfried Petzi gegründete Band »Freiwillige Selbstkontrolle«, später kurz F. S.K. Die Band bedient sich bis heute bei Pop-Elementen, experimentiert aber auch ausgeprägt mit volkstümlicher Musik. F. S.K. mischt respektlos Stile miteinander, um »Genres zu erneuern, Identitäten zu überschreiten« und so einen Pop zu schaffen, der von jeglichem Heimat-Purismus befreit ist. In den muttersprachlichen Texten findet F. S.K. nicht »unsere Identität«, wie Meinecke in »Alles Mist« schreibt, »sondern unsere Abweichung«, denn »Kultur darf niemals zu sich selber finden«.6
In einer Vorbemerkung zur Videoclip-Kompilation »Schule ohne Worte«, die Meinecke im Suhrkamp-Logbuch unterhält, wird der Stellenwert von Musik »als das Medium der Dislokation, Dekonstruktion vermeintlicher Mitten, als vorrangiger Impuls- und Taktgeber im Schaffen des popistischen Romanciers«7 betont. Das klingt programmatisch; entsprechend macht Thomas Meinecke die »Dekonstruktion vermeintlicher Mitten« auch in seinem Schreiben produktiv. Pop wird auch literarisch zur griffigen Formel für das Aufbrechen herkömmlicher Normen und ihre ästhetische Überholung, Pop fordert das beständige Hinterfragen von Identitäten und Geschlechterrollen. In seinem Verständnis markiert die Popkultur »eine Distanz zur Hochkultur«: Pop ist ein diagnostisches Instrument, das die Realität frei von elitärem Gehabe ins Visier nimmt und damit weit weg ist von dem, wie Meinecke 2008 in einem Interview sagt, ganz auf Affirmation angelegten »totalitären System« Pop.8
In dem Sinn verbindet sich Pop mit analytischer Schärfe. Meinecke driftet nicht auf den Oberflächen umher, wie es dem landläufigen Pop zum Vorwurf gemacht wird, sondern wirft seine Fangnetze in unergründete Tiefen, um Verschollenes, Verdrängtes, Verachtetes zu heben mit dem Ziel, das »Queerpotenzial« unserer hybriden Kultur zu erkennen und herauszuarbeiten. Pop meint hier, resolut die Ordnungsstrukturen zu hinterfragen und sie in einem literarischen Sound so subtil zu zitieren wie virtuos zu remixen. Das Wort »Gedanken-Pop«, das Jörg Drews in einer Rezension zu »Tomboy« verwendet, ritzt auch nur die Oberfläche. Thomas Meinecke zielt tiefer, analysiert die kulturelle Dichotomie von wertschätzender Traditionsorientierung und oberflächlicher Zeitgenossenschaft wie kaum ein anderer Autor und entlarvt sie als falsch. Insofern weist Pop bei ihm weit über die musikalische und literarische Genrefragen hinaus.
Resolut formuliert es Thomas Meinecke bereits in einem seiner frühesten Texte: »Neue Hinweise: Im Westeuropa Dämmerlicht 1981« für die »bohemistische« Zeitschrift »Mode & Verzweiflung«. Zur Maxime erhebt er das »Kybernetische Verhaltensprinzip«, das als »Absage an das Prinzipiendenken und an jede Form von Dogmatismus« zu verstehen ist. Es enthält ein striktes »Ja zur Modernen Welt« sowie die Gegnerschaft zur eskapistischen »neuen Hippie-Generation«. »Wir Kybernetiker«, gipfelt das Konzept darin, müssen »unsere Wachsamkeit in Spiel und Revolte der ständig veränderten Situation anpassen: Heute Disco, morgen Umsturz, übermorgen Landpartie. Dies nennen wir Freiwillige Selbstkontrolle«9 – in ironischer Anlehnung an die Wiesbadener FSK, die Selbstzensuranstalt der deutschen Filmwirtschaft. Das ist Diskurs-Pop – hier allerdings noch in satirischer Verkleidung.
Schon 1986 war Meineckes Erstling »Mit der Kirche ums Dorf« erschienen, eine Auswahl von Kurzprosa, die er von 1978 bis 1986 für »Mode & Verzweiflung« und ab 1982 für »Die Zeit« verfasst hatte. Darin – und in der 12 Jahre später erschienenen Anthologie »Mode & Verzweiflung« – schöpft er kräftig aus dem narrativen Volksvermögen, indem er Geschichten aus den Medien variiert und die Perspektive des trägen TV-Publikums zum Standard erhebt. Sich selbst hält der Erzähler diskret hinter einem ungreifbaren »Wir« versteckt. Meineckes sarkastische Spitzen zielen direkt auf den Typus des »68er-Gutmenschen«, der seine ehrlichen, persönlichen Animositäten oft nur notdürftig unter dem Mäntelchen der political correctness verbirgt. Dabei schreckt Meinecke in perfider Unbefangenheit auch nicht vor taktlosen Bemerkungen zurück, die durch deftige Pointen und absurd wirkende Fotoillustrationen noch akzentuiert werden. Die zugespitzten Formulierungen, mit denen er die Populär- und Unterhaltungskultur aufs Korn nimmt, täuschen nie über den unterschwelligen kulturtheoretischen Ernst hinweg. Auch wenn Meinecke sichtlich nicht der 1968er-Euphorie im Geist Fiedlers anhängen mochte, ließ er dennoch durchblicken, dass auch ihm die Grenzüberschreitung und die Überwindung der Gräben ein dringliches Anliegen war.
Mit Blick auf die kurze Prosa jener Jahre hat Hubert Winkels einmal von »Pop-Singles«10 geschrieben, die auf die performative und die musikalische Passion Meineckes verweisen. Davon zeugt auch ein ebenso schräges wie stilbildendes Gespräch mit Thomas Palzer über Gender-Diskurs, Büstenhalter und »Identitäts-ähm-pulverung« unter dem Titel »I gave my cock a woman’s name«.11 Der Dialog wird laufend von gehäuften und daher störenden »äh«- und »ähm«-Lauten interpunktiert, was allerdings weder Versehen noch Unvermögen signalisiert, sondern ein Konzept: Das ursprünglich spontan geführte Gespräch wurde verschriftlicht und danach auf der Bühne nachgespielt. Der dabei eintretende Verlust an expressiver Spontaneität mündet in eine »parasitäre Rede«:12 einen Sekundärdiskurs mit hörbar vorgestanzten Redewendungen. Einem solchen Sekundärdiskurs – freilich nicht mehr in ironischer Brechung, sondern ernsthaft und literarisch virtuos – sollte sich Meinecke nun zuwenden.
Er äußerte sich immer wieder in Interviews und Textbeiträgen über seine Poetik. Auf ein traditionelles Erzählen hat Thomas Meinecke nie hingeschrieben. »Was war aber der Schriftsteller an sich bereits für eine traurige Figur«, heißt es in der frühen Erzählung »Holz« (1988), wenn dieser, beispielsweise »der bloßen Überleitung halber, das leise Knarren etwa seiner Zimmertür beschrieb …«13
In einem Interview 1999, kurz nach Erscheinen des Romans »Tomboy« (1998), bekundete Meinecke sein Misstrauen »gegenüber der Eingebung und dem Genie, [ich] verfahre selbst lieber mit Versatzstücken, Zitaten, mit – und jetzt werde ich wieder modisch – Samples«.14 Und wenig später doppelt er in einem programmatischen Beitrag für die Zeitschrift »Spex« nach. Unter der Überschrift »Handlung lenkt ab« erteilt er jeder performativen wie narrativen Sentimentalität eine Absage, weil sie nur »Ablenkung vom Text« sei und alte literarische Klischees reproduziere. »Ich will überhaupt keine Fiktion. Ich will null Ausgedachtes. Nicht das Originelle. Nicht die Erfindung«, formuliert er, um zu folgern: »Weg mit dem Gehüstel der Geschichtenerzähler. Grundsätzlich: Sogenannte Wissenschaft ist mir Fiktion genug. Wissenschafts-Fiktion als sprichwörtlich wahrhaftige Science Fiction.«15
Meinecke sprengt die gängigen Muster des stringenten Erzählens und psychologischen Ausmalens. Kurze anekdotische Einschübe beleben lediglich atmosphärisch und topografisch die Diskussionen seiner Spielfiguren. Er zieht es vor, von sich als Autor wegzuschreiben und stattdessen Diskurse, Texte, Theorien, Lektüren durch sich hindurchziehen zu lassen, um ihnen in seiner Diskursprosa auf biegsame Weise Ausdruck zu verleihen. Faction lautet das poetische Prinzip, dem er auf unvergleichliche Weise Ausdruck verleiht. Meinecke spiegelt laufende Diskurse ab und bettet sie in ein subtil gesponnenes Netz von oft verblüffenden Beziehungen ein, sodass sie in ihrer Ernsthaftigkeit zuweilen spröde wirken, doch insgeheim immer wieder auch Anlass zu Komik und Heiterkeit geben. Der Autor wird zum DJ, sein Schreiben zum Plattenauflegen und der Text zum Soundmix: »nur ist da kein Plattenkoffer, sondern ein Bücherregal, Kisten mit Büchern oder Büchertürme auf dem Fußboden, neben mir oder auf dem Tisch, und da ziehe ich mir das so raus, wie es mir passt, in einer bestimmten Reihenfolge, die schon auch intuitiv abläuft«.16 Damit sprengt er allerdings den populären Pop-Begriff. Wie Pop dennoch als Diagnose der Dissidenz und als kulturologische Analyse funktioniert, demonstrieren seine Romane, die ab 1996 in regelmäßigen Abständen erscheinen.
Als Erstes war es »The Church of John F. Kennedy« (1996), worin Thomas Meinecke seine Protagonisten ins amerikanische Pop-Zentrum eintauchen lässt. Der Roman ist als literarisches Roadmovie angelegt: Mit einem klapprigen Chevrolet reist der Mannheimer Privatgelehrte Wenzel Assmann von New Orleans aus quer durch die Südstaaten der USA, auf den Spuren der deutschen Auswanderung im 19. Jahrhundert. Eine Zeit lang wird er von der deutschstämmigen Viertelindianerin Barbara Kruse begleitet, die ihm beispielhaft die gebrochenen Identitäten vorführt, die den amerikanischen Melting Pot auszeichnen. Zwischendurch telefoniert er nach Deutschland mit Erika, die ihm von den turbulenten Entwicklungen berichtet, die Europa in jenen Wendejahren 1990 und 1991 umtreiben.
Gleich mit den ersten Sätzen signalisiert Meinecke, dass es sich hier nicht um einen Roman im herkömmlichen Sinn handelt. Die Handlung, die Meinecke ohne große emotionale Anteilnahme erzählt, dient primär als Klammer für eine Fülle an disparatem Material: historische Dokumente, kulturarchäologische Erläuterungen und Zitate. Assmanns Erlebnisse beschränken sich auf lange Autofahrten und flüchtige (Liebes-)Begegnungen, wobei er sich am sichersten dann fühlt, wenn er über sein Thema sprechen kann. Mit der Fülle von Beobachtungen, Diskussionen und Quellenstudien legt Meinecke Schicht um Schicht die Ablagerungen eines deutschen Pioniergeistes frei, der integraler Bestandteil der amerikanischen Geschichte ist. Meinecke scheut in seiner kritischen Auseinandersetzung mit Amerika keine Widersprüchlichkeit, doch im Unterschied zu den soliden antiamerikanischen Ressentiments, wie sie auch in Deutschland gehegt werden, fühlt er sich seiner Position nie sicher. Sein Protagonist Assmann erfährt das Land und die assimilierte Kultur der einstigen Auswanderer als Befreiung. Nur hier in der Fremde »konnte Nationalbewußtsein auch fortschrittliche, naturgemäß antinationalistische Erkenntnisse lostreten«.17 Allerdings steckt darin gleich auch ein Keim des Scheiterns, denn nirgends präsentieren sich ihm Antisemitismus und Rassismus so unverhüllt wie in dem toleranten Nebeneinander von abgeschotteten Subszenen, Geheimzirkeln und Sekten (unter ihnen die titelgebende »Church of John F. Kennedy«). Auf seiner Reise durch das germanische Amerika revidiert Wenzel Assmann seinen Glauben an vorgefertigte Kategorien und Identitäten und revitalisiert so die Überzeugung, dass jeder sein eigener Pionier ist, der sich den eigenen subkulturellen Claim absteckt – auch um den Preis der Kluft innerhalb der Gesellschaft. Dafür bedarf Meinecke allerdings weder schöner Naturpanoramen noch psychologischer Entwicklung. Wenzel Assmann ist ein Medium eines diskursiven Konzepts, das gewissermaßen den analytischen Pioniergeist der Leser*innen herausfordert.