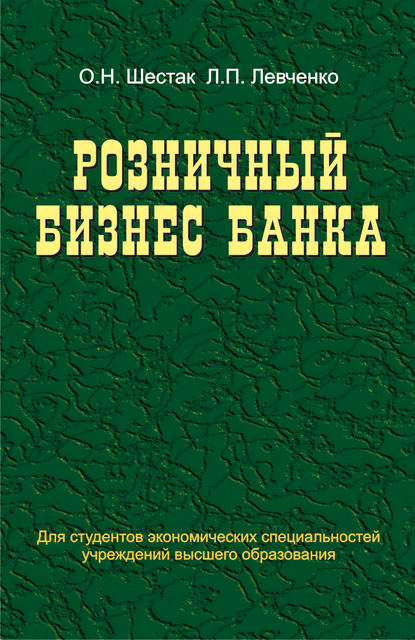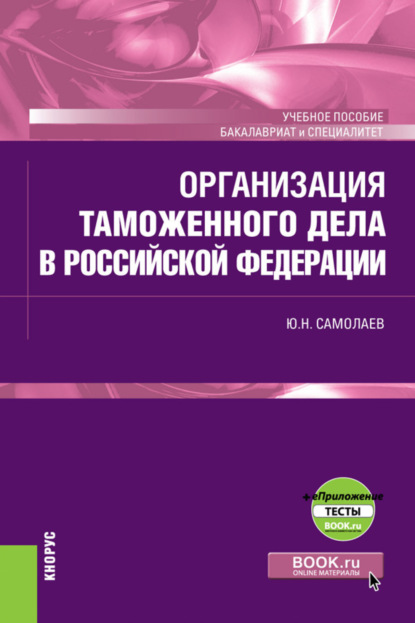Schatten über Adlig-Linkunen

- -
- 100%
- +
Auf Adlig-Linkunen herrschte eine nervöse Atmosphäre. Die Herrschaften Kokies waren die ganze Nacht aufgeblieben, ebenso Friedrich und Berta. Noch vor Anbruch des Morgengrauens hatte sich Wilhelm-Antonius entschlossen, eine Kutsche vorbereiten zu lassen, um sie in die Richtung der angegebenen Geldübergabestelle zu schicken. Als er Friedrich damit beauftragte, fragte dieser: „Kann ich mitfahren? Ich halte das untätige Sein nicht mehr aus. Ständig hat man das Gefühl, etwas unternehmen zu müssen, ohne zu wissen, was.“ „Selbstverständlich, Friedrich. Nehmen Sie einen bewaffneten Wildhüter mit!“ Und so machten sich der Kutscher, ein Wildhüter und Friedrich im Morgengrauen auf, in der Hoffnung, dass Anna nach der Übergabe des Geldes freigelassen würde und in der Nähe auftauchte. Friedericke, Maria und Berta zogen sich in den Salon zurück. An ein vernünftiges Gespräch war nicht zu denken. Dennoch bemühten sie sich, sich gegenseitig ein wenig aufzumuntern und vor allem Berta Halt zu geben, die vor Angst und Kummer keinen vernünftigen Gedanken zustande bekam. Maria erzählte von einigen lustigen Streichen, die Hannes, Anna und sie als Kinder gemacht hatten; es waren einige dabei, von denen ihre Eltern noch gar nichts gewusst hatten.
Während des Gesprächs teilte Maria mit: „Übrigens habe ich ein Telegramm nach Berlin an Hannes schicken lassen und ihn gebeten, nach Linkunen zu kommen. Er müsste also in den nächsten Tagen hier ankommen. Wenn er das Telegramm gestern noch erhalten hat, könnte er heute schon gegen Abend hier sein.“
„Das war sehr gut, Maria“, antwortete ihre Mutter. „Daran habe ich in all der Aufregung überhaupt nicht gedacht!“
„Aber ich …“
Plötzlich stand Wilhelm-Antonius in der Tür des Salons und musste trotz ihrer Situation amüsiert lächeln. „Da weiß die eine Hand nicht, was die andere tut. Jetzt hat Hannes zwei Telegramme von uns bekommen. Aber wir wissen jetzt auch, von wem unserer Tochter Vernunft und Weitblick geerbt hat!“
Jetzt musste sogar Berta lächeln und die Atmosphäre entspannte sich ein wenig. Wilhelm-Antonius ging zu Maria, nahm sie in den Arm und platzierte einen dicken Kuss auf ihre Wange. „Ich bin der festen Überzeugung“, fuhr er fort, „dass Sie, liebe Berta, Ihre Tochter auch bald wieder in die Arme schließen können.“
„Ich auch!“, bestätigte Friederike.
Man konnte Berta deutlich ansehen, wie gut ihr die Anteilnahme ihrer Dienstherren tat. Bei allem Unglück, das über ihre Familie gekommen war, hatten sie und Friedrich aber das große Glück, dass sie die Unterstützung der Familie Kokies genießen konnten. Das war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Auch hochrangige Dienstboten wie Zofen oder Butler waren in der Regel bei der Bewältigung ihrer Probleme auf sich allein gestellt. Schlimmer noch, sie mussten eventuell sogar damit rechnen, entlassen zu werden, wenn sie aufgrund ihres Kummers ihrer Tätigkeit nicht mehr ordnungsgemäß nachgehen konnten und ihre Pflichten vernachlässigten.
Als Bouffier die Reiter kommen sah, bemerkte er, dass eine Frau dabei war. Er beobachte, wie sie anhielten, abstiegen, zielbewusst die deponierte Tasche holten und in aller Hektik wieder davonritten. Die junge Frau hatten sie zurückgelassen. Das konnte nur Anna sein.
Einerseits spürte Bouffier eine gewisse Erleichterung, andererseits ärgerte er sich über seine stümperhafte Vorgehensweise. Die Entführer konnten ungehindert entkommen; hätte er dafür gesorgt, dass er nicht alleine, sondern in Begleitung einer versteckten, berittenen und bewaffneten Eskorte in Lauer gelegen hätte, könnte man jetzt sofort die Verfolgung der Verbrecher aufnehmen. Er hatte nicht damit gerechnet, dass die Geisel direkt bei der Geldübergabe freigelassen würde, aber er hätte es in Erwägung ziehen müssen. Nichtsdestotrotz musste er sich jetzt um Anna kümmern. Er beeilte sich, aus seinem Versteck zu kommen, um sich ihr zu erkennen zu geben. Als er aus dem Unterholz heraustrat, bemühte er sich, sein beruhigendstes Lächeln aufzulegen und sagte: „Sie sind Anna, nicht wahr?“
Diese staunte ihn mit weit aufgerissenen Augen an, Angst stand ihr ins Gesicht geschrieben und deshalb fuhr er schnell fort: „Mein Name ist Peter Bouffier, Polizeileutnant; ich bin hier, um Sie nach Hause zu bringen.“ Anna brachte immer noch kein Wort heraus, aber ihre Anspannung löste sich etwas. „Können Sie ein paar Schritte gehen? Ich habe in der Nähe mein Pferd versteckt.“
Jetzt fand Anna ihre Sprache wieder: „Ja, ja ich glaube schon, ich will es versuchen. Auf keinen Fall möchte ich hier alleine gelassen werden, während Sie Hilfe holen. Sie sind doch alleine?“
Es war ihm sichtlich peinlich, als er dies bestätigten musste: „Ja, ich bin alleine hier, dummerweise!“
Aber Bouffier hatte nicht an den treuen Hauptwachtmeister gedacht. Gustav Hinrich tauchte plötzlich ebenfalls auf. Er hatte sich zwar nach dem Deponieren des Lösegeldes zurückgezogen, dann aber ebenfalls ein Versteck gesucht und auf der Lauer gelegen.
„Offensichtlich habe ich mich geirrt, das ist Hauptwachtmeister Hinrich“, stellte Bouffier ihn Anna vor und wandte sich ihm dann zu. „Freut mich, dass Sie auch hier sind. Dann muss Fräulein Doepius nicht zu Fuß gehen, wenn Sie die Pferde holen. Wir warten hier so lange.“
„Wird sofort gemacht, Chef“, antwortete Hinrich und machte sich umgehend auf den Weg.
„Anna, Sie sind jetzt frei, ich verbürge mich für Ihre Sicherheit.“
„Danke, ich…, ich…“
„Sie brauchen jetzt nichts zu sagen“, unterbrach sie Bouffier. „Sie werden uns später sicher jede Menge zu erzählen haben. Aber jetzt kommen Sie erst einmal zur Ruhe. Wir sehen jetzt zu, dass Sie so schnell wie möglich nach Hause kommen. Hinrich wird Sie führen, Sie können sein Pferd benutzen; ich werde vorausreiten und auf Adlig-Linkunen die gute Nachricht Ihrer Freilassung verkünden. Ihre Eltern werden über alle Maßen erleichtert sein!“
Anna konnte auf einmal entspannt lächeln, während ihr gleichzeitig ein paar dicke Tränen die Wange herunterkullerten. Bouffier trat an sie heran, legte einen Arm auf ihre Schulter und sagte leise, ebenfalls lächelnd: „Es ist vorbei, Anna, der Albtraum ist vorüber, Sie werden bald wieder zu Hause sein; freuen Sie sich auf Ihre Eltern!“
„Und auf Maria; geht es ihr gut, ist sie verschont geblieben?“
„Ja, es geht ihr gut. Es geht allen gut in Linkunen, und es wird allen noch besser gehen, wenn man von Ihrer Freilassung erfährt!“
Inzwischen war Hinrich mit den Pferden zurückgekehrt. Anna wurde auf einmal bewusst, dass sie sich erneut mit ihrem Reifrock und einem Herrensattel arrangieren musste. Diesmal schoss ihr die Röte bei diesem Gedanken ins Gesicht. Überhaupt wurde sie sich jetzt über ihr Äußeres im Klaren: seit zwei Tagen ungewaschen, die Kleidung völlig durcheinander, die Haare zerzaust. Aber das alles durfte jetzt keine Rolle spielen, Hauptsache war, dass sie nach Hause konnte, dass sie frei war. Es würde noch genügend Zeit kommen, um ausgiebig zu baden. Bei dem Gedanken an eine vernünftige Mahlzeit verdrängte sie ihr Erscheinungsbild in die hinterste Ecke ihres Gehirns. Bouffier und Hinrich halfen Anna vorsichtig in den Sattel, Hinrich führte nun das Pferd, bis sie einen Weg erreichten. Hier wollte Bouffier sich gerade von ihnen trennen, um vorauszureiten, als sie das Geräusch von Pferdehufen hörten. Die beiden Polizisten zogen sofort ihre Pistolen. Annas Pferd wurde zur Seite in den Wald geführt, um sie außer Schusslinie im Falle eines Feuergefechtes zu bringen. Das Geräusch kam von vorne immer näher und plötzlich tauchte vor ihnen in etwa 300 Fuß oder ca.100 Meter Entfernung eine zweispännige Kutsche auf. Man konnte sofort erkennen, dass sie aus dem Fuhrpark Adlig-Linkunen stammte, das Wappen an den Türen war nicht zu übersehen. Die Erleichterung bei Anna und ihren beiden Begleitern war riesig, die Polizisten steckten ihre Waffen wieder in die Halfter und warteten, bis das Fahrzeug sie erreicht hatte. Die Szene, die sich jetzt abspielte, war durch nichts zu überbieten. Als Friedrich aus der Kutsche blickte und seine Tochter erkannte, war der sonst so besonnene und ruhige Mann nicht mehr zu halten. Noch bevor das Gefährt völlig zum Stillstand kam, riss er die Tür auf, sprang heraus, wobei er beinahe gefallen wäre und rannte auf Anna zu. Diese ließ sich jetzt langsam vom Pferd gleiten und als Friedrich sie erreicht hatte, drückte er sie wortlos fest an sich; er wollte sie scheinbar nicht mehr loslassen, als hätte er Angst, sie wieder verlieren zu können. Die anderen sprachen ebenfalls kein Wort und hatten ihre Blicke auf Vater und Tochter gerichtet. Es war still, doch plötzlich hörte man Schluchzen, freudiges Schluchzen, das nicht nur von Anna kam. Friedrich kullerten ebenfalls Tränen der Freude und Erleichterung über die Wangen. Das Ganze schien eine halbe Ewigkeit zu dauern, bis die beiden sich wieder voneinander lösten und Friedrich seine Tochter vorsichtig zur Kutsche führte. Sie hatten immer noch kein Wort miteinander gesprochen.
Die Erleichterung auf dem Gut Adlig-Linkunen war deutlich zu spüren, von den Herrschaften bis hin zum kleinsten Dienstboten. Annas Befreiung sprach sich genauso schnell herum wie vorher ihre Entführung.
Wie erwartet, traf am Abend Hannes auf dem Gut ein und vernahm ebenfalls mit großer Beruhigung das Ende des Entführungsdramas.
Nur Bouffiers Gefühle waren zwiespältig; einerseits war er natürlich froh, dass Anna körperlich unversehrt wieder zu Hause war, andererseits konnte er mit seiner Arbeit als Polizist nicht zufrieden sein. Er hatte keinerlei Anhaltspunkte, wer die Entführer sein mochten; es gab keine Hinweise, wo Anna festgehalten worden war.
Am Tag nach Annas Freilassung versuchte er behutsam, sie zu verhören; aber viel konnte sie zur Klärung des Verbrechens nicht beitragen. In Anwesenheit von Wilhelm-Antonius, Hannes und dem Butler erzählte Anna Bouffier den Ablauf der Geschehnisse: „Ich habe keinen der Entführer je zu Gesicht bekommen. Da man mir anfänglich die Augen verbunden hatte, weiß ich nicht einmal die Richtung zu nennen, wohin man mich verschleppte. Ich befürchte, ich kann Ihnen nicht sehr dienlich sein.“
„Ihre Rolle“, warf jetzt Wilhelm-Antonius Kokies ein, „war auch nicht gerade rühmlich, Bouffier. Sie haben nicht einmal den Versuch unternommen, die Verfolgung aufzunehmen. Die Verbrecher konnten ungehindert entkommen!“
„Ich bin mir dessen vollkommen bewusst“, erwiderte dieser und überlegte, was er zu seiner Verteidigung vorbringen könnte, als Hannes das Wort ergriff: „Das finde ich nicht! Herr Bouffier hatte keine andere Wahl. Um die Verbrecher verfolgen und schließlich festsetzen zu können, hätte er mehrere Männer gebraucht. Ihr habt doch gesagt, dass es eine Forderung der Entführer gab, die Geldübergabe durch eine einzelne Person durchführen zu lassen. Das heißt doch, dass Anna in allerhöchster Lebensgefahr geschwebt hätte, wenn sie nur Wind davon bekommen hätten, dass sich im Hinterhalt eine berittene und bewaffnete Eskorte befindet. Auf jeden Fall wäre Annas Freilassung schiefgegangen!“
„Nun ja, vielleicht hast du Recht“, lenkte Wilhelm-Antonius ein. „Außerdem hatte ja keiner von uns damit gerechnet, dass Anna direkt freigelassen wird.“
Bouffier nahm die Einlassung von Hannes dankbar auf, aber sein Schuldbewusstsein nahm keinesfalls ab. Als die Vernehmung von Anna abgeschlossen war, fasste er zusammen; „Sehr viele Anhaltspunkte haben wir in der Tat nicht. Aber einige Dinge können wir feststellen: erstens kannten die drei Entführer weder Anna noch Maria persönlich, denn sonst wäre es nicht zu der Verwechslung gekommen. Zweitens müssen die Täter aus der Gegend von hier kommen, zumindest einer von ihnen, denn sie kannten sich wohl bestens hier aus. Und drittens befürchte ich, dass sie einen Mittäter unter dem Personal von Adlig-Linkunen hatten. Wie sonst konnte ein Schreiben unbemerkt in das Verwalterhaus gelangen? Ein Fremder hätte das Risiko der Entdeckung auf sich nehmen müssen. Aber jemand von hier, sei es ein Forstarbeiter oder ein Dienstbote, erweckt keinen Argwohn, wenn er sich hier frei bewegt.“
„Sie meinen, hier irgendwo bei den Angestellten des Guts gibt es einen Komplizen?“, fragte Hannes. „Aber dieser hätte doch dann die Entführer über die Verwechslung informieren können!“
„Nur, wenn während der Entführung und der Geiselhaft Annas Kontakt zwischen ihnen bestanden hätte. Dies lässt nur den Schluss zu, dass es einen solchen Kontakt nicht gegeben hat und der Ablauf des Verbrechens vorher detailliert abgesprochen war. Sobald die Entführung in Adlig-Linkunen bekannt wurde, sollte wohl diese Person das Schreiben deponieren. Auf diese Weise vermieden die Verbrecher einen direkten Kontakt zwischen uns und ihnen. Eine solch raffinierte Planung verrät uns auch, dass die Schurken nicht dumm sind. Aber mit der Verwechslung der beiden Damen haben sie schon einmal einen Fehler gemacht, irgendwann werden sie vielleicht wieder einen machen und sich damit verraten, sei es durch verschwenderische Geldausgabe oder sich Verplappern im Bekanntenkreis.“
Damit beendete Bouffier seine Ausführungen und die Runde wurde aufgelöst. Hannes und Bouffier verließen gemeinsam das Arbeitszimmer von Wilhelm-Antonius, wo die Vernehmung stattgefunden hatte. Vor der Tür wandte sich der Polizist an Hannes: „Ich danke Ihnen für meine Verteidigung, Herr Kokies, aber Ihr Vater hatte durchaus Recht. Meine Rolle war wirklich nicht gerade rühmlich.“
„Unsinn“, antwortete Hannes. „Das, was ich gesagt habe, habe ich auch so gemeint. Ich an Ihrer Stelle wäre stolz auf Ihr umsichtiges Handeln. Und Ihre Ausführungen und Rückschlüsse bezüglich des Verbrechens waren sehr eindrucksvoll. Ich finde, Sie haben durch Ihr logisches Vorgehen schon mehr herausgefunden, als ich erwartet habe.“ Er machte eine Pause, während er Bouffier zum Ausgang begleitete. Kurz vor dem Erreichen des Hauptportals fuhr er fort: „Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie Ihr Möglichstes tun werden, um das Verbrechen aufzuklären. Übrigens, mein Name ist Hannes, eigentlich Johannes, aber meine Freunde nennen mich Hannes. Wenn Sie nichts dagegen haben, können wir uns duzen; wie heißen Sie mit Vornamen?“
Bouffier war völlig überrascht von Hannes Vorschlag. Aber weil ihm der unkomplizierte junge Gutsherr auf Anhieb sympathisch gewesen war, nahm er den Vorschlag gerne auf. „Ich habe nichts dagegen einzuwenden; wenn wir uns keinen Bruderschaftskuss geben müssen! Ich heiße Peter.“
Lachend verabschiedeten sich die beiden voneinander mit den Worten von Hannes: „Ich werde noch eine Zeit auf Adlig-Linkunen verweilen. Wir bleiben in Verbindung.“
Bouffier wurde in einer Droschke des Gutes nach Hause gefahren, und er freute sich auf Elisabeth. Während der Heimfahrt löste sich langsam seine Anspannung, und er wäre beinahe eingeschlafen.
November 1887
Bezüglich der Aufklärung des Entführungsfalles tat sich in der folgenden Zeit nicht allzu viel, obwohl Bouffier und Hinrich mit Nachdruck daran arbeiteten. Der Polizeileutnant traf sich des Öfteren mit Hannes Kokies und stellte fest, dass die Gespräche miteinander sehr fruchtbar waren. Er hatte das Gefühl, dass er zahlreiche Anregungen aus diesen Unterhaltungen mitnehmen konnte. Hannes zeigte sich sehr interessiert an Kriminalistik und durch sein Studium der Juristerei konnte er auch fundierte Kenntnisse vorweisen. Peter Bouffier sprach mit Hannes auch über die sogenannte Daktyloskopie von Welkur und die Möglichkeiten, sie auch in der Justiz und Kriminologie einzusetzen. Bouffier hatte sich einige Materialien besorgt, um daktyloskopische Abdrücke sichtbar zu machen und Experimente in seinem Büro angestellt, bisher allerdings ohne Erfolg. Einmal hatten sie beide gemeinsam den Versuch unternommen, das Entführer-Schreiben auf diese Weise zu analysieren, ebenfalls erfolglos.
„Mach dir nichts daraus, Peter, bei einem Strafverfahren würde diese Methode sowieso nicht als Beweis akzeptiert werden.“
Aus ihren Treffen entwickelte sich langsam eine gute Freundschaft, und sie stellten fest, dass sie viele Gemeinsamkeiten hatten.
Auch äußerlich wiesen sie Ähnlichkeiten auf. Peter war zwar einige Jahre älter als Hannes, aber sie hatten etwa die gleiche Größe und Statur, beide relativ groß, dunkle Haare, recht schlank, aber mit kräftiger Muskulatur. Bouffier trug nur einen kleinen, eleganten Schnurrbart.
Der Oktober war nun vergangen und mit dem November bekam man in den Masuren langsam einen deutlichen Vorgeschmack auf den Winter. Die Nächte waren schon bitterkalt und die ersten Schneeflocken hinterließen einen weißen Anstrich. Auf Adlig-Linkunen ging alles wieder seinen alten Gang. Aber unter den Angestellten herrschte noch ein gewisses Unbehagen. Denn das Gerücht, dass einer von ihnen mit dem Verbrechen zu tun gehabt haben soll, hatte sich schnell herumgesprochen. Kündigte einer der Landarbeiter, um seines Weges zu ziehen und woanders sein Glück zu suchen, fragte man sofort: „War das der Kollaborateur?“
Sogar die Hausangestellten und die betroffenen Familien selbst wurden von den Verdächtigungen nicht verschont und die aberwitzigsten Spekulationen kamen in Umlauf. Steckte womöglich gar die Polizei mit den Entführern unter einer Decke? Hatten Herr und Frau Doepius das Ganze inszeniert, um an viel Geld zu kommen? Einige wussten zu berichten, dass die Gutsfamilie Kokies in schwere finanzielle Nöte durch die Lösegeld-Zahlung geraten war und die ohnehin knappen Landarbeiterlöhne bald gar nicht mehr bezahlt werden könnten.
Auch im Herrenhaus selbst herrschte eine gewisse Besorgnis. Inzwischen wüssten die Entführer sicherlich, dass sie statt Maria, Anna entführt hatten. Es wäre doch sicherlich durchaus denkbar, dass sie einen zweiten Versuch machten, um diesmal die Richtige zu entführen. Aus ihrer Sicht war ja der erste Versuch reibungslos gelungen. Wenn die Familie Kokies bereit war, für die Tochter von Angestellten Lösegeld zu zahlen, dann würden sie es für die eigene Tochter erst recht tun. Auf jeden Fall war die Zeit der unbeschwerten Ausflüge und Ausritte in die masurischen Wälder für die beiden Mädchen vorbei. Auf Anordnung von Wilhelm-Antonius musste bei jedem Ausflug ein bewaffneter Reiter die jungen Damen begleiten, was solche Unternehmungen nicht unbedingt lustiger machte.
Anna hatte sich seit ihrem schicksalhaften Erlebnis verändert. Für solche, die sie nur flüchtig kannten, war es kaum bemerkbar, aber die ihr Nahestehenden konnten es nicht übersehen. Sie war nachdenklicher geworden, weniger oberflächlich.
Eines Tages sprach Maria sie darauf an. Sie waren zu Pferde unterwegs zu einem der vielen Seen in der Umgebung, um zu erkunden, ob er schon so zugefroren war, sodass man auf ihm Eislaufen konnte. In gebührendem Abstand folgte ihnen ihr Bewacher, so dass sie sich einigermaßen ungestört unterhalten konnten, ohne dass dieser jedes Wort verstand, aber wenn nötig, sofort bei ihnen sein konnte.
„Du bist ruhiger geworden seit dem Ereignis. Kommst du mit deinen Gedanken nicht mehr davon los? Hast du jetzt ständig Angst? Das verstehe ich durchaus, aber dagegen musst du ankämpfen. Ich möchte dir dabei helfen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass du mit mir redest, mir deine Sorgen und Ängste mitteilst. Ich bin doch deine beste Freundin. Und wenn du das jetzt verneinst, entführe ich dich auf der Stelle noch einmal. Und dann wirst du nicht wieder freigelassen!“
Anna lachte: „Du vergisst unseren Bewacher, liebe Maria, sieh ihn dir nur an. So grimmig und wichtig, wie der dreinschaut, hast du keinerlei Chance.“ Sie drehten automatisch beide ihre Köpfe um, sahen in die Richtung ihres Aufpassers und mussten laut kichern. Der Arme wusste nicht, wohin er blicken sollte, und sein Gesicht lief purpurrot an.
„Ich glaube Anna, das war eben nicht allzu nett von uns!“ Es dauerte trotz dieser Einsicht noch eine Weile, bis sie ihr Lachen ganz unterdrücken konnten und Anna weitersprach:
„Natürlich bist du meine beste Freundin, aber du machst dir zu viele Sorgen. Es mag komisch klingen, aber ich habe keine Angst. Natürlich muss ich oft an meine Entführung denken, aber es beherrscht mich nicht. Vielmehr sehe ich viele Dinge anders als früher, sowohl Kleinigkeiten wie auch Wichtiges. Ein Frühstück zum Beispiel ist nichts Bedeutendes, aber auch nichts Selbstverständliches. Deine Freundschaft ist auch nichts Selbstverständliches und ich befürchte, ich habe sie früher als solche gesehen. Heute möchte ich Gott jeden Tag dafür danken. Du bietest mir deine Hilfe an und ich spüre, du meinst es wirklich so. Das ist etwas Wichtiges, etwas wirklich Bedeutendes.“ Sie machte eine kurze Pause, Maria schwieg ebenfalls. „Weißt du, Maria, wie wir unser künftiges Leben gestalten wollen? Unbeschwert in den Tag, in unsere Zukunft hineinleben? Eines Tages einen mehr oder weniger netten Mann kennenlernen, Kinder bekommen, das war’s?“ Erneut machte Anna eine Pause und sie ritten eine Weile schweigend nebeneinander her, bevor sie sagte: „ Ich möchte Ärztin werden!“
Abrupt stoppt Maria ihr Pferd und starrte Anna an: „Wie bitte, was hast du eben gesagt?“
„Ich will Ärztin werden!“
Anna war inzwischen auch stehengeblieben.
„Das ist doch nicht dein Ernst! Du weißt, dass das nicht möglich ist! Frauen können keine Ärztin werden!“
„Doch, es gibt Ausnahmen. Wenn der Dekan einer medizinischen Fakultät die Erlaubnis erteilt, darfst du Medizin studieren.“
„Selbst wenn, dann darfst du später aber nicht als Arzt tätig sein.“
„Soweit bin ich noch nicht. Bis dahin vergeht noch viel Zeit, es kann sich einiges ändern. In Amerika fordern Frauen das Wahlrecht für sich und ihre Chancen stehen gar nicht so schlecht.“
„Amerika ist weit weg, Anna, dort haben sie nicht einmal einen König oder Kaiser, sondern einen Präsidenten, der vom Volk gewählt wurde; unvorstellbar!“
„Nein, nicht vom Volk, nur von Männern. Oder gehören Frauen nicht zum Volk?“
Maria erwiderte zunächst nichts und sie setzten langsam ihren Ritt fort. Nach einer Weile sagte sie: „Ich habe eigentlich noch nicht darüber nachgedacht, Anna. Vielleicht hast du Recht. Was sagen deine Eltern dazu?“
„Ich habe noch nicht mit ihnen darüber gesprochen.“
„Bevor du die Zustimmung irgendeines Dekans bekommst, benötigst du erst einmal der Zustimmung deines Vaters. Und außerdem, verstehe mich bitte nicht falsch, ich will nicht überheblich sein, woher willst du das Geld für ein Studium nehmen?“
„Ich kann arbeiten; es werden immer wieder junge Frauen gesucht, die reiche alte Leute versorgen.“
„Woher willst du das wissen?“
„Du hast es mir selbst gesagt, Maria. Du hast erzählt, dass bei deiner Mutter immer wieder Anfragen eingehen, ob sie niemanden entbehren könnte, der solchen Aufgaben gewachsen ist.“
„Ja hier in Ostpreußen, auf hiesigen Gütern. Wie willst du studieren und gleichzeitig auf einem masurischen Gut Kranke pflegen?“
„Nicht auf einem masurischen Gut; in den Städten muss es auch Kranke geben, zum Beispiel in Berlin!“
„Anna, du bist naiv. Bitte, stürze dich nicht in irgendwelche Abenteuer, die dich in den Ruin ziehen. Schon die Vorstellung, dass du alleine in Berlin bist, graut mir. Hast du mal darüber nachgedacht, in welchem Licht man dich sehen wird?“
„Aber Maria, wir leben im 19. Jahrhundert, die Zeiten ändern sich. Was heute noch ungewöhnlich ist, wird morgen bereits normal sein. Außerdem ist man in Berlin erheblich toleranter als hier im verstaubten Ostpreußen!“
„Du meinst unmoralischer, nicht toleranter. Ich schlage dir vor, erst einmal mit deinen Eltern zu reden. Sag mal, wie bist du eigentlich auf all diese Ideen gekommen? Woher weißt du, dass man in Berlin als Frau studieren darf, wenn man eine Genehmigung erteilt bekommt? Hat Hannes für dich in Berlin nachgefragt? Du warst doch noch nie alleine dort!“
Anna wollte gerade antworten, als Maria ihr ins Wort fiel: „Ah! Sag nichts, ich glaube, ich kann es mir selbst zusammenreimen: Hat es etwas mit Otto Goldfeld zu tun und der Tatsache, dass unser Hausarzt, Dr. Markowski, in letzter Zeit öfter bei ihm ist?“
In der Tat ging es dem Gutsverwalter immer schlechter und der Arzt sah regelmäßig nach ihm. Goldfeld konnte seine zunehmende Atemnot nicht mehr verbergen, wie er es noch vor kurzer Zeit getan hatte. Maria war aufgefallen, dass Anna bei den Arztbesuchen immer zugegen war und sich auch sonst oft bei Goldfeld aufhielt; hatte dies aber ausschließlich auf das enge Verhältnis der beiden zueinander zurückgeführt. Aber jetzt erschien das Ganze in noch einem anderen Licht. Und in der Tat bestätigte Anna: „Ja, es hat auch sehr viel damit zu tun. Ich habe mich ausführlich mit Dr. Markowski unterhalten. Zunächst nur, um in Erfahrung zu bringen, wie ich Opa Goldfeld helfen kann. Dabei wurde aber auch generell mein Interesse für die Medizin geweckt. Ich merkte, wie wenig ich ohne medizinische Kenntnisse für ihn tun kann. Dr. Markowski ist eine Goldgrube und sehr, sehr erfreut, wenn man ihn ausfragt. Ich glaube, er denkt, dass er in mir eine gelehrige Schülerin gefunden hat, und ich hoffe, er hat Recht. Schon bald habe ich ihm anvertraut, wie sehr mich ein Studium interessieren würde. Er hat zunächst genauso reagiert wie du, und ich versuchte, alle seine Einwände zu entkräften. Auf der anderen Seite imponierten ihm wohl meine Hartnäckigkeit und meine Verärgerung darüber, dass Frauen nicht studieren dürfen. Eines Tages überraschte er mich mit der Nachricht, dass ich mit Sondergenehmigung die Universität besuchen kann. Er ging sogar noch einen Schritt weiter und erklärte mir, dass er den Dekan der medizinischen Fakultät in Berlin recht gut kenne und sich für mich einsetzen könne. Er riet mir allerdings, ebenso wie du, zuerst mit meinen Eltern ausführlich zu sprechen.“