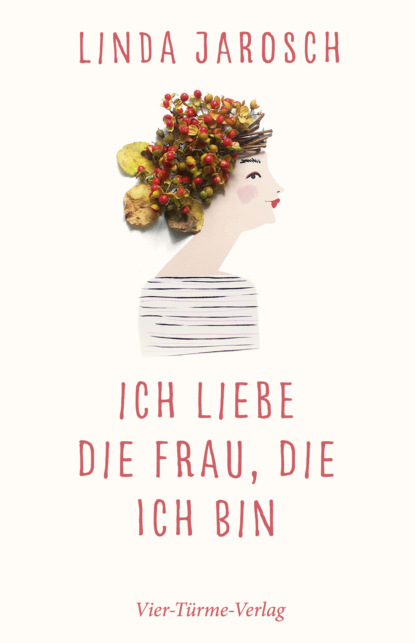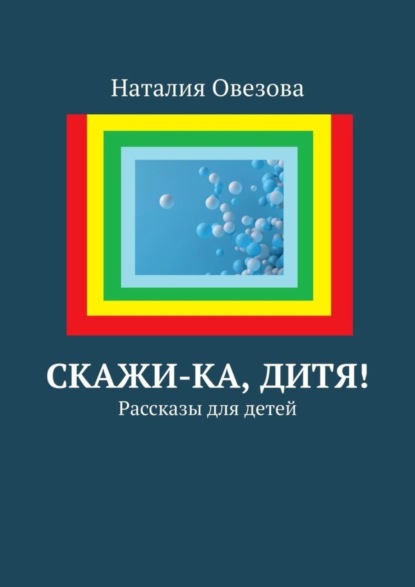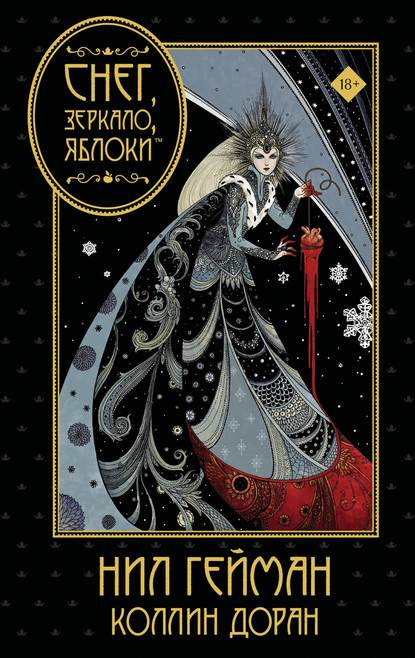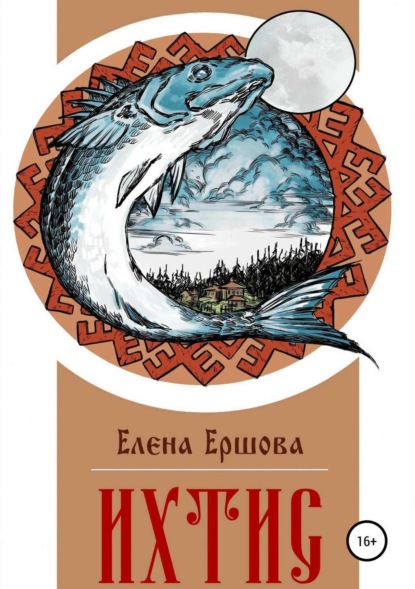- -
- 100%
- +
Dämonen kommen aus unserer Vergangenheit. Es sind die Erinnerungen an Situationen, die uns einmal geschmerzt haben. Wenn wir heute in eine ähnliche Situation geraten, reagieren wir darauf meist wie damals als Kind. Wir fühlen uns vielleicht wieder ohnmächtig, sind verletzt oder ziehen uns zurück und trauen uns nicht mehr, unsere Bedürfnisse zu äußern.
Erinnerungen an vergangene Erlebnisse können uns bis heute so besetzt halten, dass wir nicht frei sind, wie eine Erwachsene zu handeln. Wir sind dann noch in einer Kinderangst gefangen und können nicht Ja oder Nein sagen, nicht für uns einstehen oder uns durchsetzen. Oft tragen wir auch Sätze aus der Vergangenheit in uns, die uns immer noch gefangen halten.
In meinem Seminar zu Maria Magdalena haben Frauen einmal solche Sätze aufgeschrieben, die sie aus ihrer Geschichte in sich tragen. Hier einige Beispiele:
»Ich bin nicht gut genug.«
»Ich bin immer an allem schuld.«
»Sei nicht so faul.«
»Was sagen die anderen?«
»Du bist mir zu viel.«
»Sei perfekt, sonst bist du dumm.«
»Das steht dir nicht zu.«
Wir alle kennen ähnliche Sätze. Sie wirken oft bis heute und können uns unfrei machen, so zu sein, wie wir sind. Das spüren wir, wenn wir uns einmal fragen: »Was hat dieser Satz mit mir gemacht? Wie besetzt war ich davon oder bin es noch?«
Hinter einem Dämon steht die Grundangst, nicht genug geliebt zu sein, für andere nicht genug wert zu sein. Wenn uns diese Angst gefangen hält, dann neigen wir dazu, es allen recht machen zu wollen und uns nach den Erwartungen anderer zu richten. Wir trauen uns nicht mehr zu fühlen, was wir eigentlich fühlen, nicht zu sagen, was wir sagen wollen, nicht so zu leben, wie wir wirklich leben wollen, weil wir in der Angst gefangen sind, von anderen dann nicht genug geliebt zu sein.
Was wir durch Eltern oder Erzieher erfahren haben, sind Formen menschlicher Angst. Sie zeigten sich uns meist in Zeichen von Lieblosigkeit, in unbarmherziger Strenge oder auch im Nicht-Wahrgenommen-Sein, wer wir sind und was wir fühlen. Wenn Eltern selbst nicht zum Leben kommen konnten, weil sie in eigenen Ängsten gefangen waren, konnten sie auch uns nicht zum Leben kommen lassen. Wir versuchten notgedrungen, das Lebendige in uns zu unterdrücken, weil wir als Kind auf ihre Liebe angewiesen waren. Je stärker wir das unterdrücken mussten, desto stärker konnte sich auch unser Komplex oder unsere Angst entwickeln. Sie haben sich in unserem Denken und Handeln oft so festgesetzt, dass sie uns auch heute noch unfrei halten.
Wenn Maria Magdalena von sieben solcher Ängste und Komplexe besetzt war, dann muss es ihr schlecht gegangen sein. Sie muss sich fremd geworden sein und nicht mehr gewusst haben, wer sie eigentlich ist. Es kann auf Dauer auch krank machen, sich hin- und hergerissen zu fühlen zwischen dem, was andere wollen, und dem, was man selbst will. Es ist eine der schlimmsten Ängste, die eigene Identität zu verlieren und keinen Mittelpunkt mehr zu haben, aus dem heraus man für sich entscheidet. Die Angst vor der eigenen Selbstständigkeit kann so groß sein, dass man lieber die Abhängigkeit wählt als die Selbstbestimmtheit. Es bleiben in einem dabei eine tiefe Unsicherheit und das Gefühl, schwach zu sein.
Nicht immer sind uns die eigenen unfreien Seiten bewusst. Wir wundern uns vielleicht, warum wir uns in bestimmten Bereichen nicht wohl mit uns fühlen oder nehmen manche Leiden einfach hin. Oft haben wir uns auch gewisse Haltungen angewöhnt, die uns normal vorkommen, und wir merken nicht, welche Macht dabei noch aus der Vergangenheit in uns wirkt. Der Einfluss früherer Erfahrungen kann sich unterschiedlich ausdrücken.
Die Gekränkte
»Ich bin nicht wichtig«, kann die Gekränkte als frühere Erfahrung verinnerlicht haben. Sie hat Zurückweisung oder Verlassenheit erlebt oder ist nicht wahrgenommen worden. Später wird sie vermutlich wieder mit Menschen in Beziehung kommen, die ihr die alten Erfahrungen bestätigen. Sie erfährt vielleicht wieder Zurückweisung oder Übersehenwerden, und das verletzt erneut ihr Selbstwertgefühl. Es kann auch schon ein harmloses Wort, ein bestimmter Blick oder eine unterlassene Geste zur erneuten Kränkung führen. Als Reaktion darauf wählt die Gekränkte oft das Beleidigtsein. Sie spricht mit dem Betreffenden kaum noch ein Wort, wird vielleicht patzig oder zieht sich ganz zurück. Sie lässt den anderen deutlich spüren, was er ihr Schlimmes angetan hat. Nur – sie sagt nichts! Ihre stumme Vorwurfshaltung soll dem anderen zeigen: »Du bist schuld, dass ich leide.« Diese Haltung kann zur Machtform werden, denn der Kontaktabbruch soll für den anderen wie eine Strafe sein. Der andere ist dann leicht geneigt, die Schuld auf sich zu nehmen, nur um wieder in Kontakt zu kommen.
Auch in der Mutter-Tochter-Beziehung zeigt sich heute immer häufiger die Haltung des Gekränktseins, in der eine von beiden die Beziehung abbricht. Für beide bedeutet es Leiden, weil eine für Frauen wichtige Beziehung der Kränkung geopfert wird. Oft sind Erwartungen nicht erfüllt worden oder gegenseitige Vorwürfe haben einen schwelenden Konflikt verschärft. Wenn dann eine ganz aus der Beziehung aussteigt, kann keine reife Form der Lösung gefunden werden.
Die Gekränkte fühlt sich oft ohnmächtig, sich mit Worten gegen ein unachtsames Verhalten anderer zu wehren. Sie spürt meist nicht den Wert in sich, die Situation für sie selbst zu verbessern. Das Leiden an der Kränkung kann ihr vertrauter sein als das Einstehen für sich. In ihrem Ohnmachtsgefühl kann sie auch so in Rage geraten, dass sie mit Worten um sich schlägt und anderen damit ebenfalls tiefe Kränkungen zufügt.
Manche Menschen nehmen die Gekränkte in ihrem Verhalten nicht mehr ernst. Ihre Handlungsweise wirkt auf sie eher kindlich, deshalb erscheint ihnen die Konfliktlösung auf einer erwachsenen Ebene kaum möglich. Sie spüren das Unfreie in der Gekränkten und aus Schutz für sich selbst wollen sie sich oft nicht mehr auf sie einlassen. Das kann die Gekränkte schließlich einsam machen.
Von diesem Einsamkeitsgefühl erzählte mir eine Frau. Sie war im mittleren Alter und ich begegnete ihr bei einem Vortrag in einem Frauenkreis. Anschließend lud sie mich zum Teegespräch zu sich ein. Sie lebte allein, erzählte davon, dass sie wenig Freundschaften hätte, und beklagte sich darüber, dass andere den Kontakt zu ihr nicht suchen würden. Sie hätte sich lange darum bemüht, aber sich inzwischen damit abgefunden, dass sie für andere scheinbar nicht wichtig sei.
Einige Wochen später fuhren wir gemeinsam mit dem Auto zu einer Veranstaltung. Auf dem Nachhauseweg meinte sie, ich hätte mit einer anderen Frau mehr geredet als mit ihr. Ich war erstaunt über diese Feststellung, wusste aber, dass das nichts mit mir zu tun hatte. Denn das »Mehr« waren gefühlte zwei Minuten. Als ich genauer nachfragte, was das in ihr bewirkt habe, wurde klar, dass es eine alte Kränkung in ihr berührt hatte. Als Kind fühlte sie sich von der Mutter gegenüber ihrer Schwester zurückgesetzt. Dieses Kränkungsgefühl wurde auf mich übertragen. Als ich sie in Heiterkeit fragte, ob sie in Zukunft eine Stoppuhr mit sich tragen wolle, um mir aufzuzeigen, wie viel Zeit ich ihr oder einer anderen Frau widme, konnte sie lachen. Sie erkannte, wie absurd ihr Vorwurf in der Realität war und wie besetzt sie immer noch von ihrer alten Kränkung war. In ihrem Komplex konnte sie nicht sehen, dass sie während der Autofahrt viel mehr Aufmerksamkeit hatte als die andere Frau.
Es ist bezeichnend für einen Komplex des Gekränktseins, dass wir meist die Realität nicht mehr sehen, sondern stattdessen den alten Schmerz nähren: »Ich bin nicht wichtig.« Dann kann man jede Handlung, jedes Wort eines anderen so persönlich nehmen, dass man es sofort als gegen sich gerichtet empfindet. Es wird nicht nachgefragt, wie es gemeint war oder ob es richtig verstanden wurde, sondern der andere wird im eigenen Komplex mitgefangen. Beide erleben dadurch Enge, weil die Angst der Gekränkten im Raum steht: »Ich bin nicht wichtig und damit nicht geliebt und das mache ich dir zum Vorwurf.« Das führt zu Verwirrung, denn der andere wird allein für die Kränkung verantwortlich gemacht, statt dass man sich selbst fragt, was einen so verletzlich macht und wie ein befreiter Umgang damit möglich sein könnte.
Die Minderwertige
»Ich bin nicht gut genug«, ist ein Satz, den eine Frau mit einem geringen Selbstwertgefühl nur zu gut kennt. Ihr wurde in der Vergangenheit meist vermittelt, dass etwas an ihr nicht richtig ist, dass sie nicht schön genug, nicht schlau genug oder nicht tüchtig genug ist. Dabei wurde sie gerne mit anderen verglichen, und in diesem Vergleich kam sie generell als die Schlechtere weg. Lob und Anerkennung erfuhr sie meist spärlich, und wenn doch, dann eher als Antrieb, noch besser zu werden. Das Bestehende war nicht gut genug.
Eine Frau entwickelt durch solche Erfahrungen ein Wertgefühl, das nur vom Urteil anderer abhängt. Bewerten andere sie negativ, empfindet sie sich als weniger wert und mag sich auch weniger. Zeigen sie ihr Anerkennung, fühlt sie sich wertvoller und mehr geliebt. Sich selbst fragt sie meist selten: »Wer bin ich ohne das Urteil der anderen?«
Wenn ich den Satz »Ich bin nicht gut genug« aufgreife und Frauen weiterfrage: »Für wen bin ich nicht gut genug?«, dann kommt häufig die Antwort: »Für mich.« Die Erfahrung aus der Vergangenheit sitzt so tief, dass es jetzt die erwachsene Frau selbst ist, die sich als nicht gut genug bewertet.
Es sind aber auch andere, denen gegenüber sie sich geringer fühlt. Sie schätzt diese in ihren Begabungen meist höher ein als sich selbst. Ihre eigenen Fähigkeiten erscheinen ihr als nichts Besonderes. Wenn der Komplex in ihr wirkt, dann nimmt sie oft ihren Platz nicht ein, der ihr offensteht. Sie stellt sich lieber in die zweite Reihe und lässt andere vortreten, ob beruflich oder privat. Ihre Selbstzweifel hemmen sie oft, ihr ganzes Potenzial zu zeigen. Sie bleibt dann hinter ihren Möglichkeiten zurück, weil sie sich nicht kompetent genug fühlt. Größere Herausforderungen lehnt sie ab, weil sie vermutlich Angst hat, ihnen nicht gewachsen zu sein. Beruflich setzt sie sich deshalb eher kleine Ziele, weil sie nicht an ihren Erfolg glaubt.
Der Dämon, sich nicht wertvoll zu fühlen, zeigt sich oft schon in der Körperhaltung. Eine Frau strahlt dabei häufig Unsicherheit aus, als würde sie empfinden: »Bin ich hier richtig? Darf ich hier sein? Mich unsichtbar zu machen ist besser, als mich zu zeigen. Jemand könnte mich sonst kritisieren.«
Mit diesem Komplex fällt es einer Frau auch schwer, ein Kompliment anzunehmen. Da sagt ihr zum Beispiel eine andere, dass sie ein schönes Kleid anhat, und sie antwortet: »Ach, das habe ich schon lange« oder »Das war ganz billig«. Den zugesprochenen Wert anzunehmen und zu erwidern: »Danke, das freut mich«, ist ihr wenig vertraut.
Ein Ehemann beklagte sich darüber, dass es für ihn schwer sei, seiner Frau ein Kompliment zu machen. Sage er ihr, dass sie heute schön aussehe, habe sie immer noch etwas an sich zu mäkeln. Entweder fühle sie sich zu dick oder ihre Haare fielen nicht richtig oder das Kleid sitze nicht gut. Er meinte, er könne ihr sagen, was er wolle, sie würde es nicht annehmen. Sie würde ihn dabei auch gar nicht ernstnehmen, nach dem Motto: Das sagt er nur, weil er mich durch eine rosa Brille sieht. Andere werden mich viel kritischer ansehen und gleich erkennen, was nicht passt.
Das mindere Wertgefühl macht es in Beziehungen meist schwierig. Es kann für ein Gegenüber anstrengend sein, den anderen ständig aufzuwerten, wenn er oder sie sich permanent kleiner macht.
Wenn eine Frau ihren weiblichen Wert nicht genug schätzt, kann sie auch dazu neigen, den Mann zu überhöhen. Sie ordnet sich seinen Vorstellungen möglicherweise unter oder lässt negative Bewertungen durch ihn zu. In ihrer sexuellen Beziehung bestimmt dann auch meist der Mann, was er will, und sie fügt sich dem, ohne klar zu sagen, was sie möchte. Oder sie sagt zu allen sexuellen Wünschen Nein, weil manch erfahrene Kränkung so an ihr nagt, dass sie keine intime Nähe mehr will. Darüber wird meist nicht offen gesprochen, stattdessen führt dieser Zustand eher zu Vorwürfen des Mannes und zum schlechten Gewissen bei der Frau. Neben ihrer Ablehnung hat sie insgeheim auch das Gefühl, im sexuellen Bereich für ihren Mann nicht gut genug zu sein. Damit wäre ihre frühere Erfahrung wieder bestätigt.
Eine andere Variante dieses Komplexes: Eine Frau neigt dazu, ihren Partner ständig infrage zu stellen. Sie ist dann vermutlich überzeugt davon, dass ihre weibliche Art die bessere ist. Wie er die Dinge im häuslichen Bereich handhabt, wie er mit seinen Gefühlen umgeht oder wie er Auto fährt – sie versucht ihm zu vermitteln, dass er es doch so machen solle wie sie. Das Anderssein des Mannes sieht sie als geringer an als ihre weibliche Art. Sie kann ihm dadurch vermitteln: »Deine männliche Eigenart ist nicht gut genug« und durch ihre Abwertung versuchen, ihren geringen Wert aufzuwerten. Anstrengende und unfruchtbare Machtkämpfe werden die Folge sein.
Wenn Frauen das Weibliche in sich zu gering bewerten, kann ihnen das Nachahmen des Männlichen als wertvoller erscheinen. Sie verbinden es vielleicht mit dem Wunsch nach mehr Anerkennung oder sie möchten beweisen, dass sie dem Männlichen in nichts nachstehen. Ob dieser Weg aus einer inneren Freiheit heraus oder aus einem geringen weiblichen Selbstwertgefühl gewählt wird, kann jede Frau nur selbst beantworten. Wenn Frauen sich dabei auch in männlicher Kleidung wohler und wertvoller fühlen, ist das ihre persönliche Entscheidung. Im umgekehrten Sinn würde es bedeuten, dass Männer gleichermaßen weibliche Kleidung wählen, um sich als Mann wohler und wertvoller zu fühlen. Das würden Männer allerdings nicht tun, abgesehen von wenigen Ausnahmen.
Sollten Frauen in beruflichen Beziehungen als Vorgesetzte oder Kollegin in ihrem Selbstwertkomplex feststecken, dann wird es für Mitarbeiter schwer. Mit diesem Dämon in sich können sie die gute Arbeit anderer selten stehen lassen oder anerkennen. Meistens finden sie immer noch etwas, das nicht passt. Oder sie teilen verbale Spitzen aus, die andere persönlich treffen sollen, damit diese sich minderwertig fühlen. Vielfach erreichen sie das auch.
Wir kennen alle von Zeit zu Zeit Phasen, in denen wir ein geringes Selbstwertgefühl haben. Dann gehen wir meist nicht sehr liebevoll mit uns um. Wir kümmern uns vielleicht zu wenig um unseren Körper, neigen dazu, uns für andere aufzuopfern oder bewerten uns im Vergleich zu anderen als weniger stark. Und zeitweise lassen wir uns von den minderen Wertgefühlen anderer verunsichern, bis wir merken, dass wir uns damit selbst schwächen. Wir finden meist selbst wieder zu unserem eigenen Wert zurück und entscheiden dann, uns nicht weiter von Zweifeln beherrschen zu lassen.
Die Schuldbeladene
»Ich bin an allem schuld« ist ein Satz, den eine Frau mit der Erfahrung von ungerechter Schuldzuweisung in sich trägt. Sie kennt das Gefühl, zum Sündenbock gemacht zu werden für Situationen, die nicht gelingen, oder für Konflikte, die in Beziehungen auftauchen. Jemand weist ihr die Schuld daran zu, und sie ist bereit, diese auf sich zu nehmen. Sie hält an der Erfahrung fest, dass sie schuldig ist, wenn sie in den Augen anderer etwas falsch macht. Das wird ihr zum Komplex. Sie wird dann eher einen Partner haben, der ihr in einem Konflikt vermittelt: »An dieser Situation bist du schuld. Du brauchst dich nur anders zu verhalten, dann haben wir kein Problem.«
Dann wird sie diejenige sein, die sich für ihre vermeintliche Schuld bald entschuldigt, während ihr Partner kein Wort über die Lippen bringt. Sie nimmt auch seinen Teil der Verantwortung auf sich, weil es ihr vertraut ist, für viele Schwierigkeiten allein verantwortlich gemacht zu werden.
Das kennen viele Frauen schon aus ihren Elternbeziehungen, wenn sich diese als unfehlbare Autorität gesehen haben. Sie erkennen in Konfliktsituationen dann selten den eigenen Anteil und sind kaum fähig, sich zu entschuldigen. Jegliche Schuld wird im Verhalten der Tochter gesehen, was viele Frauen innerlich resignieren lässt. Aus ihnen kommt dann oft der verzweifelte Satz: »Ich weiß schon, ich bin an allem schuld.« An diesem Punkt machen sie sich selbst klein und blockieren jede Konfliktlösung.
Wir erleben heute in vielfacher Weise, dass Menschen gerne jemanden schuldig sprechen, aber gleichzeitig jegliche Schuld von sich weisen. Sie werden dabei von der gleichen Angst beherrscht, die zum Dämon werden kann: an etwas schuld zu sein bedeutet, nicht geliebt zu sein.
Nicht wenige Frauen erleben das auch bei einer Trennung. Sie halten unglückliche Zustände oft lange aus, fühlen sich emotional vielleicht schon länger verhungert, finden aber keinen Weg, um mit dem Partner mehr Lebendigkeit in die Beziehung zu bringen. Womöglich spricht der Partner wenig über sich, vergräbt sich vielleicht in beruflicher Arbeit oder zeigt ein Gefühl der Gleichgültigkeit gegenüber der Paarbeziehung. Sein Ehebild ist womöglich mehr auf Versorgung ausgerichtet als auf gegenseitige Nähe. Manche Partner stehen auch nur mit einem Bein in der Beziehung, mit dem anderen sind sie irgendwo außerhalb. Frauen versuchen dann oft, sie hereinzuholen und ein ganzes Ja von ihnen zu spüren statt nur ein halbes. Das wird von manchem Partner nicht verstanden oder als Bedrängung empfunden. Wenn eine Frau dann irgendwann die Konsequenzen zieht und sich aus der Beziehung löst, wird ihr die Schuld zugewiesen: »Du wolltest ja gehen. Ich wollte keine Trennung.«
Manchmal sind es dann sogar die Eltern oder auch die eigenen Kinder, die die Frau wegen ihrer Entscheidung schuldig sprechen. Nach deren Urteil hätte sie die Aufgabe gehabt, die Ehe weiterzuführen und den Kindern den Schmerz zu ersparen. Wenn eine Frau den Komplex in sich trägt »Ich bin an allem schuld«, wird sie die zugewiesene Schuld eher annehmen als zurückweisen. Sie wird auch die Lieblosigkeit annehmen, weil sie insgeheim denkt: »Ich bin nicht liebenswert, sonst hätte mein Partner mir das mehr gezeigt.«
Ihr Wertesystem sagt ihr vielleicht auch, dass sie um jeden Preis an der Beziehung festhalten sollte und dass sie egoistisch wäre, wenn sie es nicht tut. Ihre innere Wahrheit aber sagt ihr, dass sie das unter den jetzigen Umständen nicht kann. In diesem Zwiespalt tauchen ganz natürlich Schuldgefühle auf. Sie stehen im Widerstand zu dem, das in uns ist. Die innere Norm und die eigene Wahrheit stimmen nicht mehr überein.
Wenn eine Frau aber von Schuldgefühlen besetzt ist, wird sie sich trotz ihrer Wahrheit immer wieder mit den Gedanken quälen: »Hätte ich doch nur … Wieso habe ich nicht daran gedacht? Es ist unverzeihlich, so zu handeln!«
Wir werden in jeder Beziehung einem anderen etwas Unrechtes tun und etwas Unrechtes von ihm erfahren. Das gehört zur menschlichen Erfahrung. Deshalb gehören auch Schuldgefühle zu dieser Erfahrung. Wenn wir erkennen, dass wir jemandem etwas schuldig geblieben sind, bedeuten Schuldgefühle, dass wir ein gesundes Empfinden haben. Sie helfen uns zu überprüfen, ob wir etwas Unrechtes getan und eine wirkliche Schuld auf uns genommen haben. Zu dieser möglichen Schuld zu stehen und unser Verhalten zu korrigieren, ist ein Zeichen menschlicher Stärke und Reife. In dieser Weise können Schuldgefühle zu einer befreienden Handlung führen.
Sie wirken aber einengend, wenn wir uns schuldig fühlen, weil wir unseren inneren Maßstab nicht erreichen. Er ist manchmal so hoch gesetzt, dass wir uns überfordern. Wir gestehen uns das oft nicht ein und belasten uns stattdessen mit Schuldgefühlen, weil wir nicht zu unserer Grenze stehen.
Frauen erleben das häufig in ihren beruflichen oder familiären Verpflichtungen. Sie haben ein Idealbild in sich, was sie alles leisten und um wen sie sich ausreichend kümmern wollen. Der reale Alltag zeigt dann oft, dass die eigene Einschätzung zu hoch war. Die Gedanken, sich aus zu vielen Pflichten zu befreien und wieder mehr Lebensfreude zu spüren, lösen manchmal schon Schuldgefühle aus. Sie können aber zu einer Befreiung führen, wenn wir nachfragen, ob unsere Gefühle eine wirkliche Schuld darstellen oder ob wir nur an unserem hohen Maßstab schuldig werden.
Die Neidvolle
»Ich habe nicht genug«, dieser Satz entspringt dem schmerzhaften Erleben einer Frau, wenn sie in irgendeiner Weise zu kurz gekommen ist. Ob es um elterliche Zuwendung oder deren Unterstützung oder um materielle Wunscherfüllung ging, es war nicht genug. Stattdessen waren es andere, die ihrem Empfinden nach das bekommen haben, was sie sich wünschte. Mit dem erfahrenen Mangel waren meist Gefühle von Enttäuschung und Traurigkeit, von Hass und Wut verbunden. Konnte sie als erwachsene Frau ihren Schmerz nicht verarbeiten, sodass er bis heute in ihr nagt, kann er leicht zum Neidkomplex werden. Dabei ist sie von der Angst besetzt, weniger zu haben als andere und dadurch benachteiligt zu sein. In dieser Angst ist der eigene Blick getrübt und die reale Situation wird nicht klar gesehen.
Wenn eine Frau in diesem Komplex feststeckt, sieht sie all die Dinge, die sie nicht hat oder nicht ist, als wesentlich wertvoller an als das, was sie ist oder schon besitzt. Sie neidet anderen dann gern ihren »Reichtum«, weil sie meint, dass sie das Bessere haben. Sie verbindet mit mehr Besitz, mehr Geld oder größerem Erfolg naturgemäß auch mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Das verspricht ein besseres Lebensgefühl und mehr Vorzüge als die eigene Eingeschränktheit.
Die einen fühlen sich vom besseren Leben anderer so angezogen, dass sie sich in Bewegung setzen und versuchen, etwas davon für sich zu erreichen. Sie sagen sich vermutlich: »Das kann ich auch schaffen!« Die anderen wollen die Anstrengung nicht auf sich nehmen, trauen sich womöglich auch nicht viel zu und meinen: »Das kann ich sowieso nie erreichen!« Vielleicht hat eine Freundin die schlankere Figur, aber sie selbst will die Disziplin dafür nicht aufbringen. Um nicht daran zu leiden, dass sie nicht das gleiche Resultat erzielt, wertet sie ihre Freundin ab. Sie macht deren Bemühungen eher lächerlich, um sich dadurch besser zu fühlen.
Wieder andere sehen, was sie nicht haben, andere jedoch haben, und beneiden diese Menschen auch. Sie können sich aber zugleich für sie freuen und sich eingestehen, dass das für sie in gleicher Weise nicht unbedingt passen würde. Sie kennen Neid, lassen sich davon aber nicht besetzen.
Gefühle von Neid kommen aus einem selbst. Sie haben nichts mit anderen zu tun, sondern mit dem eigenen Gefühl, nicht genug an gutem Leben zu haben.
Wenn eine Frau in ihrem Neid-Komplex gefangen ist, kann sie leicht bitter werden. Aus ihrer Bitterkeit heraus setzt sie häufig eine andere Frau herab in dem, was diese hat oder ist. So kann sie sich moralisch überheben und wird beispielsweise jede Form von finanziellem Reichtum herabwürdigen. Die neidvolle Seite in einer Frau macht sie freudlos. Sie sieht vorwiegend den Mangel in ihrem Leben und nicht, was sie auch erreicht hat. Dadurch mangelt es ihr zugleich an Dankbarkeit.
In Paarbeziehungen neidet einer dem anderen manchmal das, was dieser gerade mehr bekommt. Haben sich beide zum Beispiel entschieden, dass die Frau als Mutter mehr Zeit für ihre Kinder und weniger Zeit für ihren Beruf aufbringt, löst das bei ihr doch häufig Neid auf ihren Mann aus. Sie fühlt sich in ihren Mutteraufgaben weniger gesehen als in ihren beruflichen Aufgaben und neidet dem Mann dieses Mehr an vermeintlicher Anerkennung, an beruflichem Engagement oder an Geld. Der Mann neidet seiner Partnerin insgeheim, dass sie mehr Zeit mit den Kindern verbringen und vielleicht Spaziergänge machen kann, während er in seiner Arbeit feststeckt. Ihr gegenseitiger Neid zeigt sich oft in Sticheleien, die sie sich zufügen.
Doch der Neid entsteht nicht durch die Situation, sondern durch die Wertschätzung, die beide sich nicht geben. Wenn die tägliche Arbeit einer Mutter oder im Haushalt so selbstverständlich gesehen wird, dass sie keiner besonderen Achtung mehr bedarf, dann verwundert es nicht, dass eine Frau mit Neid auf das schaut, was ihrer Meinung nach mehr Achtung bekommt. Wenn die beruflichen und die familiären Aufgaben, die ein Mann übernimmt, der Frau keiner Anerkennung mehr wert sind, dann erleben beide diesen Mangel an Wertschätzung. Dies führt schnell zu Neid und daraus zu Abwertung. Obwohl beide diesen Mangel erleben, findet oft keiner heraus, um den ersten Schritt in ihre gegenseitige Wertschätzung zu tun. Sie könnten dadurch ihren Neid auflösen und zu mehr Achtung füreinander finden.