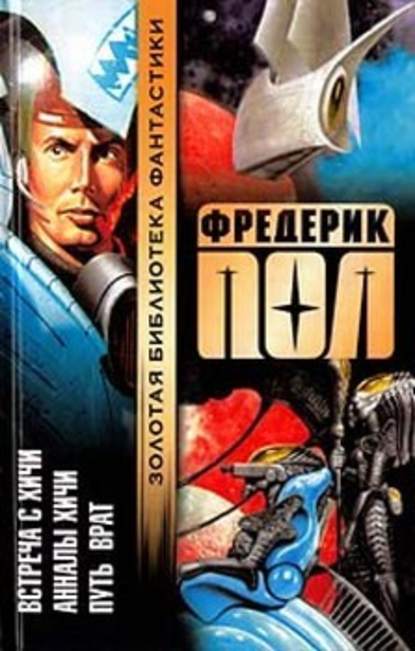Mary und das geheimnisvolle Gemälde
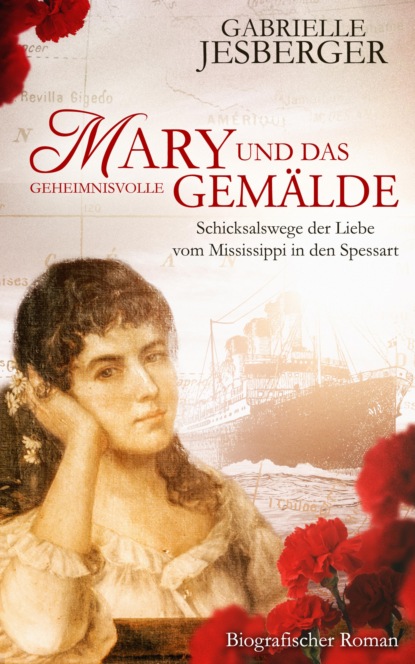
- -
- 100%
- +
Vereinzelt kamen die Meldungen von gefallenen Soldaten aus den Nachbarorten. Zu wissen, dass draußen der Kampf tobte, die Männer der Familie bis auf den alten Opapa und den neunzehnjährigen Franzkarl, den Dickel, noch zu Hause waren, machte die plötzliche Ruhe im Haus fast unerträglich.
Ende Mai 1940 meldeten die Nachrichten grandiose Erfolge, wie sie angeblich die Weltgeschichte noch nie erlebt hatte. Else schrieb euphorisch an Lu: Alles wird beseelt von dem einen Manne, der Deutschlands Glück und Hoffnung ist, und wie Du schreibst, die Weltgeschichte gestalten wird.
Franzl, als Kind der kleine Rebell in der Familie, von dem Opapa manchmal kopfschüttelnd sagte: „der Bub ist wie ein kleines Füllen, das um sich schlägt, wenn man ihm zu nah kommt“, wurde in letzter Zeit sehr still. Jetzt, wo auch Edgar, Annemaries Mann, eingezogen worden war und Willi, Liselottes Mann, bei den Luftlandetruppen kämpfte und bereits das Eiserne Kreuz erhalten hatte, fühlte sich auch Franzkarl mitgerissen von der Euphorie, die die Feldpostbriefe ins Haus brachten, war er doch mit seinem Bruder Richard durch ihre gemeinsame Zeit in der Hitlerjugend längst eingestimmt: „Meine Ehre heißt Treue“, klang es begeistert im Chor. „Auch Willi ist ein willensstarker, großartiger Kämpfer!“, rief Else anerkennend aus.
Franzkarl traute sich allerdings noch nicht, der Familie seine Pläne zu offenbaren, da er wusste, seine Schwester Lilo war dagegen. Wie in einer Vorahnung gab sie sich alle Mühe, ihren Bruder zurückzuhalten, sich bei der Luftwaffe zu melden.
Über das Grauen des Krieges, die Leiden der Soldaten, die Erschöpfung, wie sie es aushalten konnten, auf Menschen zu schießen, die Schmerzensschreie der Verwundeten und Sterbenden zu erleben, sprach keiner und auch in den Feldpostbriefen wurde nur von den Heldentaten berichtet. Selbst nach dem Krieg blieb diese Haltung unverändert und somit konnten die Traumata noch lange nicht aufgearbeitet und damit nicht geheilt werden. Aber es gab auch andere Stimmen, wie der Soldat Emil G. in einem authentischen Feldpostbrief am 24.06.41 über die verhungerten Kinder des Warschauer Ghettos schrieb, das er kurz gesehen hatte: Im letzten Krieg brachte das Ausland Bilder von abgehackten Kinderhänden. Und nun dies! Die Wahrheit ist schlimmer, grausamer, viehischer als alle Phantasie.
In der Wochenschau im Kino, zu der Franzl seine Mutter 1941 nach Aschaffenburg begleitete, sahen sie auf großer Leinwand den Einsatz des neuen Vormarsches. Ergriffen äußerte sich Else auf dem Weg zum Bahnhof: „Die Bilder waren so atemberaubend, gleichzeitig grauenvoll, aufregend, beinahe unfassbar und doch so überzeugend glaubhaft.“ Worauf Dickel erstaunt feststellte: „Warum haben unsere Soldaten denn noch keine Kriegsgefangenen?“ Immer noch tief bewegt von den Eindrücken gingen sie schweigend nebeneinander her bis Mutch die Stille unterbrach: „Franzl, meinst du nicht auch, die Leistungen unserer Soldaten grenzen ans Wunderhafte und doch sind bei allem die Opfer nicht allzu groß, man muss es gesehen haben!“ Für Franzkarl war dieser Satz seiner Mutter wie ein Weckruf. Bereits einige Wochen später befand er sich in der Kampffliegerschule Greifswald. Er hatte sich noch im Herbst 1941 freiwillig gemeldet. Was macht die kleine Schmütze (Inge) und Burschi, unser Wölflein (Wolfgang)? Jetzt können sie bald nicht mehr im Freien spielen. Na, unser Haus ist ja groß genug. Heil Hitler, Dein Franzkarl, schrieb er beschwingt an seine liebe Mutch, während er sich auf seinen ersten Flug mit der Messerschmitt freute.
Else begann nun wieder, wie fünfundzwanzig Jahre zuvor während des Ersten Weltkrieges, diesmal mit ihren Töchtern Lilo und Mie, ihren Männern Päckchen mit Lebensmitteln an die Front zu schicken. Die Familie zu Hause kam kaum vom Radio weg, bei jeder neuen Meldung wurde es laut aufgedreht, dass es durch das ganze Haus hallte. Die Zeitungen wurden verschlungen, die Siegesmeldungen verbreiteten eine euphorisches Stimmung und waren so wuchtig und gewaltig, dass keine Zweifel an einem baldigen Sieg aufkommen konnten.
Die Demütigung durch den verlorenen Ersten Weltkrieg gipfelte in Hitlers Versprechen, die er in einstudierten Parolen und Gesten verkündete. Die „Inszenierung von Massenerleben“ traf auf die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, dem Entkommen einer inneren Leere. Die Gesinnung in der Bevölkerung allerdings spaltete sich.
Wie deutsche Konzerne massiv vom Krieg und von Konzentrationslagern profitierten, zeigt das abschreckende Beispiel in einem Artikel des Handelsblattes: Der Konzern, der Hitler den Weltkrieg ermöglichte. Das dunkelste Kapitel der IG-Farben (u. a. Bayer) war wesentlich geprägt durch die Giftgas-Produktion und dem Bau der riesigen Buna-Fabrik mit dem eigenen KZ Auschwitz-Monowitz. Hier ließen Zehntausende KZ-Häftlinge ihr Leben. Was im benachbarten Vernichtungslager Birkenau passierte, dürfte den Verantwortlichen der IG-Farben mit Sicherheit bekannt gewesen sein, zumal das für die Vergasung verwendete Zyklon B von einer Tochterfirma der IG-Farben produziert wurde. Der Konzern lieferte einen entscheidenden Beitrag zum Ausbau des Konzentrationslagers in eine industrialisierte Mordmaschinerie, in der etwa 1 ½ Millionen Menschen umgebracht wurden. […] Es ist die Geschichte von Firmenlenkern, die für den Profit die Ermordung von Zehntausenden Menschen duldeten - ja sogar anordneten. Sie wurden als Kriegsverbrecher (wegen Versklavung und Massenmord) verurteilt. Als sie aber wegen „guter Führung“ schon nach zwei Jahren das Gefängnis verließen, stand die Limousine schon bereit. Sie alle bekamen wieder gute Jobs und trafen sich im Februar 1959 zu einem glanzvollen Wiedersehensbankett […]. H. Bütefisch, SS-Obersturmbannführer (im Freundeskreis H. Himmlers), als Wehrwirtschaftsführer für Auschwitz zuständig und von Hitler mit dem Ritterkreuz dekoriert, bekam in der BRD später das Bundesverdienstkreuz verliehen. Auch der IG-Farben-Manager O. Ambros, Ritterkreuzträger, Schulfreund von H. Himmler und Hauptverantwortlicher für Auschwitz-Monowitz, machte ebenfalls wieder Karriere u. a. beim Contergan-Hersteller. Heute würden sie vom Kriegsverbrechertribunal Den Haag zu lebenslänglich verurteilt.
Das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte mussten jedoch Mary und ihre Eltern nicht mehr erleben.
Unser Führer gibt dem Volke doppelte Kräfte, Vertrauen und Stärke. Unsere Soldaten leisten wieder Übermenschliches. Richard ist seit Führers Geburtstag nun wie Franzkarl auch Obergefreiter, schrieb im Mai 1942 Else voller Stolz im Feldpostbrief an ihren Mann. Ihr Bruder Franz befand sich immer noch als Lazarett-Arzt an der Ostfront. Von den Russen wurden Flugblätter abgeworfen, die einige Mutige an sich nahmen, obwohl es unter Androhung der Todesstrafe streng verboten war:
Lesen und weitergeben! Ein neues Hitlerabenteuer gescheitert! Deutsche Soldaten! Hitlers Plan einer blitzartigen Zerschmetterung der Roten Armee ist gescheitert. Nicht allein, dass die deutschen Truppen nicht vorwärts kommen, die Gegenschläge der Roten Armee bringen ihnen gewaltige Verluste bei. Um das Scheitern seiner Pläne vor den Augen der Armee wettzumachen, hat Hitler Luftangriffe auf Moskau und Leningrad angeordnet. […] Wie ist dieses neue Abenteuer ausgegangen? Bisher wurde auf Leningrad keine einzige Bombe abgeworfen. […] Die deutsche Luftwaffe hat über Moskau bereits 150 Flugzeuge und ihre besten Flieger eingebüßt. Das sind die Resultate! Mit einem Fiasko endet jedes neue Abenteuer Hitlers! […] mit der Vernichtung Hitlers und seiner Bande, wird auch dieser ganze sinnlose und hoffnungslose Krieg gegen Sowjetrussland enden! Deutsche Soldaten! Denkt an Euch und Eure Familien! Denkt an das Schicksal Deutschlands, das einem Verbrecher und Abenteurer wie Hitler in die Hände gefallen ist! Macht Schluss mit dem Krieg! Geht über auf die Seite der Roten Armee!
Darunter war eingerahmt zu lesen: Dieses Flugblatt gilt als Passierschein zum Übergang auf die Seite der Roten Armee. Wer allerdings mit einem solchen Passierschein desertierte und dabei von seinen eigenen Leuten erwischt wurde, kam nicht lebend davon. Wie es einem deutschen Soldaten erging, wenn ihm der Übergang zur Roten Armee gelang, bleibt Spekulation.
Um Richard, der nach 50-jährigem Einsatz als Arzt im Spessart seine Tätigkeit aufgeben musste, weil er selber das Nachlassen seiner Kräfte spürte, war es immer stiller geworden. Die Zahl der Freunde, die ihn regelmäßig besuchten, wurde kleiner. Einer der wenigen, der immer noch gerne zu einem Gedankenaustausch bei einem Schoppen Wein vorbeikam, war Valentin Pfeifer. Der über die Landesgrenze bekannte Lehrer und Autor der „Spessartsagen“ sammelte alte Sagen der Region, schrieb sie nieder in seinem Buch und erhält sie damit für die Nachwelt. Valentin machte sich zunehmend Sorgen um seinen alten Kameraden. Doch Richard winkte lachend ab: „So schnell, alter Freund, wirst du nicht an meinem Grab stehen müssen. Es ist noch nie ein Wehsarg unter achtzig gestorben!“
Dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Reiches im Frühjahr 1945, von dem Richard sich als überzeugter Patriot so viel für sein geliebtes Vaterland versprochen hatte, folgte der völlige Rückzug des altgewordenen Doktors aus seiner bereits altersgemäß eingeschränkten Praxistätigkeit.
In ihm – wie in den meisten seiner Generation – lebte die Heimatliebe im Geist der alten Burschenschaften (im Liedtext von Hoffmann von Fallersleben 1839 geschildert) weiter:
Treue Liebe bis zum Grabe
schwör ich dir mit Herz und Hand;
was ich bin und was ich habe,
dank ich dir mein Vaterland!
Nicht in Worten, nur in Liedern
ist mein Herz zum Dank bereit,
mit der Tat will ich’s erwidern
dir in Not, in Kampf und Streit. […]
Die Härten des Krieges, von denen die Bevölkerung zwar auf dem Land in ihrem Alltag weitgehend verschont geblieben war, trafen auch seine Familie grausam. Sein hoffnungsvoller Enkel Franzkarl, der Spaßvogel der Familie, der wie er immer zu einem Scherz aufgelegt war, und den er so gerne um sich hatte, war als Kampfpilot 1944 mit seinem Jagdflugzeug über Le Havre abgeschossen worden. Er selbst hatte die Nachricht entgegengenommen. Bevor er das Bündel, das dem Schreiben an die Eltern, der Sohn sei im Kampf für das Vaterland gefallen, öffnete, nahm er es an sich, um am Abend, wenn Ruhe im Haus eingekehrt war, sich zuerst Lilo anzuvertrauen. Mit zitternden Händen, kein Wort kam über seine Lippen, übergab er ihr die Unterlagen.
Lilo ließ sich auf den nächsten Stuhl sinken und las:
An die Mutter
Der Tag ist geschwunden,
das Licht weicht der Nacht.
Vor dem Zelt wird ein Feuer entfacht.
Ich schau in die Flamme
und denke an dich.
All‘ was es gibt,
das bist du für mich.
Da taucht mir im Schimmer
dein Bild aus der Glut,
ganz wie du bist, so lieb und so gut.
Es ist so wie früher,
du redest zu mir.
Ich höre dir zu
und bin ganz bei dir.
Die Flamme wird kleiner,
sie ist fast verglimmt.
Ich merke, dass sie dein Bild von mir nimmt.
Nun trennen uns Länder.
Was macht es denn schon,
sind wir doch eins,
du und dein Sohn.
Er hatte das Gedicht auf dem Luftwaffenstützpunkt in Catania auf Sizilien verfasst und nun lag es bei dem Abschiedsbrief, den er, wie alle Soldaten, vor dem Einsatz schreiben musste für den Fall seines Todes. Wie sehr hatte Lilo - in Vorahnung des „Todeskommandos“ - ihren Bruder beschworen, sich nicht für die Luftwaffe, sondern für die Infanterie zu melden. Franzkarl war so jung, so euphorisch und fühlte sich nutzlos, nach dem Abitur nur zu Hause herumzusitzen, während sein jüngerer Bruder, sein Vater, sein Onkel und seine beiden Schwager ihm ein Vorbild waren, weil sie als „Helden im Einsatz für das Vaterland“ ihr Leben riskierten. Alle gutgemeinten Worte der Schwester hatten Franzl von seinem Vorhaben nicht mehr abbringen können. Sein jugendlicher Optimismus hatte alle aufkommenden Zweifel hinweggefegt.
Im Laufe des Krieges wurde Lilos Mann so schwer verwundet, dass er lange in Lebensgefahr schwebte und zuletzt nur - wegen noch nicht verfügbarer Antibiotika - durch die Amputation eines Beines gerettet werden konnte. Nach seinen vorhergehenden Verwundungen (Streifschuss im Genick, Gehörschädigung, Teillähmung der Hand) war er nun zu hundert Prozent kriegsversehrt. Seine Kameraden meinten scherzhaft, aber bewundernd, er sei wohl mit dem „Teufel im Bunde“, dass er dem Tode so oft entronnen sei. Die Zertrümmerung seiner beiden Knie war seine fünfte Verwundung, die die Amputation des linken Beines bis über das Knie zur Folge hatte. Nun wurde Willi als Oberstleutnant zum Kompanie-Chef der ersten Panzergrenadier-Ausbildung ernannt und als Hauptmann mit seiner Kompanie in der Kampfgruppe Schwarzrock bei Forst an der Neiße zur Abwehr der Russen eingesetzt. Dort wurde er schon am zweiten Tag beim Überfahren einer Panzermine verwundet, die irrtümlich von einer Panzer-Abwehr-Kompanie verlegt worden war. Er kam in ein Lazarett in Schleswig und von dort in die englische Gefangenschaft, wo er nach drei Monaten wieder entlassen wurde. Im Mai 1942 wurde ihm das Deutsche Kreuz in Gold und einen Monat später das Verwundeten-Abzeichen in Gold verliehen.
Das Brüderchen des dreijährigen Wolfgang kam zur Welt, während ihr Papi zur gleichen Zeit schwer verwundet im Städtischen Krankenhaus in Aschaffenburg lag. Beinahe jede Nacht mussten beim Fliegeralarm eiligst die Patienten in den Luftschutzkeller transportiert werden. Die Einschläge und die Erschütterungen waren bis in den Schutzraum zu spüren. Udo, der neue Erdenbürger, lag beschützt in Mamis Arm, die im Rollstuhl in Sicherheit gebracht wurde.
Der Sommer 1944 brachte eine weitere Schreckensnachricht: Annemaries Mann Edgar war gefallen, die kleine Tochter Inge war gerade erst fünf Jahre alt.
Kurz darauf reiste Lilo mit dem einjährigen Udo zu ihrem Mann nach Cottbus, der sich trotz seiner schweren Verletzungen wieder zum Einsatz als Ausbilder einer Kompanie gemeldet hatte. Lilo war in großer Sorge um seine Gesundheit. Die Mutter und Schwester unterstützten ihren Entschluss. Den vierjährigen Wolfgang wusste sie gut behütet im Elternhaus. Mit der kleinen Inge konnte er unbeschwert von den Kriegsereignissen im Haus und im Garten spielen.
In Cottbus war Willi in Wartestellung mit seinen Männern für den Einsatz. Neben der Kaserne stand eine Wohnung für den Kompanieführer zur Verfügung. Durch die liebevolle Pflege seiner Frau erholte sich Willi zusehends und die Freude über den kleinen Sohn, den er nun täglich sehen konnte, trug mit zu seiner Genesung bei.
Bei den täglichen Übungen und Märschen war die Kompanie unvermutet auf eine große Herausforderung gestoßen: Lilo stand in der Küche am Herd. Der kleine Udo saß zufrieden in seinem Laufställchen (ein Gitter ohne Boden) im Schatten eines Baumes im Garten und spielte mit Bauklötzen. Frei laufen konnte er noch nicht, aber das Hochziehen und sich auf diese Weise - mit seiner „Gehhilfe“ – Schritt für Schritt fortzubewegen, machte ihm sichtlich Vergnügen. Seine Mami lief zum Fenster, als sie das laute Kommando hörte: „Kompanie halt!“ Mit offenem Mund stand ihr kleiner Sohn mit seinen Händchen am Laufgitter mitten auf dem Weg und versperrte so den Marsch. Aus der kurzen Hose hing um die nackten Beinchen - ausgerechnet jetzt - die vom Inhalt verschmierte Windel. Mit großen Augen sah Udo zu den Männern auf und bewegte sich keinen Millimeter weiter. Mit eiserner Disziplin bemühten sich die Soldaten, eine ernste Miene zu behalten, als der erste aus den Reihen trat und den Kleinen samt seinem Laufställchen auf die Seite hob und in der Wiese absetzte. Mit hochrotem Gesicht lief Lilo hinaus, um rasch ihren Sohn zu holen.
Regelmäßig in der Nacht - manchmal sogar mehrmals - schreckte ein Fliegeralarm die Schlafenden aus ihrer Nachtruhe. Lilo holte den voller Angst schreienden Udo aus seinem Bettchen und eilte mit ihm in den Luftschutzkeller. Dass sie hier als einzige Frau mit ihrem Kind im Arm unter einer Kompanie Soldaten saß, war für die Männer ein tröstlicher Anblick. Wenn Udo an Mamis Brust trinken durfte, beruhigte er sich wieder und schlief bald weiter. An Heiligabend packte Lilo kleine Päckchen mit ein paar selbstgebackenen Plätzchen und Nüssen. Den Soldaten, die doch alle nur sehnsuchtsvoll an ihre Familien dachten, die jetzt ohne sie zu Hause unter dem Christbaum saßen, erschien die Frau ihres Hauptmannes wie ein Engel, als sie ihnen mit einem Händedruck und einem aufmunternden Lächeln die kleinen Geschenke überreichte.
Als im Frühjahr 1945 die Nachricht kam, dass die Rote Armee näher rücke, musste Lilo mit dem kleinen Udo aus dem Osten fliehen. Willi wollte sie in Sicherheit bringen und fand eine Gelegenheit, mit anderen Flüchtlingen auf der Transportfläche eines Lastwagens Richtung Westen zu fahren. In der ersten Nacht kamen die Flüchtenden alle in einem Lager unter. Lilo war erleichtert, dass sie Udo immer noch stillen konnte und hoffte inständig, ihre Milch würde nicht versiegen. Sie hatte sich mit ausreichend Proviant für die Reise versorgt, den sie unter der Matratze des Kinderwagens deponiert hatte. Am nächsten Tag ging‘s mit der Eisenbahn weiter. Die Gruppe war gerade eine Stunde unterwegs, als sie die tief heranfliegenden Flugzeuge hörten. Die Bremsen quietschten und die Wucht schüttelte die Fahrgäste, dass sie übereinander purzelten. Hastig mussten sie aussteigen, das Gepäck zurücklassen, ins Gelände eilen und sich unter Büschen und in den Straßengräben verstecken. Udo lag beschützt eng an die Brust seiner Mami gedrückt unter ihrem Mantel. Sie hielt ihm die Ohren zu, er sollte den Einschlag nicht hören. Dass ihr Herz vor Angst raste, konnte sie ihm nicht verbergen. Im letzten Augenblick hatte ein Mitreisender den Kinderwagen herausgezerrt. Der Zug wurde getroffen und nun mussten alle zu Fuß weiterziehen. Ein kalter Märzwind schlug ihnen ins Gesicht. Im Kinderwagen lag der kleine Udo warm gebettet im weichen Nerzcape seiner Mami. Es war ein Weihnachtsgeschenk von Willi aus seiner Zeit während des Kriegseinsatzes in Frankreich.
Lilo dachte an ihren Sohn zu Hause. Wie gut, dass wenigstens mein kleiner Wolfgang in Sicherheit ist. Er wird hoffentlich nicht aufgeschreckt werden durch die Sirenen in der Nacht … Mit solchen Gedanken versuchte Lilo, sich Trost zuzusprechen und sammelte alle Kräfte für die weitere Flucht. Nach fünf kräftezehrenden Tagen und Nächten kam sie endlich im Spessart an. Ein Lastwagen hatte sie völlig erschöpft mit dem Rest der Gruppe regelrecht von der Straße aufgelesen. Die Gewissheit, dem Zuhause so nah zu sein, gab ihr jetzt neue Kraft. Das Wetter hatte sich gebessert. Lilo atmete Heimatluft, spürte die ersten Sonnenstrahlen in ihrem Gesicht und schob - in der Vorfreude auf das Wiedersehen zu Hause - beschwingt den Kinderwagen. Sie hatte es geschafft! Erleichtert lächelte sie ihrem Sohn zu, der laut jauchzte, das Gesicht seiner Mutter so fröhlich zu sehen. Noch nie hatte Lilo einen Fußweg in einer solchen Stimmung erlebt: Tränen liefen über ihre Wangen; Dankbarkeit, Glücksgefühle und Freude ließen sie laut jubeln. Die Überraschung war groß, als sie nach etwa vier Stunden an die Haustüre klopfte. Sie fiel der Mutter in die Arme, die sie mit feuchten Augen auffing. Erst jetzt spürte Lilo, wie ihre Knie weich wurden. Sie konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Annemarie kam mit der kleinen Inge im Arm herbeigeeilt und Opapa, von Freude und Dankbarkeit so überwältigt, dass er sich unbeholfen ein paar Tränen aus den Augenwinkeln wischen musste, hielt sich einen Moment am Türrahmen fest. Endlich konnte Lilo auch ihren so sehr vermissten kleinen Wolfgang, der sie mit großen Augen anschaute, wieder in die Arme schließen. Und endlich ließ sie auch ihren Tränen freien Lauf.
Als 1945, noch kurz vor Ende des Krieges, Bomben auf Aschaffenburg, Darmstadt und Würzburg fielen, waren die Erschütterungen so gewaltig, dass in den Sommerauer Häusern die Möbel und Lampen an der Decke wackelten. Das Donnern der Bomber, die am Abend des 15. März über das Dorf flogen, verbreitete großen Schrecken. Der Angriff auf Würzburg zerstörte die Gebäude zu 90 Prozent. Die brennende Stadt färbte weithin den Nachthimmel rot. Etwa fünftausend Menschen kamen um und Tausende wurden obdachlos.
Wenn die Sirenen aufheulten, flüchteten in Sommerau alle in die Keller. Der ohrenbetäubende Lärm des Alarms sollte unvergesslich bleiben, löste noch viele Jahre bei späteren Feuerwehr-Übungsalarmen Beklemmungen aus und ließ die alten Ängste wieder lebendig werden.
Das Dorf blieb verschont, bis im April 1945 die Nachricht im Eilfeuer durchs Dorf ging, dass die Amerikaner bereits vom Main herauf unterwegs waren. Zwar wurden sie als Retter vor den bösen Russen und als Bollwerk gegen den drohenden Kommunismus erwartet, doch die Angst, dass nun der Krieg sich vor ihrer Haustüre befinden könnte, löste eine Panik aus. Da sich einige SS-Soldaten in einem Waldgebiet zwischen Eschau und Wildenstein verschanzt hatten und von dort auf die Angreifer schossen, lenkten sie den Gegenangriff auf sich. Beinahe gleichzeitig waren die Schüsse der Amerikaner von der anderen Seite, von Eichelsbach her, zu hören. Einige Häuser im Dorf wurden getroffen, ein Schuss traf den Malepartus. Der Schafhof vor dem Ortseingang brannte ab. Vor vielen Häusern flatterten - als Zeichen der Kapitulation - weiße Fahnen, eilig aus Betttüchern gefertigt. Viele Einwohner brachen in Todesangst zu Fuß auf in das etwa acht Kilometer entfernte Wildensee, wo sie sich sicher fühlten. Ganze Karawanen - auch Udo im Kinderwagen mit Mutter und Bruder Wolfgang - waren bergauf unterwegs, andere mit Leiterwagen und Fahrrädern in Begleitung ihrer Hunde. Sie mussten vorbei am Waldstück Wolf, wo sich die SS versteckt hielt und riskierten, von den Amerikanern beschossen zu werden. Das furchterregende Donnern der einfahrenden Panzer trieb die verbliebenen Einwohner in ihre Verstecke in den Kellern.
Zwei Soldaten hämmerten mit ihren Gewehrkolben an die Haustüre. Beherzt öffnete Opapa ihnen. Er wurde auf die Straße kommandiert und in gebrochenem Deutsch und barschem Ton fuhr ein Sergeant ihn schroff an. Opapa hörte immer wieder das Wort „Nazi“ bis er verstand, dass ein Sommerauer den durch die Straße fahrenden Jeeps zugerufen hatte: „Hier wohnt ein Nazi!“ Richard sprach sehr gut englisch und als der Amerikaner erfuhr, dass er einen alten erfahrenen Arzt vor sich hatte, nutzte er die Gelegenheit, seinen medizinischen Rat einzuholen. Zuletzt stellte sich noch heraus, dass der GI, ebenso wie Mary, in St. Louis geboren war. Die Situation entspannte sich und zur Erleichterung aller verlief dieser Tag glimpflich.
Nach außen hin war die Familie zwar bemüht, das Bild der Helden in der Familie, Edgar und Franzkarl, die für Vaterland und Führer im Kampf fielen und Willi, dem zu hundert Prozent Kriegsversehrten, aufrechtzuhalten. Sie alle waren überzeugt gewesen - wie viele andere - ihre patriotische Pflicht für die Ehre des Vaterlandes zu erfüllen. Ihre jugendliche Begeisterungsfähigkeit sah Richard nun schamlos ausgenutzt und geopfert. Doch wenn er in der Dämmerung alleine im Garten saß - es waren auch nach fünfundzwanzig Jahren noch die Stunden im vertrauten Gespräch mit seiner verstorbenen Frau am Ende jedes Tages - wurden der Schmerz und die Trauer so groß, dass er begann zu ahnen, welchem Wahn auch er - wie viele andere - verfallen war. Hitlers Parolen, mit denen er die Massen verführte: „Ihr seid das wahre Herrenvolk! Ich verspreche euch goldene Zeiten!“, klangen jetzt nur noch wie Hohn in seinen Ohren. Wie alle Gewaltherrscher hatte auch Hitler nur so lange vom Frieden für das Vaterland gesprochen bis er seine Armeen aufgerüstet wusste. Und die Dimension der schier unfassbaren Schreckensbilder der Schlachten, der Leiden der Soldaten, der Opfer unter der Zivilbevölkerung, der traumatisierten Rückkehrer und der Familien, denen der Krieg die Söhne, Väter und Ehemänner geraubt hatte, schien unfassbar. Dass zudem mehr und mehr die Gräueltaten der Nazis an der jüdischen Bevölkerung ans Licht kamen, hatte ihn tief getroffen. Zum ersten Mal hörte er Wörter wie Gaskammern, Sonderkommandos, Krematorien. Wenn er in die fröhlichen Gesichter seiner Urenkelkinder schaute, blickte er in Millionen unschuldiger Kinderaugen. Der Mord an diesen Kindern, auch den vielen ungeborenen ließ ihn nicht mehr los. Die Bilder kreisten unablässig in seinem Kopf bis er glaubte, den Verstand zu verlieren.