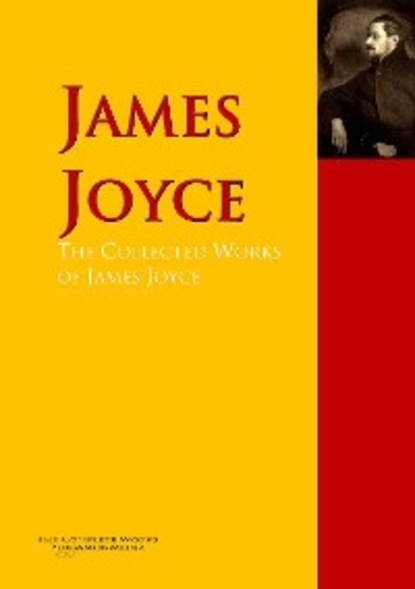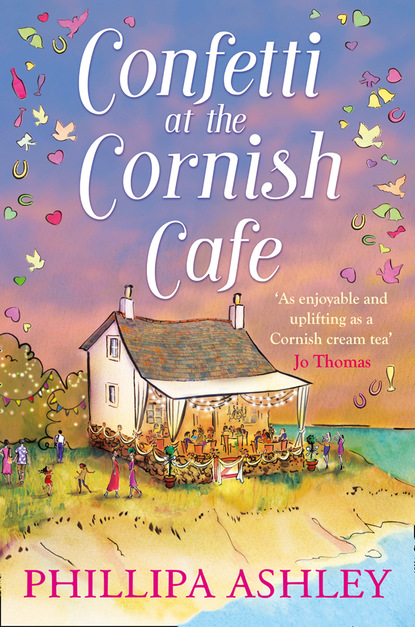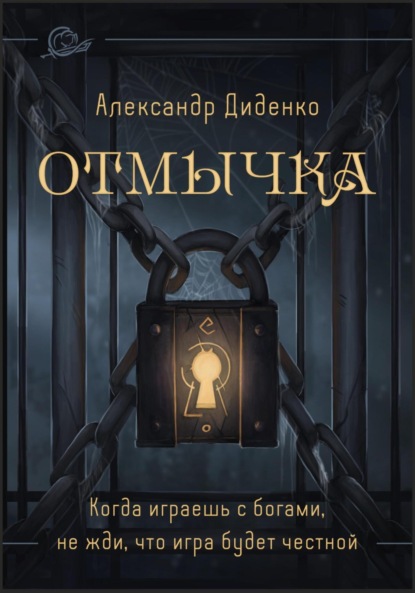Glaube, Irrglaube und die Macht der Liebe
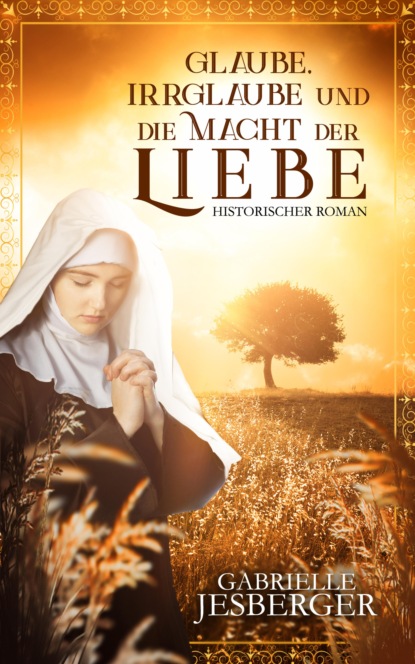
- -
- 100%
- +

Gabrielle Jesberger-Günther
Glaube, Irrglaube und die Macht der Liebe
Ein historischer Roman in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Teil 6
Teil 7
Epilog
Impressum neobooks
Glaube, Irrglaube und die Macht der Liebe
Ein historischer Roman
in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges
Gabrielle Jesberger
In den Schicksalen von Lucinde, Magnus und Melisande verdichten sich Lebenswege von Menschen, deren Namen größtenteils in Vergessenheit geraten sind. Sie erinnern
an tatsächliche Begebenheiten und historische Tatsachen. Das Leben der Ordensleute in den Klöstern ist den Herausforderungen der damaligen Zeit nachempfunden.
Für unsere Kinder, Enkel und alle Nachkommen.
Die Auseinandersetzung mit dem Schicksal dieser Menschen - in der Zeit unserer Vorfahren vor etwa zehn Generationen - kann den Blick schärfen für das Leid Unschuldiger heutzutage in aller Welt und Anstöße geben für ein Engagement gegen Gewalt in unserer Zeit.
Folter ist bis heute in vielen Ländern ein menschenverachtendes Instrument der Unterdrückung.
Heute wird zunehmend durch Gedenkstätten das Schicksal unzähliger auf dem Scheiterhaufen hingerichteter Frauen, Männer und Kinder aus dem Dunkel der Vergangenheit herausgeholt und dem Vergessen entrissen.
Durch die öffentliche Aufmerksamkeit
werden sie rehabilitiert und
es wird ihnen ihre geraubte Würde zurückgegeben.
Wir müssen erkennen, wie wichtig eine Erinnerungskultur für unsere Gesellschaft, für unsere Identität ist.
Unsere Erinnerungen sind nicht nur eine Zeitreise
in die Vergangenheit, sondern immer auch in die Zukunft.
Sie bestimmen, wie kreativ wir
unsere Zukunft planen und gestalten.
Und sie ermutigen uns, die alte Ordnung,
den Lauf der Welt auf den Kopf zu stellen,
eine andere Perspektive einzunehmen,
um neu zu sehen.
„Das Bewusstsein für die eigene Geschichte vermittelt Werte, es beleuchtet unsere Wurzeln und ist damit auch für Gegenwart und Zukunft bedeutsam.“
Michael Günther,
Markt Eschau, Erster Bürgermeister
Eine kluge Autorin, die bereits zwei erfolgreiche Werke veröffentlich hat, wählt hier den historischen Rahmen des 30jährigen Krieges. Den sie geschickt mit einer tragisch-glücklichen Liebesgeschichte von Lucinde und Magnus verwebt:
Das entblättert sich beim Lesen als historisches Ereignis, landet bei den Einzelpersonen und deren Vergangenheit. Und ist dann wieder ganz plastisch ein Jetzt: wie die Schreibende es erwähnt, „ein Er-innern, das er-lösen mag“.
Beeindruckend der Fundus an deutscher Geschichte und damit die Schilderung der damaligen Zustände. Beginnend bei den Abhängigkeiten der Klöster von den Kirchen, über jene vom Wohlwollen derer Vertreter. Faszination, die sich verbietet und endet in akribischem Suchen nach Schwächen. Solche führen in die Falle und enden in den Gräueln dieser Zeit – den Hexenprozessen. Wetter- und andere Phänomene, für die sich keine Erklärung findet, sie beruhen auf dem „bösen Blick“: So wird man die Leute los, die einem zwar in der Nacht helfen mögen, die jedoch am hellen Tage verunglimpft, damit lüstern und schadenfroh dem Feuer preisgegeben werden.
Lucinde liest aus den Stimmen der Menschen. Die Frage stellt sich, ob das nicht jeder könnte, würde er das wollen und daran glauben. Heißt doch „personare“ durchschallen/ hören lassen; da klingt sehr wohl die Person durch, mit der ich es zu tun habe?
Oh nein, das ist vererbte Zauberei, womöglich von der Mutter oder Großmutter. Auf jeden Fall weiblich und somit zu verdammen. Und, wie dann ein Arzt es ausdrückt, „…so werden die Körper der Frauen zu Schlachtfeldern“. Es graut einen heutzutage, in der Tageszeitung zu lesen, dass es künftig noch mehr Frauenhäuser geben soll.
Während die Klosterfrauen Phytotherapie betreiben, wird in Bamberg jeder zehnte Mensch verbrannt. Und Melisande erwartet ein Wechselbalg. Wie Lucindes Mutter lebte und starb, wer ihr Vater war – wir erfahren es in solch anschaulicher Weise, dass beim Lesen des Buches eindrückliche Bilder auftauchen, die wir wohl alle in uns tragen.
„Erst am Ende eines Lebens ist es uns Menschen möglich zu verstehen, wie die Fäden des Schicksals gewebt sind.“
So spät muss das nicht sein, lassen wir uns ein auf einen Roman wie diesen: verfasst von einer lebensklugen Frau, einer Äbtissin gleich - freilich im heutigen Kontext: Die uns in aller Deutlichkeit aufzeigt, dass wir auf den Schultern unserer Vorfahrinnen stehen. Und im Alltag hoffentlich „die Füße im Feuer“ haben …
Nürnberg, im April 2019
Brigitte Rose Meyer
Shamanic Couselor C.S.C.
Naturheilpraktikerin, Präventologin
Prolog
Anno Domini 1618 ist ein großer Komet erschienen in Gestalt einer großen und schrecklichen Rute, welche uns von und durch Gott heftig trifft, wegen unserem sündlichen Leben. Wir verdienen sie vielfältig und täglich, notierte der 21jährige Schuhmacher, Hans Heberle, bei Kriegsbeginn in seinem Tagebuch. Der Komet, der so hell war, dass man seinen Schweif sogar am Tag sehen konnte, galt als Künder drohenden Unheils. Wenn die Menschen nicht umkehren, wird Gott sie strafen. Er galt als Ankünden der nahen Endzeit. Wenn die himmlische Ordnung außer Kontrolle gerät, kann das nur bedeuten, dass das Unglück überall wartet und es kein Entrinnen mehr gäbe vor der Katastrophe. Pfarrer Schaller aus Stendal in der Altmark protokollierte 11 schwere Erdbeben seit 1510 und folgerte: […], darum muss ruina mundi vor der Tür sein. Ruina mundi, der Einsturz der Welt, das Ende. Das könnte ein Krieg nie gekannten Ausmaßes sein.
Aus heutiger Sicht sind solche Vorstellungen schwer nachvollziehbar. Doch existierten sie in den Köpfen der meisten Menschen. Jedes Ereignis, sei es Blitz oder Donner, zu viel oder zu wenig Regen, zu heiß oder zu kalt, wurde als Symptom der Weltlage insgesamt gedeutet und außerdem eingeordnet in ein persönliches Sündenregister. All dies formte die Charaktere - bis hin zu religiösen Verwerfungen -, die wohl auch jene beispiellose Welle der Hexenverfolgung in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges auslösten.
Die Hoffnung auf Frieden war irgendwann nur noch ein kleines Flämmchen, das zu ersticken drohte. Andererseits weckten die langen Jahre des nicht enden wollenden Schreckens, der Not und der Gefahren - in denen der Tod an allen Ecken lauerte - in den Menschen einen übermächtigen Drang, das Leben mit einer Leidenschaft bis an die Grenzen auszuloten, die kaum zu stillen war. Als gäbe es nur diese eine Möglichkeit, wenigstens für kurze Zeit aus dem Grauen zu fliehen. Denn tief im Inneren schlummerte die Sehnsucht nach Liebe, nach dem Gefühl der Verbundenheit und des gegenseitigen Vertrauens. Auch in dieser Zeit fanden Herzen zueinander, wurde geheiratet, wurden Kinder geboren. Für die Überlebenden ging das Leben trotz allem weiter. Die Menschen rückten näher zusammen. Und die Liebe, die immer noch größer war als jede Not, gab ihnen die Kraft, durchzuhalten, um aus all den Möglichkeiten, die sich noch fanden, etwas schöpfen zu können, das den letzten Funken der Hoffnung wieder aufs Neue zum Glühen brachte.
Nicht nur die Soldaten im Heer, auch die Menschen zuhause fragten in dieser Zeit, in der der Krieg seine eigenen Gesetze schuf, immer weniger nach bestehenden Regeln, weder nach weltlichen noch nach kirchlichen. Es ging einfach nur darum, den Tag irgendwie zu überstehen. Notgedrungen besannen die Menschen sich auf das Wesentliche. Wen interessierte der Unterschied zwischen den Konfessionen, wenn es ums nackte Überleben ging?
Dies rettete auch das Leben des vermeintlichen Hexenkindes Lucinde, obwohl ihr Tod schon mit der Geburt - durch das gewaltsame Ende der Mutter auf dem Scheiterhaufen - vorbestimmt schien. Und gerade durch die verworrenen Kriegsereignisse konnte es sich fügen, dass das Leben des schwerverletzten schwedischen Trompeters Magnus, obwohl er protestantisch war, in einem katholischen Frauenkloster gerettet wurde. Nur durch einen Regelverstoß, der in Friedenszeiten unvorstellbar war, fanden zwei Menschen zueinander, denen es durch den Krieg überhaupt erst möglich wurde, eine Liebe jenseits aller Konventionen zu leben.
Der dreißigjährige Krieg 1618 bis 1648 stürzte Europa in einen Krieg, der unvorstellbare Verwüstungen und Traumata hinterließ und irgendwann nicht mehr zu kontrollieren war von den Akteuren, die ihn eingeleitet hatten, in einen Krieg, der wie ein Flächenbrand den ganzen Kontinent ergriff. Die Ursachen reichen weit zurück.
Zu Beginn kämpften Katholiken und Protestanten um den wahren Glauben und am Ende Nationen um die Macht: Auf der einen Seite die katholische Liga und auf der anderen die protestantische Union innerhalb des alten Kaiserreiches, dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation.
Gemeinsam mit ihren jeweils Verbündeten im zersplitterten deutschen Reich trugen die katholisch-habsburgischen Mächte Österreich und Spanien ihre Interessenkonflikte mit dem ebenfalls katholischen Frankreich - aber als Gegner - und den protestantischen Ländern Niederlande, Dänemark und Schweden aus. Frankreich, das sich eingekreist fühlte von den Habsburgern und den Spaniern, versuchte seinerseits, sich die Union im Kampf gegen das katholische Spanien zum Verbündeten zu machen.
Das Geschick der katholischen Kirche war verhängnisvoll verknüpft mit dem des Hauses Österreich. 1618 war die Dynastie der Habsburger die stärkste Macht in Europa. Sie regierten auch in der neuen Welt in Mexiko und rühmten sich, weit mehr durch Heiratspolitik, als durch Eroberungen mächtig geworden zu sein.
Längst hatte sich ein vielfältiges Spannungsnetz aus politischen, dynastischen, konfessionellen und innenpolitischen Gegensätzen aufgebaut. Diese historische Gärung trieb auf eine Eskalation zu und entlud sich als Konflikt auf europäischer Ebene: der habsburgisch-französische Gegensatz und auf der Reichsebene derjenige zwischen Kaiser und katholischer Liga einerseits und protestantischer Union andererseits. Frankreich und Spanien versuchten, die einheimischen Fürsten für sich zu gewinnen, so dass viele Herrscher gleichzeitig unter spanischem und französischem Einfluss standen. Es entstand eine schwer überschaubare Konfliktbündelung.
Insgesamt folgten in den dreißig Jahren von 1618 bis 1648 vier Hauptkonflikte aufeinander, die von der Geschichtswissenschaft als Böhmisch-Pfälzischer, Dänisch-Niedersächsischer, Schwedischer und Schwedisch-Französischer Krieg bezeichnet werden.
Der Westfälische Friede 1648 legte die Machtbalance zwischen Kaiser und Reichsständen (eine Gesellschaftsordnung aus dem Mittelalter) neu fest und wurde Teil der bis 1806 geltenden Verfassungsordnung des Reiches. Die Parteien verpflichteten sich, die Einzelheiten in einem separaten Kongress zu verhandeln. Erst die Ergebnisse dieser Verhandlungen erhielten die letztlich verbindlichen Abmachungen zu allen Abrüstungs- und Entschädigungsfragen. Die Parteien sicherten einander Amnestie und immerwährendes Vergessen zu. Der eigentliche Friedensvertrag von 1650 bestimmte für über hundert Jahre die politische Neuordnung Mitteleuropas.
Da es durch diesen Vertrag im Heiligen Römischen Reich weder Besiegte noch Sieger gab, konnte eine Verhandlungslösung erreicht werden. Auf der anderen Seite wurde die deutsche Nation vor dem Irrweg bewahrt, die nationale Identität an eine Konfession zu binden, so wie es in fast allen anderen europäischen Ländern der Fall war. Damit hatte Deutschland vielen Nachbarn etwas voraus: ein politisch-konfessionelles System, das auf Ausgleich ausgerichtet war. Außerdem hatte das Reich eine fest fixierte Verfassung, die dem Einzelnen als Mitglied seiner Konfession Freiheitsrechte garantierte.
Die Kriegshandlungen und die durch sie verursachten Seuchen und Hungersnöte verwüsteten und entvölkerten ganze Landstriche. In Teilen Süddeutschlands überlebte nur etwa ein Drittel der Bevölkerung. Nach den wirtschaftlichen und sozialen Katastrophen benötigten einige vom Krieg betroffenen Territorien mehr als ein Jahrhundert, um sich von den Folgen zu erholen. Da der Krieg sich hauptsächlich auf deutschsprachigen Gebieten abspielte, die bis heute noch Teil Deutschlands sind, führten die Erfahrungen der Kriegszeit, nach Meinung von Experten, zur Verankerung eines Kriegstraumas im kollektiven deutschen Gedächtnis.
Auch in der Kunst - in vielen Gemälden, Liedern und Gedichten - hat der Dreißigjährige Krieg bis heute seine Spuren hinterlassen. Das Kinderlied Maikäfer flieg, der Vater ist im Krieg, die Mutter ist im Pommerland, Pommerland ist abgebrannt …., mit dem ihm zugeordneten Reim: Bet, Kinder bet, Morgen kommt der Schwed, Morgen kommt der Ochsenstern, der wird die Kinder beten lern. Bet, Kinder bet, steht als Symbol für die kollektive Niederlage der Deutschen und blieb im kulturellen Gedächtnis haften. Der als Volksheld und Retter in der Not gefeierte Martin Rinckart verfasste: Nun danket alle Gott. Im 18. Jahrhundert beschäftigte sich Friedrich Schiller als Historiker und Dramatiker mit dem Krieg und veröffentliche Die Geschichte des Dreißigjährigen Krieges sowie sein Drama Wallenstein.
Bücher über Astrologie hatten in dieser Zeit den Rang von Weltliteratur in der doppelten Bedeutung des Wortes: Vielleicht in ihr allein haben sich Ost und West, Christen, Mohammedaner und Buddhisten mühelos verstanden. Die Astrologie durchdrang bis ins 17. Jahrhundert hinein u. a. das philosophische Denken und viele Naturwissenschaften wie Medizin und Botanik. Grimmelshausens Vermengung der Begriffe Astrologie und Astronomie ist Ausdruck beider Disziplinen seit dem sternenkundlichen Studium der Babylonier. Die kosmisch-mathematischen Grundlagen ließen die Treffsicherheit von Vorhersagen astronomischer Prozesse und Konstellationen gleichsam von selbst auf die Astrologie übertragen. So fand sich die biblisch geheiligte Zahl sieben der klassischen „Wandelsterne“ Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond als Zahl der Tage eines Mondumlaufviertels, d. h. einer Woche, sowie der Hauptsterne des Orion, der Plejaden und der beiden Bären-Gestirne wieder. Keplers bahnbrechenden Gesetze sind nicht zuletzt der Suche nach solchen Zahlenkorrespondenzen als Zeichen eines harmonischen Weltgefüges zu verdanken. Astrologischen Vorstellungen liegen in der Regel Mythen zugrunde und umgekehrt waren die astrologische Ideenwelt und das Christentum durchaus vereinbar.
Im Gegensatz zum wissenschaftlichen Anspruch und religiösen Gehalt der Astrologie stand die enge Beziehung der Sternenkunde zur Magie. Hexen und Geisterwesen ließen sich im Zeichen des Okkultismus leicht in sie einbeziehen. Zauberhandlungen wurden durch die Wahl der geeigneten Planetenstunde abgesichert. Vor allem die Stunde des als zaubersüchtig geltenden Saturn, der zudem mit dem Teufel korrespondieren konnte, kam dafür in Frage. Zudem fungierten die Sterne als Medium des göttlichen Willens. Die große Konjunktion von 1514 war für Luther ein Warnzeichen Gottes. Melanchton begeisterte sich öffentlich für die Astrologie.
Unter Papst Leo X. wurde eine Professur für Astrologie an der päpstlichen Universität in Rom eingerichtet. Andere akademische Hochburgen waren Bologna, Padua und Paris. Die großen Astronomen Kopernikus, Galilei und Kepler praktizierten die Sterndeutung. Kepler, der von Kaiser Rudolf II. gefördert wurde, erstellte u. a. für Wallenstein die Horoskope. Richelieu konsultierte, wie andere hochstehende Politiker des Hofes einen der damals bedeutendsten Sterndeutern, der bei der Geburt von Ludwig XIV. dessen Horoskop erstellte.
Der astrologisch aufgebaute, berühmteste deutsche Roman des 17. Jahrhunderts Simplicissimus (das Leben eines Jungen aus dem Spessart, der den Dreißigjährigen Krieg überlebt) ist ein letztes Monument der uneingeschränkten Macht der Astrologie. Grimmelshausen strebte mit seinem Werk noch mehr an durch seine eigenen schmerzlichen Erfahrungen und sein sozialkritisches Engagement. Göttlich anerkannt war für ihn zweifellos die Astrologie als unverbrüchliche Legitimation universaler Ordnung. Kometen, im Volksglauben schon immer als göttliches Omen gewertet, gliederten sich zwanglos in das astrologische System ein und sollten Naturkatastrophen, Geburt oder Todesfälle von Herrschern anzeigen. Astrologische Stundentabellen durften weder in Bauernpraktiken noch an den großen astronomischen Uhren wichtiger Städte, wie am Dom zu Münster in Westfalen, fehlen. In seinem 1671 erschienen Ewig-währenden Calender lieferte Grimmelshausen einen Überblick über das gesamte astrologische System.
Mit wachsendem zeitlichem Abstand sahen Schriftsteller in dem großen Konflikt des 17. Jahrhunderts zunehmend eine Metapher für die Schrecken des Krieges überhaupt.
Wer sich nach Licht sehnt,
ist nicht lichtlos,
denn die Sehnsucht
ist schon Licht.
Bettina von Arnim
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.