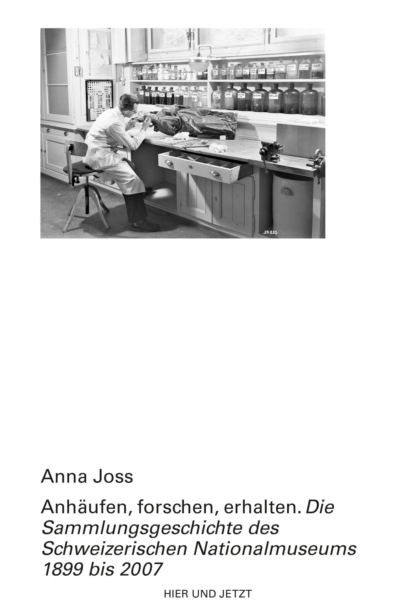- -
- 100%
- +

Abb. 9: Winterthurer Keramik, Eckraum Nr. 48, Schweizerisches Landesmuseum Zürich, ohne Jahr, SNM, Dig. 28842.

Abb. 10: Ruhmeshalle, Raum 50, Schweizerisches Landesmuseum Zürich, Fotograf: E.Link, Aufnahme vor 1918, SNM Dig. 28851.

Abb. 11: Ratsaal aus Mellingen, Schweizerisches Landesmuseum Zürich, Postkarte, um 1898, Nr. 2848, in Besitz von Anna Joss, Scan.

Abb. 12: Rathaussaal von Mellingen (1467), Schweizerisches Landesmuseum Zürich, Raum 14, in: Führer durch das Schweizerische Landesmuseum in Zürich, hg. v.d. Direktion, Zürich 1929, SNM Scan.
«Es herrscht ein empfindlicher Platzmangel, so dass Kellerräume und Estrich zur Aufbewahrung von Altertümern benutzt werden müssen.»50
Deshalb seien baldmöglichst Massnahmen zu ergreifen bei der «Unterbringung & Beschaffung der Inventargegenstände».51 Der empfundene Raummangel mündete in eine Grundsatzdebatte über die Sammlungspraxis und die Ziele des Landesmuseums während der 1910er- und 1920er-Jahre und war der Auslöser für bleibende Veränderungen in der Sammlungstätigkeit des Museums.
Die Diskussionen und Handlungen rund um die Sammlungsmenge sind Gegenstand dieses Kapitels. Der Titel «anhäufen» bezieht sich auf drei Merkmale, die für die damalige Sammlungspraxis charakteristisch sind: Erstens drehten sich die damaligen Museumspraktiken weniger um Einzelstücke, die Eigenheiten einzelner und einzigartiger Objekte. Vielmehr ging es um den Umgang mit einem Haufen von Dingen und die Handhabung einer Menge Dinge: Die Sammlungstätigkeit wurde von der Quantität der Dinge dominiert und der Wirkung der Sammlungsstücke in ihrem «Vielsein».52 Der zweite Aspekt, welcher der Begriff «anhäufen» betont, ist das Zusammentragen der Dinge an einem Ort, die Zentriertheit der Handlungen. Die vom Bund erworbenen Objekte wurden vereinigt und zu einer Sammlung formiert, in einem eigens dafür gebauten Museumsgebäude in der Stadt Zürich. Gegen diese zentralisierte staatliche Sammlung traten die Anhänger des Föderalismus immer wieder an. Weiter war es die vorhandene Objektmenge, die in den 1910er- und 1920er-Jahren unter den Verantwortlichen zu einer ersten genealogischen Reflexion über das Sammeln führte und sie danach fragen liess, wie es denn zu dieser Quantität kommen konnte. Das prozessuale Moment des Sammelns, das Grösserwerden und Wachsen der Sammlung durch das Zusammentragen von Dingen, ist denn auch der dritte Aspekt, der interessiert.53
Die Quantität der Dinge ist beim Sammeln ein essenzieller Faktor. Das zeigt sich bereits in der Tatsache, dass ein Ding noch keine Sammlung ausmacht. Erst ab zwei, besser ab drei oder mehr Dingen kann man von einer Sammlung sprechen.54 Die Quantität der Sammlungsstücke war in der Sammlungspraxis am Schweizerischen Landesmuseum ein wesentliches Qualitätsmerkmal. Wie wichtig die Darstellung der Menge für die Museumsleitung war, lässt sich bereits an den Listen in den Jahresberichten erkennen, die oft mehr als die Hälfte des gesamten Umfangs der Publikation bildeten.55 Erstaunlicherweise waren bisher in der Forschung zu öffentlich-staatlichen Sammlungen quantitative Aspekte kein eigener Untersuchungsgegenstand.56 Marginal thematisiert sind sie in Untersuchungen, die sich mit dem Strukturieren, Ordnen und Klassifizieren des Sammelns befassen, wo die Quantität als Problem erscheint.57 Anders ist es bei den Untersuchungen zur Sammeltätigkeit von Einzelpersonen: Hier ist der quantitative Aspekt beim Sammeln Thema. Das Streben nach einer grossen Sammlung wird mit besonderen emotionalen Dispositionen, nicht selten mit Persönlichkeitsstörungen in Verbindung gebracht.58 Auffälligerweise wurde dieser negativ behaftete Aspekt des individuellen Sammelns nicht auf das gemeinschaftliche Sammeln übertragen, wie es bei sonstigen Untersuchungen der Fall ist.59 Die Rolle der Quantität in der gemeinschaftlichen Sammlungspraxis muss daher erst herausgearbeitet werden.
Wie das erste Teilkapitel («Debatte über die Mengenbildung») zeigen wird, wurden die Grundsatzdebatten über die Sammlungspraxis und die Ziele des Landesmuseums während der 1910er- und 1920er-Jahre von der Vorstellung geprägt, dass die gesamte Sammlung dem Museumspublikum in den Ausstellungsräumen gezeigt werden müsse. Ich werde darlegen, wie man mit der wachsenden Menge von Objekten verfuhr und welche Personenkreise dabei die Deutungshoheit über die Objektmenge innehatten.
Nachdem der Museumsbau errichtet war, wurde die hauptsächliche Energie in die Betreuung und Verwaltung der Sammlung abseits der Ausstellungsräume gesteckt. Diese Tätigkeiten scheinen zunächst von den Debatten über den Platzmangel nicht berührt zu werden. Doch wie ich im Kapitel «Handhabung der Fülle» darlegen werde, eröffneten sich gerade fern der Ausstellungsräume neue Handlungsspielräume innerhalb des Museums. Als Wendepunkt in der Mengenfrage erscheint das Jahr 1928. Damals, fast 20 Jahre nach den ersten grösseren Diskussionen, kam es zu gewichtigen Entscheidungen: Die Museumsbehörden beschlossen, gewisse Sammlungen wegzugeben und andere nicht mehr weiter auszubauen.
Abschliessend werde ich im Kapitel «Blick auf spätere Mengenverhältnisse» die Thematik des Anhäufens rekapitulieren. Zur Akzentuierung der Forschungsergebnisse für die 1910er- und 1920er-Jahre skizziere ich zugleich die späteren Mengenverhältnisse während des 20. Jahrhunderts, als die Menge der unausgestellten Objekte im Verlauf des 20. Jahrhunderts weiter anschwoll.
Debatte über die Mengenbildung
Parlamentarier, Museumsbehörden und Angehörige anderer Kulturinstitutionen ärgern sich darüber, dass Sammlungsstücke im Keller und Estrich des Landesmuseums eingelagert werden mussten.60 Sie waren sich einig, dass die Hauptaufgabe dieses Museums darin liege, seine Sammlungsobjekte in den Ausstellungsräumen sichtbar zu präsentieren und nicht unausgestellt in Depoträumen einzulagern. Zahlreich sind die Belege für den hohen Stellenwert, der dem Ausstellen von Objekten beigemessen wurde. «Der erste Zweck ist nicht das Einpacken, sondern das Auspacken der Gegenstände», 61 meinte Nationalrat Karl Emil Wild 1919.62 Die Besichtigungen des Museums (1910, 1915, 1919, 1924 und 1927) bewog die Vertreter der Politik immer wieder dazu, parlamentarische Vorstösse einzureichen und Lösungsvorschläge zu unterbreiten.
Objekterwerbung und -präsentation wurden als zusammengehörig verstanden. Jedes erworbene Stück sollte im Ausstellungsraum zu sehen sein, an einem eigens dafür vorgesehenen Platz. Das Gesammelte wurde als Einheit mit seinem Präsentationsraum gedacht. Diese statische Idee stand in Konflikt mit der dynamischen Objektmenge, die durch die getätigten Erwerbungen und Schenkungen stetig grösser wurde. Die Ursachen für diese Raum-Menge-Problematik sind in bestimmten Auffassungen vom Wesen des Museums begründet, wie sie für das 19. Jahrhundert zentral waren und es darüber hinaus bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts hinein blieben. Aber auch gewisse Machtkonstellationen waren dafür verantwortlich: Zwar lancierten die Parlamentarier die Debatten und bestimmten den Ausgabeetat, aber die Museumsbehörden hatten die Deutungshoheit und die Entscheidungsmacht über die Sammlungseingänge und ihre Zusammensetzung. Ausserhalb ihrer Macht lagen nur die Objekte, die dem Museum zum Geschenk gemacht wurden.
Die enge Verschränkung von Objekterwerbung und -präsentation
1890 beschloss die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft die Gründung und den Bau eines Nationalmuseums. Mit ihrem Entschluss, einen Bau zu errichten, brachte sie ein statisches Moment in die laufenden Sammlungstätigkeiten.63 Bisher hatte der Museumsbau an zweiter Stelle der Förderung auf Bundesebene gestanden: An erster Stelle kam die staatliche Erwerbung von Objekten. Nach zwei erfolglosen Versuchen (1799 und 1880), ein Nationalmuseum zu realisieren, wurde 1884 als erster staatlicher Akt für 60 000 Franken eine Sammlung prähistorischer Objekte erworben. Darauf folgend beschlossen die eidgenössischen Räte 1886, für weitere Ankäufe einen «Altertümerkredit» einzurichten in der Höhe von 50 000 Franken. Ganz im Sinn der föderalistischen Kräfte wurde der Kredit für zwei Aufgaben eingesetzt: zum Aufbau der bundesstaatlichen Sammlung und zur gezielten finanziellen Unterstützung der Kantone bei ihren Sammlungsbestrebungen. Die Frage, inwiefern der Kredit ein Schritt in Richtung Schaffung eines Nationalmuseums sei, wurde in den Räten zwar diskutiert, blieb aber vorläufig unbeantwortet. Daher wurden die erworbenen Objekte provisorisch «auf neutralem Territorium», 64 in den ehemaligen Archivräumen des Bundesratshauses, aufgestellt.65 Der Bund delegierte die Frage der Schaffung eines Nationalmuseums auf elegante Weise an die Kantone und stachelte deren Ehrgeiz an, indem er sie aufforderte, einen passenden kantonalen Bau und einen bedeutenden Sammlungsgrundstock als Ausgangspunkt für ein Nationalmuseum vorzuschlagen. Basel, Bern, Luzern und Zürich bewarben sich als Museumssitz; Zürich erhielt dann den Zuschlag.
1890 war die Errichtung eines Nationalmuseums beschlossen. Von da weg wurde die staatliche Aufgabe der Erwerbung und Bewahrung von Objekten in starker Abhängigkeit vom dafür geschaffenen Museumsbau und seinen Ausstellungsräumen gesehen. Sie wurden zur entscheidenden Bezugsgrösse für die Sammlung.66 Für die Museumsverantwortlichen wurde es zum Programm, durch das Zeigen von Dingen Wissen zu vermitteln. Das Publikum sollte sich durch die Betrachtung der Objekte im Ausstellungsraum bilden können.67 Was zählte, war die Objektpräsentation im Museumsraum.
Das Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte Präsentationskonzept prägte die Sammlungspraxis des Landesmuseums in den folgenden Jahrzehnten entscheidend. Im Wettbewerbsprogramm für den Museumsbau, also in der Planungsgrundlage für die Städte, die sich um den Sitz des Museums bewerben wollten, wurde der enge Bezug von Sammlung und Ausstellungsraum propagiert. Das Museumsgebäude wurde als Behälter verstanden, um die Sammlungsstücke zu zeigen. Ziel war es, die Sammlung und das Museumsgebäude als ein über Jahrhunderte herangewachsenes Ensemble darzustellen. Man wollte die gesammelten Gegenstände «so weit wie möglich in ihre ursprüngliche Umgebung»68 zurückversetzt präsentieren: die Waffen in einer zeughausähnlichen, grossen Halle, die Kleinodien in einer Schatzkammer und so weiter.69 Es wurde festgelegt, welche Sammlungen wie viele Quadratmeter Raum im Museumsgebäude erhalten sollten.70 Und für jeden Gegenstand sollte in einer bestimmten Sammlungsabteilung «die genaue Stelle»71 im Raum bestimmt werden. Ein solches Konzept verlangte nicht nur nach einem genau bemessenen Raum, sondern auch nach einer berechenbaren Objektmenge. Beides fehlte. Die Realisation des Ensembles aus Bau und Sammlungsstücken wurde zum Problem, wie auch seine Handhabe im Sammlungsalltag.
Der Bau des Landesmuseums wurde unter der Leitung des Architekten Gustav Gull errichtet, zusammen mit dem Gebäude für die Kunstgewerbeschule der Stadt Zürich, das auf dem gleichen Gelände zu stehen kam.72 Als mit Bauen begonnen wurde, wusste niemand genau, welche Sammlungsstücke in das Landesmuseum kommen sollten, denn die Sammlung befand sich erst im Aufbau. Wenn auch die bereits vom Bund erworbenen Gegenstände und die Objekte, die der Museumsstandort Zürich beizusteuern hatte, bekannt waren, kamen doch stets neue Stücke hinzu. Das Landesmuseum wurde auf der Basis eines groben Ausstellungskonzepts gebaut, ohne dass detaillierte Entwürfe der Museumsarchitektur vorlagen. Die fehlende Planungsgrundlage in Verbindung mit dem Anspruch einer engen Verschränkung von Gebäude und Sammlung führte während des Bauprozesses zu Kompetenzstreitigkeiten und Reibereien zwischen der Bauleitung und den Museumsbehörden. Aus diesem Grund verzögerte sich das Bauvorhaben.73
Die Schwierigkeit, ein Ensemble von Sammlung und Museumsbau zu realisieren, machte sich besonders deutlich bemerkbar bei den «bauliche[n] Altertümer[n]», 74 die als verbindendes Element zwischen Sammlungsstücken und Museumsarchitektur direkt in das Gebäude eingesetzt wurden.75 Während des Baus wurden Steinportale, Zimmerdecken, Täfer und Türen erworben für den inneren Ausbau des Museumsgebäudes. Sie sollten gemäss Museumsdirektor Heinrich Angst nicht nur als «malerische und lehrreiche Sammlungsobjekte»76 dienen, sondern auch einen «unendlich bessern Rahmen und Hintergrund für die Altertümer selbst» abgeben, als es «moderne architektonische Gebilde»77 seiner Meinung nach konnten.
Das Ergebnis der alternierenden Tätigkeiten von Bauen und Erwerben war, dass zuletzt an vielen Orten die ausgestellten Objekte in Konflikt mit der architektonischen Substanz gerieten. Die Vorstellung, dass jedes Ding seinen festen Platz haben sollte, nun aber die Dinge und Plätze nicht zueinander passten, führte nach der Schilderung im Jahresbericht zu einer merkwürdigen Situation bei der Museumseröffnung von 1898. Das Gebäude war gleichzeitig überfüllt und leer: Einem Teil der bereitgestellten Vitrinen fehlte am Eröffnungstag der Inhalt. Leer, wie sie waren, blieben sie mit Vorhängen verhüllt.78 Zugleich beklagte die Direktion, dass zu wenig Platz vorhanden sei, um die stetig wachsende Objektmenge ausstellen zu können.79
Im Sammlungsalltag der folgenden Jahre lag das grösste Problem darin, wie die neu in die Sammlung eingegangenen Objekte im statischen Gefüge von Sammlung und Raum platziert werden sollten. Hans Lehmann, der 1903 die Nachfolge von Heinrich Angst als Direktor am Museum antrat, schreibt dazu:
«Überall stösst die angreifende Hand auf Schwierigkeiten, die durch die eigentümliche, individuelle Raumgestaltung, oder durch die für den Reichtum der Sammlung sehr drückende Enge des Gebäudes entstehen. Wohl wurde an manchen Stellen versucht, früher ausgestellte Objekte durch seither erworbene, charakteristischere oder bessere zu ersetzen; doch zeigte die Erfahrung, dass das bisherige Gleichgewicht der Anordnung und Verteilung der Objekte leicht zu Schaden kommt. Oft steht die Direktion vor der Wahl, interessante Objekte entweder im Depot zu behalten, oder dann in einer Weise auszustellen, die doch nur als ein Notbehelf und nicht als eine definitive Eingliederung betrachtet werden kann.»80
Das Landesmuseum war mit seinem «Reichtum der Sammlung»81 und der «sehr drückende[n] Enge des Gebäudes»82 nicht alleine. Diese Problematik war in der damaligen nationalen und internationalen Museumslandschaft allgegenwärtig.83 Salopp gesagt lässt sich von einem Systemfehler sprechen. Das geht aus der Dokumentation einer Konferenz in Mannheim hervor, wo sich 1903 die Direktoren von natur-, kunst- und kulturgeschichtlichen Museen aus den deutschsprachigen und skandinavischen Ländern trafen, um darüber zu beraten, «wie die Schätze der Museen weiteren Schichten des Volkes nutzbar gemacht werden können».84 Die Konferenzteilnehmer waren sich einig, dass man bei der Errichtung der Museen zu wenig an ein künftiges Wachstum der Sammlungen gedacht hatte und daher nun die vorhandenen Räumlichkeiten für die Objektmengen zu klein waren.85 Eduard Leisching, der Direktor des k. k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie in Wien, brachte die Problematik folgendermassen auf den Punkt:
«Man dachte nie an das Wachsen der Sammlungen […]. Indem man versäumte, bei der Wahl des Platzes auf wachsendes Raumbedürfnis zu achten, hat man überall Museen, die von unten bis oben überfüllt, jeder inneren Bewegung beraubt sind und Gefahr laufen, zu ersticken.»86
Diese Raum-Menge-Problematik stellte sich zwar auch in Archiven und Bibliotheken, die mit vergleichbaren Bewahrungsabsichten wie die Museen geschaffen worden waren.87 Doch bei den Museen manifestierte sie sich in verschärfter Form. Das lag an den über das 19. Jahrhundert hinaus bestehenden Auffassungen vom Wesen des Museums: erstens in der Vorstellung vom Museum als Bewahrungsstätte einer abgeschlossenen Vergangenheit; zweitens in der Idee, dass das Ansehen des Museums mit der Grösse seiner Objektmenge wachse; und drittens im Anspruch, die Museumsbesucher durch die Präsentation aller Sammlungsobjekte in den Ausstellungsräumen zu bilden.
Ich will diese drei Auffassungen am Beispiel des Landesmuseums genauer darlegen und dabei zeigen, wie sie mit verschiedenen Machtfragen verbunden waren: der Frage nach der Zugänglichkeit der Sammlung für bestimmte Personenkreise, der Frage nach dem kantonalen oder regionalen und eidgenössischen Einflussbereich und der Frage nach den politischen und wissenschaftlichen Wirkungsmächten.
Vorweg ist Folgendes zu bemerken: Die Meinungsallianzen verliefen weder nach dem Schema Parlament gegen Museumsbehörden, noch waren eindeutige parteipolitische Grabenkämpfe auszumachen. Es gab wechselnde Lager von Befürwortern und Gegnern bestimmter Lösungsvorschläge. Als wichtige Scharnierstelle zwischen der politischen Exekutive und der Museumsdirektion wirkte die Landesmuseumskommission: Sie war 1891 als Kontrollinstanz eingesetzt worden, um die Geschäfte des Landesmuseums und seiner Direktion zu überwachen. Die Kommission stand unter der Oberaufsicht des Bundesrats. Der Bundesrat des Departements des Inneren, der für das Landesmuseum zuständig war, nahm an den Sitzungen der Landesmuseumskommission nur manchmal teil.
Über die Beziehungen der Kommissionsmitglieder zu den Parlamentariern ist in den Quellen wenig zu erfahren. Sicherlich bestanden zwischen ihnen teilweise engere Bindungen, denn die Mitglieder (Kunsthistoriker, Architekten, Archivare oder Museumsdirektoren) waren selbst oft politisch aktiv als Grossräte, Regierungsräte oder Ständeräte. Ferner war der Stadtpräsident von Zürich ständiges Mitglied der Kommission.88 Die einzelnen Positionen der Mitglieder innerhalb der Museumskommission zu eruieren, ist aber kaum möglich. Namentliche Nennungen sind in den Sitzungsprotokollen selten. Für die Debatten in den Ratssessionen verfassten die Kommission und der Museumsdirektor jeweils zuhanden des Bundesrats Stellungnahmen, wobei die Stellungnahmen der Kommission meist auf einem vom Museumsdirektor erstellten Papier basierten. Der Bundesrat übernahm die Stellungnahmen oft eins zu eins.
Das Ideal einer vollständigen Sammlung von Dingen der Vergangenheit
Im 19. Jahrhundert etablierte sich ein neues Verständnis der Geschichte. Geschichte sei ein Lehrstück für gegenwärtige Prozesse. Dem Museum wurde dabei die Rolle einer Geschichtsvermittlerin eingeräumt.89 Die Vergangenheit wurde verstanden als ein in sich abgeschlossener Zeitraum, dessen materielle Hinterlassenschaft die Museen zu bewahren hatten. Es ging darum, ein umfassendes Bild einer Vergangenheit zu vermitteln, deren Anfang und Ende fixiert war. 1889 wurde im Programm für ein eidgenössisches Landesmuseum formuliert:
«Der Zweck des Landesmuseums ist, ein möglichst vollständiges Bild von der Kultur- und Kunstentwicklung auf den Gebieten der heutigen Schweiz von vorgeschichtlicher Zeit bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zu geben.»90
Entsprechend dem Vorstellungsbild einer abgeschlossenen Vergangenheit nahm man auch an, dass die Anzahl der Objekte, welche der Vergangenheit zugerechnet wurden, endlich und daher kalkulierbar war. Der Direktor des Landesmuseums, Hans Lehmann, schrieb 1927:
«[A]uf der ganzen Welt wird weiter gesammelt, solange überhaupt noch eine Möglichkeit besteht, die Museen auszubauen, da naturgemäss der Bestand an Altertümern mit jedem Jahre abnimmt.»91
In dieser Logik war ein Museum erfolgreich, wenn es möglichst viel des knappen Gutes noch zusammentragen konnte. Wie es die Behörde des Landesmuseums ausdrückte: Es ging darum, «de[n] letzte[n] Rest unserer Altertümer […] für unser eigenes Land zu retten»92 – also zu retten, was noch zu retten war.93 Aufgrund dieses Vergangenheitsbildes wurde die Quantität als eine Qualität angesehen. Museen wurden als Bewahrungsstätten einer Welt verstanden, die im Verschwinden begriffen war, fern gelegen von den grossen Warenströmen und der verschärften «Expansion der Gegenstandswelt», 94 die mit der industriellen Produktion entstanden war.95 Die Museumsbehörden sahen es als ihre Pflicht, die begonnenen Sammlungen «möglichst zu vervollständigen».96 Entsprechend war man bestrebt, «Lücken» zu füllen. Die Finanzdelegation verlangte 1910 «ein Masshalten im Ankaufe von Gegenständen zweiter und dritter Qualität», 97 um das Raumproblem zu lösen. Die Museumsbehörden antworteten, ihre Ankaufspraxis entspreche den gängigen, von Fachleuten gutgeheissenen Praktiken.98 Es sei legitim, qualitativ weniger hoch eingestufte Dinge zu kaufen, wenn diejenigen «ersten Ranges, welche geeignet wären, die Lücken zu füllen, überhaupt nicht mehr erhältlich sind».99
Dass die vorhandene Sammlung das Mass aller kommenden Dinge ist, sei typisch für kulturhistorische Museen, schreibt Sharon Macdonald in ihrem Aufsatz über die Sammlungspraktiken von Museen.100 Deren Bestrebungen unterschieden sich von denen anderer Museen, die etwa auf den Gebieten der Physiologie, Pathologie und Anatomie sammelten. Wie Anke te Heesen und E.C.Spary schreiben, verabschiedete man sich hier bereits im 19. Jahrhundert von der Idee der Vollständigkeit.101 Beim Landesmuseum hielt sich die Vorstellung aus der Gründerzeit, ein vollständiges Bild von der schweizerischen Kultur zu vermitteln, weit über 1900 hinaus.102 Dies obwohl in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts die Sammeltätigkeit der Anfangszeit zunehmend kritisch gesehen wurde. Nach Hans Lehmann hatten damals «keine klaren Vorstellungen»103 bestanden, was die Sammeltätigkeit und die Entwicklung des Museums anbelangte; Gesetze und Verordnungen seien erst auf die Praxis gefolgt und unpräzise formuliert worden.104 Dementsprechend sei der Inhalt der Sammlung gleich wie bei allen anderen historischen Museen «ein mehr oder weniger durch Zufall zusammengewürfelter».105 Die historischen Sammlungen enthielten nur das, «was Männer, die für die Vergangenheit ihrer engeren Heimat und deren Hinterlassenschaft begeistert waren, aus Liebe zur Sache und ohne öffentliche Unterstützung mit Zuhülfenahme der alten Kunst- und Raritätenkammern zusammenbrachten».106 So lange aber die Museumsbehörden auch im neuen Jahrhundert daran festhielten, dass das Vorhandene vervollständigt werden müsse, waren genau diese «zufällig» begonnene Sammlung und die früher getroffenen Entscheidungen der unumstössliche Bezugsrahmen für die laufende Sammeltätigkeit. Die zeitgenössische Sammlungspraxis wurde von der Präsenz der früher erworbenen Sammlungsstücke geprägt. Doch wie die Diskussionen von Mannheim und die Debatten um das Landesmuseum zeigen, hatte man sich hinsichtlich der «Menge an Vergangenheit» verkalkuliert: Spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts war klar, dass die Menge der zu bewahrenden Objekte im Verhältnis zu den dafür vorgesehenen Ausstellungsräumen immens war und die Räume dementsprechend zu klein. In den Museen hatte man es mit Massen von Dingen zu tun, die Warenströmen nicht unähnlich waren und ihre Räume regelrecht überfluteten.
Bedeutend ist das Viele
Bei aller Kritik, schliesslich wurde die Menge auch als Machtfaktor verstanden: In der modernen Welt mit ihren materiellen und wissensbasierten «Multiplikationsdynamiken», 107 angelegt auf Machtsteigerung, hiess der Besitz einer Menge von Dingen der Besitz von Macht, im Wortsinn des lateinischen multus (viel, gross, stark).108
Zur Kritik an der fehlenden Sichtbarkeit der gesamten Sammlung des Landesmuseums gesellte sich die Sorge über eine Machtballung in der Bundesinstitution, wobei die grosse Objektmenge (die Anzahl an einem Ort versammelter Objekte) als Ausdruck davon gesehen wurde. Mehrfach wurde gefordert, dass die unausgestellten Sammlungstücke zugänglich gemacht werden sollten, indem sie auf andere Museen verteilt und dort gezeigt würden. Auch von einer Beschränkung bei den Neuerwerbungen war die Rede.109 Die Museumsdirektion wehrte sich gegen die Verteilung ihrer Objektbestände. Denn sie verstand den Angriff auf die Menge als Bedrohung ihrer Macht und Bedeutung.110 Hinter den Forderungen nach Dezentralisation und Beschränkung konnten sowohl eine föderalistische Grundhaltung wie auch spezifische regionale Einzelinteressen stehen, die gewisse Politiker und Vertreter von Museen hegten.