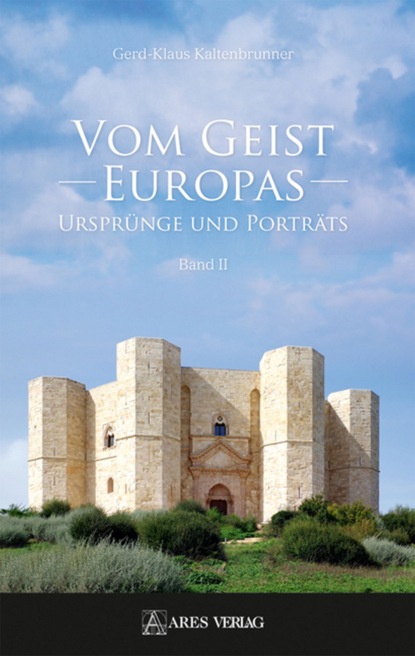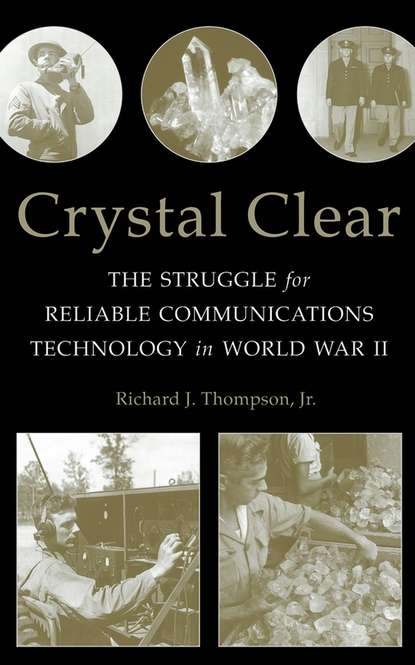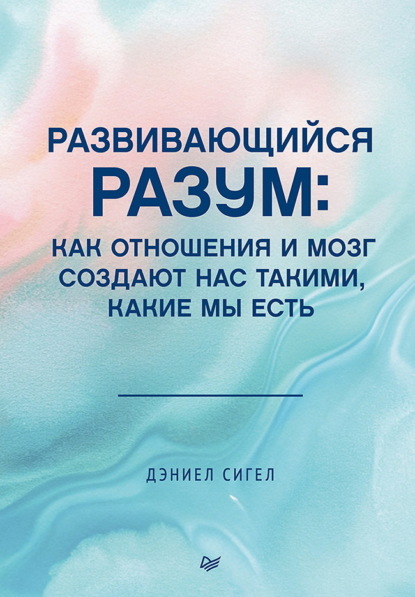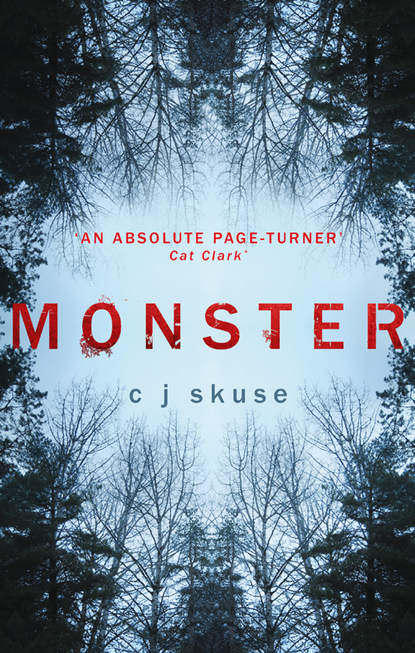- -
- 100%
- +
In der Politik gilt einzig und allein der Erfolg. Cicero aber stand so gut wie immer auf der „falschen” Seite, wenn er sich politisch engagierte. Er verpaßte den „Zug des Zeitalters”, in dem Catilina eine folgenlose Episode war, während Cäsars Stern sich im Aufstieg befand und die Umwandlung der von Bürgerkriegen erschütterten aristokratisch-konservativen Republik zu einer imperialen Einmannherrschaft mit populistischer Fassade unverkennbare Fortschritte machte. Als Mitglied des Ritterstandes galt er der den Senat beherrschenden Nobilität als bloßer „homo novus”, als unebenbürtiger Emporkömmling. Da auch Cäsar und Crassus bei dem Umsturzversuch Catilinas ihre Hände im Spiel gehabt hatten, kam ihnen Ciceros Demaskierung der Hochverräter ungelegen. Als dann Cäsars Bündnis mit Pompejus zerbrach, schlug sich Cicero, nach einem gescheiterten Vermittlungsversuch zwischen den ehemaligen Triumvirn, auf die Seite des Pompejus, der in der Schlacht bei Pharsalos besiegt wurde. Von Cäsar nach einem Jahr begnadigt, widersetzte er sich dessen Diktatur und hegte zugleich die Illussion, als sein kritischer Berater und doppelzüngiger Lobredner das Schlimmste verhüten, das heißt: Cäsar auf den republikanischen Tugendpfad zurückbringen zu können. Als er schließlich enttäuscht einsehen mußte, daß dieses Unterfangen vergebliche Liebesmüh war, weil Cäsar sogar daranging, nach der Königswürde zu greifen und sich vergotten zu lassen, näherte sich Cicero, um es vorsichtig zu formulieren, der anticäsaristischen Fronde seines Freundes Brutus. Wenngleich er nicht in die Attentatspläne eingeweiht war, weil die Verschwörer dem Redner und Anwalt nicht genügend Mut, Entschlossenheit und Ausdauer zutrauten, so läßt sich eine gewisse intellektuelle Mittäterschaft Ciceros an den Iden des März kaum leugnen. Abermals hatte der für die Wiederherstellung der überlieferten republikanisch-senatorischen Ordnung sich stark machende Politiker auf das falsche Pferd gesetzt. Zwar wurde Cäsar ermordet, aber nicht Brutus und Cassius traten an seine Stelle, sondern vorderhand das zweite Triumvirat der Cäsar-Anhänger Antonius, Lepidus und Octavian und schließlich Octavian allein, der spätere Kaiser Augustus, unter dessen Herrschaft, wie bekannt, Jesus zu Bethlehem geboren wurde.
Immer wieder schlug sich Cicero auf die falsche, die hinterher unterlegene Seite. Bis zuletzt gehörte er zur Partei der Blamierten und Besiegten, zu den, um es modern zu sagen, rückwärtsgewandten und restaurativ eingestellten Konservativen oder sogar Reaktionären, die den Gang der neuen Zeit nicht begreifen können oder wollen. Einem obsoleten, geschichtlich überholten und untergangsreifen Staatsideal anhängend, das in Ciceros Fall allerdings gerade nicht die Monarchie, sondern die Republik war, blieb ihm keine Mißgunst, Niederlage und Demütigung erspart. Nachdem er sich mit seinen (am Vorbild von Demosthenes’ Philippika ausgerichteten) Kampfreden gegen Marcus Antonius als Feind der neuen Machthaber bloßgestellt hatte und endlich auch seine Versuche, sich mit dem jungen Octavian zu verständigen, endgültig gescheitert waren, blieb Cicero nichts übrig, als wieder einmal den Rückzug auf eines seiner Landgüter anzutreten, deren berühmtestes Tusculanum in der Nähe des heutigen Städtchens Frascati war.
Hier gedachte er, wie schon in früheren erzwungenen politischen Mußepausen, seine philosophisch-literarischen Neigungen zu pflegen, um wenigstens als Schriftsteller auf die öffentliche Meinung einwirken zu können, auf die er als geächteter und zum Rückzug gezwungener Magistrat keinen unmittelbaren Einfluß mehr hatte. Vielleicht träumte der über Sechzigjährige auch davon, fern vom Lärm der Hauptstadt an einem idyllischen Zufluchtsort sein Leben als musischer Privatmann beschließen zu dürfen. Doch sogar die Erfüllung dieses Wunsches nach einem ungestörten Asyl blieb Cicero versagt, ähnlich wie schon früher seine Ehen mit Terentia und der erheblich jüngeren Publilia in Brüche gegangen waren und er den Tod seiner ebenso gebildeten wie zartsinnigen Lieblingstochter Tullia zu betrauern hatte. Als Augustus, Lepidus und Antonius daran gingen, eine Säuberung zu inszenieren, der alle Mitschuldigen an Cäsars Tod zum Opfer fallen sollten, beharrte, entgegen dem versöhnlicher gestimmten Augustus, der Triumvir Antonius darauf, daß Ciceros Name auf die Proskriptionsliste gesetzt werde. Die Hatz auf politisch mißliebige Gegner mit Sondertribunalen, Denunziantentum und Büttelwesen, mit Beschlagnahme des Vermögens, Erklärung zur Unperson und brutaler Liquidierung ohne Umschweife, wie sie bereits Sulla massiv betrieben hatte, war damit ein weiteres Mal eröffnet. Der lästige Cicero sollte aus dem Weg geräumt werden. Er galt als krimineller Dissident, Regimekritiker und unheilbar diskreditierter Anhänger des dem Tode geweihten altrepublikanischen „Systems”. Sein Bruder und Neffe — beide flüchtig — waren im Zuge des sich flächenbrandartig ausdehnenden mörderischen Terrors von oben bereits durch gedungene Häscher niedergemetzelt worden. Sippenhaftung, Lynchjustiz und zur unbeschönigten organisierten Rache herabgekommene Staatsbehörden standen auf der Tagesordnung.
In der Politik gibt es, wie man sieht, seit den alten Römern und vielleicht schon seit Hammurapi nichts Neues unter der Sonne. Dies gilt im Guten wie im Bösen. Haben wir nach mehr als zweitausend Jahren, die seither verflossen sind, andere grundsätzlich mögliche Staatsverfassungen zur Verfügung als bereits Aristoteles mit seiner Dreizahl von Monarchie, Aristokratie und Demokratie, denen die je arteigenen Verfallsformen Autokratie (Tyrannis), Oligarchie und Ochlokratie (Pöbelherrschaft) oder Anarchie entsprechen? Alles schon dagewesen. Das Repertoire ausdenkbarer und ausführbarer Modelle herrschaftlich geordneten menschlichen Miteinanderlebens ist offenbar überaus beschränkt. Sogar die Utopien, die so ehrgeizig sind, den Bereich paradigmatischer Staats- und Gesellschaftsformen auszudehnen, sind in der Ausmalung alternativer Muster monoton. Wer zwei oder höchstens drei gelesen hat, kennt alle. Ob Morus, Campanella oder Andreae, ob Morelly, Cabet oder Fourier, ob Bellamy, Morris oder Marcuse — eine gleicht der andern mit langweiliger Regelmäßigkeit. Ganze Legionen utopischer Entwürfe wiederholen bloß, bewußt oder unbewußt, das fade Schema von zwei oder drei Urformen. Auch der umstürzlerischste Neuerer steht unter dem Bann verschwindend weniger Exempel, die er eintönig wiederholt. Sogar der rücksichtsloseste dernier cri ist nichts als ein ausgeleiertes altes Lied, das allenfalls eine Zeitlang vergessen war. Die neuerungssüchtigsten Revolutionäre sind auch nur Repetenten, oft ahnungslose Vollstrecker einer Wiederkehr des Ältesten, das sie abgetan, muffig und ewiggestrig wähnten.
Cicero hat das am eigenen Leibe erfahren. Schon damals war, was Rom erschütterte und seine ehrgeizigen Bestrebungen grausam zuschanden werden ließ, überhaupt nichts Neues. Zweifelsfrei steht fest: Als Politiker zählt Cicero zu den Pechvögeln. Diejenigen Taten, auf die er bisweilen bis zu prahlerisch eitler Ruhmredigkeit am stolzesten war, erwiesen sich als Fiasko. Selbst jene Leistungen, die kurzfristig erfolgreich ausfielen, brachten ihm am Ende wenig ein. Seine edlen Absichten galten nichts. Sogar wenn ihm staatlich etwas vorübergehend gelang, wurde alsbald ein Strick daraus, den seine Gegenspieler ihm drehten. Cicero, dem es als Rhetor vergönnt war, ein lateinischer Demosthenes zu werden, scheiterte kläglich mit seinem Plan, den Rang eines römischen Perikles zu erringen. Er endete als politischer Bankrotteur, dem alles mißlang. Er machte in unüberbietbarer Weise Pleite, weil er nicht nur seine republikanischen Ideale zusammenbrechen sah, sondern auch das Scheitern seiner Staatskunst mit dem eigenen Leben bezahlen mußte. Auch das ist nichts Neues unter der Sonne: Vae Victis!, Wehe den Besiegten!
Das fortschrittsselige neunzehnte Jahrhundert hat daraus geschlossen, daß Cicero früher maßlos überschätzt worden sei. Vor allem in Deutschland wurde von Hegel bis Mommsen der Römer als seichter Versager, ärgerlicher Pfuscher und oberflächlicher Epigone abgekanzelt. Mommsen tat ihm den Schimpf an, ihn einen „Staatsmann ohne Einsicht, Ansicht und Absicht” zu nennen, der ein „aus seinen Kreisen verschlagener Feuilletonist” gewesen sei. So wenig Sympathie empfand der große deutsche Historiker, der doch selbst nach der Niederlage der demokratisch-nationalen Revolution von 1848 zu den Verfolgten gehört hatte, für den gescheiterten Verteidiger der römischen Republik gegenüber übermächtigen autokratischen Tendenzen, daß er dessen Gegner Cäsar, den Totengräber der republikanischen Verfassung, zum „demokratischen General” stilisierte, während er Cicero nicht einmal guten Willen bescheinigte.
Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts, in dem insbesondere die Deutschen in einer seit dem Fall Karthagos beispiellosen Weise zu den Besiegten gehören und, entgegen der inflationären Zunahme sich „Republiken” nennender Staaten, der Sinn für republikanische Freiheit und Würde allenthalben rückgängig ist, kann der auf der Verliererseite placierte Cicero wohl wieder mit etwas mehr Zuneigung oder wenigstens Milde rechnen. Inzwischen haben wir einige historische Lektionen erhalten, die drastisch bezeugen, daß die erfolgreich in den Rang von Weltseelen zu Pferde — so Hegel über Napoleon in einem Brief an Niethammer vom 14. Oktober 1806 — aufgerückten Agenten und Macher großer Politik die Erde in eine planetarische Schädelstätte verwandelt haben. Wir wissen auch, daß in dem, was unterlag, scheiterte und vertilgt wurde, Keime des Besseren enthalten sein können. Obwohl von der zur tellurischen Katastrophe avancierenden Weltgeschichte beiseite geschleudert und zermalmt, verkörpern sie in ihrer hingeopferten Ohmacht einen Einspruch gegen das sich steigernde Grauen. Wir verstehen besser als frühere Generationen den stolzen Ausspruch von Ciceros Zeitgenossen Cato Uticensis, ebenfalls eines Besiegten, der den Untergang der Republik durch Cäsars Sieg mit dem stoisch gefaßten Freitod beantwortete: Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni — wenngleich diese Sentenz, die ein Friedrich Gentz sich zu seinem Lebensgrundsatz zu eigen gemacht hat, einer Gesellschaft, die Fahnenflucht als allgemeines Menschenrecht verkündet, doch wieder so befremdlich oder sogar schockierend klingen muß wie die alten Verse vom Soldaten auf verlorenem Posten:
Ich kämpfe ohne Hoffnung, daß ich siege,
Ich wußte, nie komm’ ich gesund nach Haus.
Doch verhalte es sich damit im einzelnen wie immer, so scheint Ciceros Untergang am 7. Dezember 43, zwanzig Jahre nach seinem Triumph über die Verschwörung des Catilina, heute wohl mehr Betroffenheit und Anteilnahme auszulösen als vor wenigen Generationen, die darauf vertrauten, daß Bürgerkrieg, Massenmorde und Rachejustiz zu den Greueln längst überwundener Zeitalter gehörten. Ich zitiere den Bericht des Plutarch:
„Indessen kamen die Mörder schon heran, der Centurio Herennius und der Kriegstribun Popilius, den Cicero einst, als er wegen Vatermordes unter Anklage stand, vor Gericht verteidigt hatte; beide begleitet von ihren Schergen. Da sie die Türen verschlossen fanden, schlugen sie sie ein, und da kein Cicero zu sehen war und die Leute drinnen sagten, sie wüßten nichts, da soll ein junger Mensch, der von Cicero in den höheren Wissenschaften ausgebildet worden war, ein Freigelassener seines Bruders Quintus mit Namen Philologos — der ‚Wortfreund’ —, dem Kriegstribunen verraten haben, daß sein ehemaliger Lehrmeister in einer Sänfte durch dichtgewachsene, schattige Laubengänge zum Meer hinuntergetragen werde. Der Kriegstribun nahm einige Leute mit und rannte herum zum Ausgang, während Herennius im Lauf durch die Laubengänge eilte. Cicero bemerkte sein Kommen, befahl den Trägern, die Sänfte an Ort und Stelle niederzusetzen, und schaute selbst, indem er nach seiner Gewohnheit die linke Hand ans Kinn legte, mit starrem Blick auf die Mörder, von Staub bedeckt, mit ungeschorenem Haar und Bart, das Gesicht von Gram verzehrt, so daß die meisten sich verhüllten, als Herennius ihn abschlachtete. Cicero erhielt den tödlichen Hieb in den Hals, den er aus der Sänfte hervorstreckte, im vierundsechzigsten Lebensjahr. Dann schlugen sie ihm, gemäß Antonius’ Befehl, den Kopf und die Hände ab, mit denen er die Philippischen Reden geschrieben hatte; denn so hatte Cicero seine Reden gegen Antonius betitelt, und sie heißen noch heute so.
Als die abgeschnittenen Teile nach Rom gebracht wurden, war Antonius gerade dabei, Wahlen zu leiten. Kopf und Hände ließ er über den Schiffsschnäbeln auf die Rednerbühne des Forums — der Rostra — aufstecken: ein scheußlicher Anblick für die Römer, die freilich nicht Ciceros Antlitz zu sehen glaubten, sondern ein Abbild der Seele des Antonius.”
II.
Als Politiker ist Cicero gescheitert und bis heute umstritten. Manche seiner Mißerfolge führt man zurück auf mangelnde Menschenkenntnis und seine Neigung, die harten Realitäten des Ringens um staatliche Macht an abstrakten Idealen zu messen und in unangemessener Weise sittliche Normen in Bereichen geltend zu machen, wo sie kaum durchsetzbar sind, weil sie hier mit der unerbittlichen Eigengesetzlichkeit politischer Machtbehauptung notwendigerweise zusammenprallen und den kürzeren ziehen müssen. Auch daß Cicero von eitlen Zügen nicht frei war, hat wohl dazu beigetragen, daß er sich als Staatsmann keinen bleibenden Lorbeer verdienen konnte. Wäre der Römer nichts als Politiker gewesen, so gebührte ihm bloß ein kleines Kapitel in der Geschichte des Altertums. Nur Fachhistoriker würden sich mit ihm im Zusammenhang mit der Catilinarischen Verschwörung eingehender beschäftigen. Cicero stellte dann kaum mehr als eine allerdings markante Episode im Übergang von der zerrütteten römischen Republik zum augusteischen Prinzipat dar.
Doch Cicero steht der Nachwelt vorrangig nicht als Politiker vor Augen, sondern als Schriftsteller. Er gehört zu den fruchtbarsten Literaten der gesamten Antike. Obwohl etliche seiner Werke verlorengegangen sind — darunter „De gloria” und der vom heiligen Augustinus hoch geschätzte, ja geradezu als Gottesgeschenk gepriesene Dialog „Hortensius” —, so haben sich genügend Bücher erhalten, die uns Ciceros Gedanken über fast alles, was einen gebildeten und vielseitig interessierten Weltmann insgesamt bewegen kann, in wahrlich überquellender Weise vermitteln.
Darüber hinaus ist Cicero der einzige Autor der alten Welt, von dem nicht nur jene Briefe überliefert sind, die er selbst als Sendschreiben für die Öffentlichkeit bestimmt hat, sondern auch zahlreiche vertrauliche Episteln an Freunde und Verwandte, deren Publikation ihr Verfasser gewiß mißbilligt hätte. Auf Grund dieser reichlichen Quellen, an deren Erhaltung Cicero nicht im geringsten gelegen war, wissen wir heute über sein Privatleben besser Bescheid als etwa über das von Dichtern wie Lukrez oder sogar Ovid. Ausgenommen vielleicht Augustinus mit seinen „Confessiones” und seelsorglichen Briefen, ist uns bis zu Goethe kein Mensch des Abendlandes als individuelle Gestalt so bekannt wie Cicero. Wir wissen um sein Menschliches und Allzumenschliches, seine Stimmungen, Schwächen und Launen, seine Vorlieben und Abneigungen, Ärgernisse und Wunschträume. Das läßt ihn einerseits liebenswert erscheinen, weil er uns dadurch nicht nur als Marmorstatue begegnet; andererseits bietet er sich naturgemäß auch in seiner unheroischen Gewöhnlichkeit so schutzlos dar, daß indiskrete Leser leicht in die Versuchung geraten, billig triumphierend festzustellen, daß dieser Große eben nichts als ein Mensch wie du und ich sei, der sich vor niemandem auszeichne. Dieser Gefahr vermag im Zeitalter einer zum Gesellschaftsspiel gewordenen reduktionistischen Entlarvungspsychologie nachgerade überhaupt kein noch so hervorragender Geist mehr zu entgehen, sofern nur sein Privatleben ausreichend bekannt ist oder man aus dem veröffentlichten Werk auf die Intimsphäre seines Schöpfers in platter Weise zurückschließt. Zweifellos hat ein solches Vorgehen seine detektivischen Reize und es ist ja auch nicht von vornherein verwerflich, sofern dabei das kluge Wort Hegels beherzigt wird: Für einen Kammerdiener, der dem Helden die Stiefel auszieht und ihm das Bett bereitet, gibt es keinen Helden; aber das beweist nicht, daß dieser kein Held, sondern jener nur ein Kammerdiener ist.
Cicero, der glücklose Politiker, war zuvörderst ein eminenter politischer Schriftsteller und Redner. Achtundfünfzig Reden sind mehr oder minder vollständig auf uns gekommen. Deren jüngste Gesamtausgabe, zwischen 1970 und 1982 im Artemis Verlag erschienen, umfaßt sieben umfangreiche Bände. Sie erweisen Cicero als Meister lateinischer Oratorik von stilbildender Mustergültigkeit, der in einem eigenen Dialog „De oratore” die Grundsätze seiner Redelehre dargelegt hat. Bereits in seiner Jugendschrift „De inventione” (Von der rednerischen Erfindungskunst) hatte er den von der Vernunft geleiteten und verantwortungsbewußten Redner gleichsam als Philosophen im Gewand des Politikers gefeiert. Rhetorik, wie Cicero sie vorbildlich leistet und anspruchsvoll begründet, darf nicht mit eitler Phrasendrescherei, hohler Eloquenz oder verantwortungsloser Demagogie verwechselt werden. Als Ideal zeichnet er den allseitig gebildeten Redner, der nicht nur ein psychologisch bestens unterrichteter Menschenkenner, sondern auch mit der Philosophie — dieser „Mutter alles guten Handelns und Redens” —, dem bürgerlichen Recht, den Institutionen des Gemeinwesens und der politischen Geschichte bestens vertraut ist. Der vollkommene Redner ist mehr als ein Virtuose der Massensuggestion oder brillanter Dialektiker. Er zeichnet sich durch umfassende humanistische Bildung aus, die nicht bloßer Firnis ist, sondern seine gesamte Persönlichkeit prägt. Er fühlt sich der res publica mehr als einer Partei oder Fraktion verpflichtet. Seine praktische Haupttugend ist die politische Klugheit, der staatsmännische Sinn für die übergeordneten Belange des bürgerlichen Gemeinwesens. Der Orator verkörpert geradezu den normalen, den normativen Staatsmann, der, anders als der Feldherr, die Menschen vorrangig durch Wort, Zuspruch und Überredung lenkt. Der staatsmännische Redner erscheint insofern als Repräsentant des Friedens, der Urbanität, der hohen Kunst gewaltloser Menschenführung.
Darüber hinaus hat Cicero neben seinen vielfältigen literarischen Auseinandersetzungen mit aktuellen politischen Problemen sich auch als Theoretiker der Politik staatsphilosophisch betätigt. Er gehört mit Platon, Dante, Machiavelli, Fénelon, Hobbes und de Tocqueville zu jenen wegweisenden politischen Denkern, die alle im Bereich der praktischen Politik mehr oder minder erfolglos waren. Desto mehr Glück hatte Cicero auf seinem postumen Weg als Vermittler politischer Weisheit, wie mein 1971 frühverstorbener Freund René Marcic treffend in seinem letzten großen Buch „Geschichte der Rechtsphilosophie” (1971) hervorhebt: „Selten widerfährt einem die Kultur der Menschheit prägenden Kopf so viel Unbill wie Cicero. Er mag den Philosophen und solchen, die sich dafür halten, er mag Juristen und solchen, die sich dafür halten, als ein wenig schöpferischer Geist erscheinen. Gleichviel, Cicero ist ein kräftiger Denker und Formulierer … Ihm fällt die Rolle des weltgeschichtlichen Transformators im Reich der Römer zu, deren Bauarbeit an den okzidentalen Institutionen des geordneten Alltags einfach nicht überschätzt werden kann. Weder politische Theorie noch Rechts- und Staatsphilosophie können Cicero als Brückenbauer missen.”
„Brückenbauer” oder „Pfadbahner” ist übrigens die Bedeutung ranghöchsten römischen Priestertitels: Pontifex. Darauf werde ich im folgenden noch etwas ausführlicher eingehen.
Zu Ciceros staatsphilosophischen und politiktheoretischen Schriften gehört, wie bereits angedeutet, der mehrere Bücher umfassende Dialog „De oratore”. Ebenfalls in Gesprächsform sind die beiden im engeren Sinne auf Recht, Staat und Politik bezogenen Abhandlungen abgefaßt: „De re publica” (Vom Gemeinwesen) und „De legibus” (Über die Gesetze).
Geschrieben in Jahren erzwungener politischer Untätigkeit und uns zum größten Teil erst dank des glücklichen Fundes von Angelo Mai in der Vaticana bekannt, zählt „De re publica” zu den schönsten Darstellungen der Ciceronianischen Gedanken über den Staat. In den ersten drei Teilen entfaltet Cicero, insbesondere auf Lehren Platons und Polybios’, aber auch Aristoteles’ und der Stoa zurückgreifend, die Lehre von den drei Grundformen des Staates: der monarchischen, aristokratischen und demokratischen. Im Kreislauf der Verfassungen entarte jede dieser Formen, bis sie von der nächsten abgelöst werde, die ihrerseits dem Verfall unterworfen sei, bis am Ende der Zyklus wieder von vorne beginne.
Am dauerhaftesten, widerstandsfähigsten und gerechtesten sei eine ausgewogene gemischte Verfassung, ein regimen mixtum, das monarchische, aristokratische und demokratische Bestandteile enthalte. Als praktische Verwirklichung dieses politischen Ideals sieht Cicero die römische Republik in ihrer Blütezeit an. Im Konsulat sowie in der verfassungsgemäßen, auf Krisenzeiten eingeschränkten und als Staatsnotwehr begriffenen Diktatur kann man das monarchische Element Roms erblicken. Die senatorische Nobilität stellt den aristokratischen Bestandteil des Staates dar, während Komitien und Volkstribune den demokratischen zur Geltung bringen.
Mit diesen im Lichte römischer Staatspraxis gedeuteten und konkretisierten Gedanken griechischer Philosophie hat Cicero durch mehr als zwei Jahrtausende das von Europa ausgehende Politikverständnis maßgebend geprägt. Thomas von Aquin, Montesquieu und Edmund Burke fußen ebenso auf Cicero wie die Väter der amerikanischen Verfassung. Das regimen mixtum als Ausdruck der Gerechtigkeit, der iustitia, gehört zu den bleibenden Leitbildern abendländischer Staatsweisheit. Gerechtigkeit aber bestimmt Cicero als consensus iuris, als Einverständnis mit dem Recht. Einverständnis mit dem Recht bedeutet, daß jeder Bürger bereit ist, seine Ansprüche gewaltlos durchzusetzen, die Ansprüche der andern anzuerkennen und mit den eigenen auszugleichen. Dies gilt auch für die Staatsmacht als großes Ganzes. Sie kann nur dann gerecht sein, wenn sie die Gegensätze und Spannungen aufzuheben und zu vermitteln vermag. Cicero spricht auch von utilitatis communio, was kaum übersetzbar und eben deshalb ganz römisch gedacht, vielleicht am ehesten mit „Allgemeinwohl” wiederzugeben ist.
Bemerkenswert ist der ethisch gefaßte Aristokratiebegriff, das Idealbild des optimus civis, des wahren Optimaten oder Staatsmannes, der nicht kraft Abstammung und Reichtums, sondern durch seine Sorge für das Wohlergehen der Bürger, für die Erhaltung der Grundlagen potenter Staatlichkeit zur Elite gehört. Er ist Edelmann (princeps) und Reichsverweser (procurator rei publicae), der mit seiner auctoritas das Gemeinwesen gestaltet oder in kritischen Lagen wiederherstellt, um nach Erfüllung dieser Aufgabe wieder ins zweite Glied zu treten und Bürger unter Bürgern zu sein. Bereits in seiner Rede für Sestius hatte Cicero dieses staatsethisch veredelte Aristokratie- oder Optimatenverständnis entwickelt, das auch die letzten drei Bücher von „De re publica” prägt:
„Wer sind die Besten? Fragt man nach ihrer Zahl: Es sind unzählige, sonst könnten wir uns ja auch gar nicht halten. Es sind die Häupter des Staatsrates, es sind deren Anhänger, es sind Angehörige der oberen Stände, denen der Zugang zum Senat offensteht, es sind römische Bürger aus den Landstädten (wie Cicero selbst, der aus dem volskischen Landstädtchen Arpinum am Flusse Liris stammt. G.-K. K.) und Bauern, es sind Geschäftsleute, ja sogar Freigelassene (das heißt frühere Sklaven. G.-K. K.) sind Optimaten … Optimaten sind alle, die weder Verbrecher noch von Haus aus schlecht oder durch zerrüttete Verhältnisse behindert sind. Also diejenigen sind es, die du eine Sippschaft nennst: die Unbescholtenen, die Vernünftigen, die in geordneten Verhältnissen Lebenden. Diejenigen, die deren Gesinnung, Interessen und Grundsätze in der Politik verfechten, gelten als die Schutzherren der Optimaten, als die bedeutendsten Optimaten, die angesehensten Bürger und die ersten Männer im Staat. Welches ist nun das Ziel dieser Staatslenker, das sie im Auge haben und nach dem sie ihren Kurs ausrichten müssen? Das, was das Beste und Wünschenswerte für alle vernünftigen, anständigen und wohlgestellten Bürger ist: Ruhe bei Wahrung des Ansehens. Wer dieses Ziel im Auge hat, gilt als Optimat; wer es verwirklicht, als Mann höchsten Ranges und als Retter des Staates. Das Streben nach Ansehen darf ja einerseits nicht dazu verleiten, die Ruhe zu gefährden; andererseits darf man sich aber auch keiner Ruhe hingeben, die mit der Wahrung des Ansehens unvereinbar ist. Grundlagen und Mittel dieser Vereinigung von Ruhe und Ehre, die von den führenden Politikern geschützt und sogar unter Lebensgefahr verteidigt werden müssen, sind diese: die religiösen Einrichtungen, die Auspizien, die Machtbefugnis der Beamten, die Autorität des Senats, Gesetz und Herkommen, Rechtsprechung und Gesetzgebung, Treu und Glauben, Provinzen und Bundesgenossen, das Ansehen der Militärgewalt, Kriegs- und Finanzwesen. Als Schützer und Verteidiger von Institutionen dieser Bedeutung aufzutreten erfordert in hohem Maße Mut, außergewöhnliche Fähigkeiten und große Beharrlichkeit …”