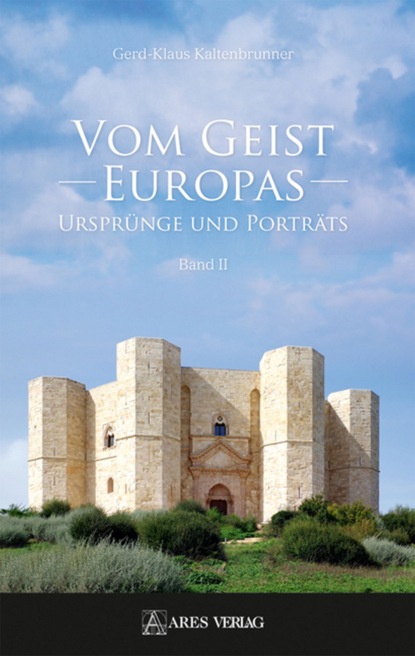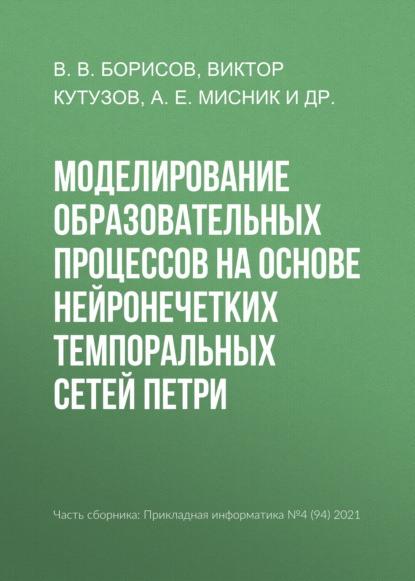- -
- 100%
- +
Nachdem Cicero in den ersten drei Büchern von „De re publica” das Leitbild einer gemischten Verfassung dargelegt hat, widmet er die restlichen drei dem dieser wohlgeordneten Staatsform entsprechenden Menschen, der ihn tragenden sittlichen Ordnung der Gemeinschaft, der Gestalt des Staatsmannes und seinem Handeln in Zeiten der Gefahr.
Den weihevollen Abschluß bildet die in kosmisch-göttliche Dimensionen sich aufschwingende Traumerzählung des jüngeren Scipio, das visionäre Somnium Scipionis. Dieser Bericht ist die schönste Darstellung des pythagoreischen Gedankens von der Harmonie der Sphären, eines von astraler Musik durchtönten Weltalls. Sie hat schon im Altertum die Leser fasziniert, wurde immer wieder ausgedeutet, so von Macrobius und Boëthius, und hat über die Renaissance hinaus bis weit in die Neuzeit stets aufs neue sowohl durch ihren dichterischen Schwung als auch ihren religiösen Tiefsinn dafür empfängliche Menschen in den Bann geschlagen. Scipio erzählt am letzten Tag des dreitägigen Symposions von einem Traum, der ihm vor vielen Jahren zuteil wurde, als er im Hause des befreundeten Königs Massinissa von Numidien übernachtete. In diesem Traum erschien ihm sein Ahnherr Scipio Africanus der Ältere, der Sieger über Hannibal und Großvater der Gracchen. In himmlische Höhen entrückt, betrachtet er gemeinsam mit dem berühmten Vorfahren die Milchstraße und noch viele andere nie zuvor gesehene Sterne; die Erde aber erscheint ihm winzig klein:
„Als ich sie weiter anschaute, sagte Africanus: ‚Ich bitte dich, wie lange wird dein Geist am Boden haften bleiben? Siehst du nicht, in welche Tempel du gekommen bist? In neun Kreisen oder besser Kugeln ist alles verbunden. Der eine von ihnen ist der himmlische, der äußerste, der alle übrigen umfaßt, der höchste Gott selbst, die übrigen einschließend und bergend. An ihm sind angeheftet jene ewig kreisenden Bahnen der Sterne. Unter ihm liegen sieben, die sich rückwärts drehen in entgegengesetzter Bewegung zum Himmel. Eine Kugel von ihnen hat jener Stern besetzt, den sie auf Erden Saturn heißen. Darauf folgt jener Glanz, dem Menschengeschlecht günstig und heilsam, der Jupiter gehört, wie man sagt. Dann kommt das rötliche und der Erde schreckliche Leuchten des Mars. Darauf hat darunter etwa die Mitte die Sonne inne, die Führerin, Fürstin und Lenkerin der übrigen Sterne, die Seele und Regierung der Welt, von solcher Größe, daß sie alles mit ihrem Lichte bescheint und erfüllt. Ihr folgen wie Begleiter die Bahnen der Venus, des Merkur, und im untersten dreht sich der Mond, von den Strahlen der Sonne angesteckt. Darunter gibt es dann nur noch Sterbliches und Hinfälliges, außer den Seelen, die durch das Geschenk der Götter dem Menschengeschlecht gegeben sind; oberhalb des Mondes aber ist alles ewig. Denn sie, die Mitte und Neunte ist, die Erde, bewegt sich nicht und zu ihr streben alle Gewichte durch ihre eigene Schwere’.”
Der Kosmos, dessen Mitte im Sinne des ptolemäischen Weltsystems die Erde ist, erscheint als reichgegliedertes Heiligtum der Götter und Seligen. Ausdrücklich gebraucht Cicero die Mehrzahl templa: das Universum ist gleichsam ein Tempel aus Tempeln. Die Mitte der sieben Planetenbahnen nimmt die Sonne ein, dux et princeps, mens et temperatio mundi, Führerin, Fürstin, Seele und Regierung des Alls. Die Reihenfolge der Himmelskörper entspricht dem verbreiteten pythagoreischen Modell: Erde, Mond, Merkur, Venus, Sonne, Mars, Jupiter, Saturn und dann folgt die Fixsternsphäre (stellifer). Die Erde ruht unbeweglich inmitten des kreisenden Weltalls. Cicero folgt hierin nicht dem Pythagoreer Philolaos von Kroton, der Erde, Mond, Sonne, Planeten und Fixsternhimmel um ein „Zentralfeuer” kreisen ließ, sondern einer populäreren pythagoreischen Auffassung.
Doch lauschen wir wieder Cicero selbst, der Scipio berichten läßt:
„Als ich dies staunend betrachtete, sagte ich, während ich mich faßte: ‚Was ist hier? Was ist dieser so gewaltige und süße Ton, der meine Ohren erfüllt?’ — ‚Das ist jener Ton, der, getrennt durch ungleiche, aber doch in bestimmtem Verhältnis sinnvoll abgeteilte Zwischenräume, durch Schwung und Bewegung der Kreise selber bewirkt wird und, das Hohe mit dem Tiefen mischend, verschiedene Harmonien ausgeglichen hervorruft; denn so gewaltige Bewegungen können nicht in Stille angetrieben werden und die Natur bringt es mit sich, daß das Äußerste auf der einen Seite tief, auf der anderen aber hoch tönt. Daher bewegt sich jene höchste sternentragende Bahn des Himmels, deren Umdrehung schneller ist, mit einem hohen und aufgeregten Ton, die des Mondes aber und unterste mit dem tiefsten. Denn die Erde als neunte und unbeweglich bleibend hängt immer an einem Sitz, die Mitte des Weltalls einnehmend. Jene acht Bahnen aber, von denen zwei dieselbe Kraft besitzen, bewirken sieben durch Zwischenräume unterschiedene Töne, eine Zahl, die der Knoten fast aller Dinge ist; das haben gelehrte Männer — eben die Pythagoreer — mit Saiten und Stimmen nachgeahmt und sich damit die Rückkehr zu diesem Ort erschlossen, wie andere, die mit überragender Geisteskraft im menschlichen Leben göttliche Studien gepflegt haben. Von diesem Ton sind die Ohren der Menschen erfüllt und dafür taub geworden; und kein Sinn in euch ist abgestumpfter; ähnlich wie dort, wo der Nil in Katarakten von den höchsten Bergen herabstürzt, das diese Gegend bewohnende Volk wegen der Gewalt des Geräusches nichts mehr hört. Dieser Ton aber ist infolge der überaus raschen Umdrehung des ganzen Weltalls so gewaltig, daß ihn die Ohren der Menschen nicht fassen können, so wie ihr auch nicht unmittelbar die Sonne anschauen könnt und eure Sehschärfe und euer Gesicht durch ihre Strahlen besiegt wird.”
Für Cicero ist somit die Harmonie der Sphären eine Wirklichkeit. Der Kosmos erscheint ihm als von Sternenmusik erfüllte Tempelstadt. Solange wir auf Erden weilen, können wir zwar wegen unserer abgestumpften Ohren diese Klänge nicht vernehmen, ähnlich wie unser Auge unfähig ist, in das Strahlenmeer der klaren Sonne zu schauen; doch Scipio Africanus maior und die übrigen Seligen genießen das Vorrecht, das All wunderbar tönen zu hören. Im Traum durfte bereits hienieden auch Scipio minor der Sternenmusik lauschen. Cicero verzichtet darauf, die von dem träumenden Scipio staunend wahrgenommene Harmonie der Sphären in allen Einzelheiten genau zu erläutern. Er nimmt davon Abstand, nach Art der pythagoreischen Schule die Himmelsmusik mit mathematischen Überlegungen zu beweisen oder gar in Gestalt einer Tonleiter oder eines Saiteninstruments anschaulich wiederzugeben. Er schildert mit einfachen und gleichwohl ergreifenden Worten das erhabene Bild eines kreisenden Kosmos, in dem die äußerste und göttlichste Sphäre, die der Fixsterne, sich am raschesten umdreht, während der erdnahe Mond sich am langsamsten bewegt und die von den Menschen bewohnte Erde still in der Mitte steht. Nicht sie ist aber, wie wir bereits vernommen haben, die fürstliche Seele und Regierung der Welt, sondern die Sonne, die sich etwa in der Mitte zwischen Saturn, Jupiter und Mars einerseits, Venus, Merkur und Mond andrerseits befindet. Diese sieben Lichter erfüllen mit sieben Tönen das All, mit dem untersten und tiefsten des Mondes anhebend und sich zunehmend steigernd bis zum Klang des Saturn; die abschließende Oktave der Tonleiter bildet die höchste und allumfassende Fixsternsphäre.
Es sind zuvörderst nicht kosmologisch-astronomische Neigungen, die Cicero veranlaßten, „De re publica” in diesem visionären Bild gipfeln zu lassen. Schließlich ist „De re publica” kein naturphilosophischer Traktat, sondern eine dialogische Erörterung über den besten Staat und den wahren Staatsmann. Deshalb legt Cicero dem im Traum Scipios erscheinenden Stammvater folgende aufschlußreiche Worte in den Mund:
„Damit du, Africanus, dich noch eifriger für die Rettung des Staates einsetzest, sollst du wissen, daß allen, die das Vaterland bewahrt, unterstützt, gefördert haben, im Himmel ein sicherer Platz bestimmt ist, wo sie glücklich ein ewiges Leben genießen. Nichts ist nämlich jenem höchsten Gott, der die ganze Welt regiert, von allem, was auf Erden geschieht, wohlgefälliger als die Zusammenschlüsse und Vereinigungen von Menschen, die sich auf der Grundlage des Rechts vollziehen und ‚Bürgerschaften’ genannt werden. Deren Lenker gehen von hier aus und kehren hierher zurück.”
Die Gründung, Bewahrung oder Wiederherstellung von Staaten auf dem Fundament des Rechts ist somit das der Gottheit wohlgefälligste menschliche Tun. Die sich im Rechtsstaat verwirklichende Vergesellschaftung, Selbstzähmung und Kultivierung des Menschen steht unter himmlischem Schutz. Diejenigen, die sich darum verdient machen, kommen im strengen Sinne des Wortes in den Himmel. Dieser Himmel ist kein nebuloser Zustand der Seligen, wie ihn die neuere christliche Theologie darstellt (falls sie überhaupt noch davon zu sprechen wagt), sondern derselbe Himmel, den wir in jeder klaren Nacht sehen können: der für das antike Auge wohlgeordnete, ebenmäßige und geründete Kosmos mit Sonne, Mond und Sternen als Aufenthalt der Götter und ihrer Lieblinge. Es ist ein von leuchtenden und tönenden Gestirnen erfüllter sphärischer Himmel, der in gewisser Weise einen großen, Menschen wie Götter beherbergenden Staat darstellt, an dem sich die kleineren irdischen Gemeinwesen, die civitates der Sterblichen, und insbesondere die principes und gubernatores rei publicae, die wahren Optimaten und Staatskünstler, ausrichten können und sollen. Als überirdischer, aber durchaus nicht außerweltlicher Lohn winkt ihnen nach dem Tode statt des finsteren Orkus die Entrückung zu den selig kreisenden Sternen, von denen sie einst gekommen sind. „Sie gehen von hier aus und kehren hierher zurück”, verrät der ältere Scipio dem Nachfahren, um ihn in dem edlen Ehrgeiz zu bestärken, ein überragender Staatsmann zu werden. Mit diesem Wort spielt Cicero auf die Seelenwanderungslehre der Pythagoreer an.
Cicero hat erstaunlich viel geschrieben. Neben seinen zahlreichen Briefen (insgesamt 864), Reden und den rhetorischen Schriften „De inventione”, „De oratore”, „Brutus” und „Orator” hat er nicht nur Staat und Politik behandelnde Werke verfaßt, sondern sich zu fast allen menschlich bedeutsamen Angelegenheiten geäußert: zur Erkenntnistheorie („Academica”), Sittenlehre („De finibus bonorum et malorum”, „Tusculanae disputationes”, „De officiis”), Rechtsphilosophie („De legibus”), Theologie („De natura deorum”), über Freundschaft („Laelius de amicitia Dialogus”), Alter („Cato maior de senectute”), Weissagung („De divinatione”), Schicksal, Notwendigkeit und Kausalität („De fato”), Ruhm („De gloria”, verlorengegangen) und den Tod („Consolatio ad se ipsum”, Trostschrift an sich selbst nach dem Tode der Tochter Tullia).
Mit diesen Werken hat Cicero die griechische Philosophie in selbständiger Auswahl den Römern vermittelt. Er hat in der äußerst unphilosophischen römischen Kultur dem Erbe Platons, Aristoteles’ und der Stoiker Eingang verschafft, ja die uns teilweise noch heute vertraute lateinische Terminologie, in der seit zweitausend Jahren europäische Philosophen die Probleme formulieren, überhaupt erst geschaffen.
Cicero konnte vollendet griechisch, er hatte in Athen und auf Rhodos griechische Philosophie eifrig studiert und sich eine unvergleichliche Belesenheit angeeignet. Er übersetzte Platon, Aratos und andere griechische Autoren ins Lateinische, schrieb einen Teil seiner Briefe auf griechisch und schmückte auch seine lateinischen Sendschreiben immer wieder mit griechischen Zitaten. Sich an Leser wendend, die hellenische Geistigkeit und Freude an sublimem Denken schätzen, war ihm die Sprache Sokrates’ nicht minder geläufig als einem gebildeten Deutschen zur Zeit der Aufklärung die Sprache Voltaires. Viele Gedanken griechischer Philosophie kennen wir nur dank der Ciceronianischen Übersetzertätigkeit, weil die originalen Texte in Verlorenheit geraten sind. Der Römer, der bei den Griechen in die Schule ging, wurde zur einzigen Quelle, durch die wir heute über manche philosophische Leistungen des hellenischen Geistes einigermaßen Bescheid wissen. Daß das Lateinische, ursprünglich eine überaus rustikale Sprache, später zur lingua franca europäischer Theologie, Philosophie und Wissenschaft wurde, in der ein Thomas von Aquin, Meister Eckhart, Nikolaus Cusanus, Descartes, Grotius, Spinoza, Pufendorf, Leibniz und zum Teil auch noch Kant ihre Werke schrieben, das verdanken wir Cicero.
Es ist des öfteren hervorgehoben worden, daß Cicero kein originaler Philosoph gewesen sei. Er gehört nicht zu den großen Systemschöpfern wie Aristoteles, Spinoza oder Hegel. Der zuletzt genannte deutsche Denker wirft dem römischen sogar vor, daß „es ihm überhaupt an philosophischem Geiste fehlte”. Cicero, so Hegel, habe oft schlechte Einfälle; es mangle ihm an spekulativem Tiefsinn; seine Verständigkeit sei durch „Plattheit” gekennzeichnet. Mommsen unterstellt ihm das eitle Bestreben, nicht nur ein lateinischer Demosthenes, sondern mit seinen popularisierenden Bearbeitungen griechischer philosophischer Werke auch ein lateinischer Platon zu werden. Cicero sei ein eklektischer Vielschreiber, ein grundsatzloser Vermittler und unschöpferischer Kompilator, ja Plagiator gewesen. Das vorige Jahrhundert, das nicht nur ein Zeitalter der Naturwissenschaft, sondern auch der kritischen Philologie war, hat mit viel Spürsinn die griechischen Vorbilder Ciceros aufgedeckt und ihm vorgeworfen, daß er die Quelle oft nicht einmal selbst, sondern nur vermittels irgenwelcher Kompendien, Auszüge oder Blütenlesen studiert und manchmal schlechterdings mißverstanden habe. Cicero sei im Grunde kein Philosoph, sondern günstigstenfalls ein redseliger Enzyklopädist der Philosophie, ein nicht immer zuverlässiger Reiseführer zu den Systemen griechischer Metaphysik. Es ist ja auch kein Zufall, daß „Cicerone” zum Inbegriff des geschwätzigen Fremdenführers wurde.
Es läßt sich nicht leugnen, daß alle diese Einwände zumindest ein Gran Wahrheit enthalten. Gewiß bedauern wir manchmal, daß Cicero nicht immer seine Quellen genau angegeben oder wenigstens exakt übersetzt hat. Aber ist es nicht etwas schnöde, ihm deshalb pedantisch am Zeuge zu flicken? Wie hätte Cicero vorhersehen können, daß dereinst viele philosophische Werke der von ihm bewunderten Griechen untergehen, seine eigenen unsystematischen Bearbeitungen hingegen weitestgehend erhalten bleiben würden? Ist er uns nicht durch eben diesen überlieferungsgeschichtlichen Unfall desto kostbarer geworden?
Vor allem aber gilt es sich zu vergegenwärtigen, daß Cicero in erster Linie Politiker war, der sich überwiegend nur in Zeiten erzwungener Muße oder zum eigenen Troste mit Philosophie befaßte. Er leitete keine Akademie, war nicht Haupt einer philosophischen Sekte, dozierte nie als Professor. Er wollte als Staatsmann ruhmvoll im Gedächtnis der Nachwelt weiterleben, nicht als eigenständiger Philosoph. Unmißverständlich huldigte er der echt römischen Auffassung, daß der Vorrang der vita activa, nicht der vita contemplativa zukomme. Die Philosophie war ihm zwar mehr als ein bloßes Steckenpferd, er schätzte sie als ernstzunehmende Freizeitbeschäftigung eines geplagten Mannes; aber sie durfte ihn nicht von politischer Tätigkeit abhalten. Sie war ihm lieb als Entscheidungshilfe, Tröstung, Kunst der Beweisführung und Disziplin; aber er hätte es für aberwitzig und wohl auch würdelos gehalten, hauptsächlich zu philosophieren oder gar von der Philosophie leben zu wollen.
Cicero steht vor uns als Prototyp eines philosophierenden Politikers, nicht aber eines allein der Theorie sein Leben weihenden Philosophen. Er ist ein Gentleman-Philosoph, der mit urbaner Großzügigkeit alle wichtigen Ansichten prüfend durchmustert, um sich bald von dieser, bald von jener wetteifernden Schule das, was ihm zutreffend erscheint, herauszuholen und wo möglich mit dem, was der gesunde Menschenverstand bereits weiß, in Übereinstimmung zu bringen. Ciceros Verfahren kann man insofern als republikanisch und liberal kennzeichnen. Er überträgt die Grundsätze staatsbürgerlicher Unterredung und sozialen Kompromisses auf die philosophische Wahrheitssuche. Wie er in der Politik die Monarchie als Herrschaft eines Einzigen verwarf, so in der Philosophie die alleinseligmachende Unterwerfung unter eine einzige Doktrin. Das Glück des Weisen bestand für ihn im Suchen der Wahrheit, nicht in der Behauptung, sie bereits zu besitzen. Cicero ist jeder Fanatismus fremd. Er gehört nicht zu den Eiferern, die auf ein absolut verbindliches System eingeschworen sind. Er ist kein Ideologe und Dogmatiker. Starres Festhalten an Lehrmeinungen erschien ihm nicht nur als Anmaßung (arrogantia), sondern vor allem als Verletzung der einem Gentleman geziemenden verecundia. Das Wort verecundia ist im Deutschen schwer wiederzugeben. Es bedeutet Zurückhaltung, Scheu, Achtung, Schamgefühl. Der Dogmatiker, so meint Cicero, frevelt gegen das Gebot schicklicher Zurückhaltung und Achtung vor der in anderen Ansichten enthaltenen Wahrheit. Er ist intellektuell schamlos, hat keinen Sinn für vornehme Dezenz, spreizt sich hochmütig auf, ermangelt des im kultivierten Umgang mit andern Menschen notwendigen Taktgefühls. Der Dogmatiker ist zuinnerst unhöflich, das philosophische Gegenstück zum staatlichen Tyrannen. Der Dogmatiker ist, selbst wenn er politisiert, überhaupt kein politischer Mensch im anspruchsvollen Sinne des Wortes. Er ist unpolitisch, ja antipolitisch, wenn man daran festhält, daß Politik wesensmäßig Unterredung, Ausgleich, Vermittlung bedeute.
Als undogmatischer Gentleman-Philosoph prüft Cicero die verschiedenen Richtungen, läßt sie oft überzeugend in Gestalt eines Dialogteilnehmers zu Wort kommen und entnimmt den einzelnen Schulen das ihm Gemäße. Er ist Platoniker, Aristoteliker, Stoiker, vor allem aber ein maßvoller Skeptiker. Als eklektisch, das heißt auswählend vorgehender Philosoph neigt er beispielsweise einerseits zu einem entschiedenen Vorsehungsglauben, andererseits setzt er sich aber ebenso bestimmt für die Willensfreiheit ein. Er entrollt in dem bereits erwähnten staatstheoretischen Werk im Anschluß vor allem an Polybios ein packendes Bild des aufsteigenden Römerreiches bis zur Epoche der Eroberung des hellenistischen Ostens und erörtert das stufenweis allmähliche Werden der besten Verfassung an einem Beispiel der Geschichte (und nicht anhand eines Mythos), ohne jedoch diesen Aufstieg als absolute historische Notwendigkeit oder Zielstrebigkeit zu deuten. Er betont den Primat politischer Praxis und tröstet sich im Somnium Scipionis mit dem Gedanken, daß von den erdentrückten Sphären aus betrachtet alle Welthandel äußerst belanglos erscheinen. Er preist die erhabene Schönheit des selig kreisenden Kosmos und versichert gleichwohl unumwunden, daß es auf Erden darauf ankomme, staatsmännisch tätig zu sein, um dereinst die Entzückungen des gestirnten Himmels genießen zu dürfen. Seine grundsätzliche Skepsis hindert ihn nicht daran, gelegentlich auch gegenüber kühl abwägendem, alles relativierendem Zweifel skeptisch zu sein und die Philosophie, wie im Schlußteil der „Tuskulanischen Gespräche”, geradezu als erhabene Göttin psalmodierend zu lobpreisen und ihr Vollmachten zu erteilen, die er ihr sonst vorenthält:
„Philosophie, du Führerin des Lebens, Erforscherin der Tugend, Vertreiberin des Lasters! Was wären wir, was wäre das menschliche Leben überhaupt ohne dich! Du hast Städte hervorgebracht, du hast die zerstreut lebenden Menschen in Lebensgemeinschaften zusammengerufen, sie zuerst durch Ansiedlung, dann durch Ehe, endlich durch die gemeinsame Schrift und Sprache verbunden. Du warst die Erfinderin der Gesetze, die Lehrerin von Sitte und Ordnung. Zu dir nehmen wir unsere Zuflucht, von dir erflehen wir Hilfe, dir vertrauen wir uns an, wie früher schon in so vielem, aber jetzt ganz und gar. Ein einziger Tag, in rechter Weise nach deinen Geboten verbracht, ist einer ganzen Ewigkeit voller Missetaten vorzuziehen. Wessen Hilfe sollten wir also eher in Anspruch nehmen als die deine, die du uns ein Leben in Ruhe geschenkt und die Todesfurcht genommen hast?”
III.
Typisch für Ciceros schwer zu bestimmende, weil ein eigenes geschlossenes System vermeidende Position ist sein dem späteren Cäsarmörder Brutus gewidmeter Dialog über die Natur der Götter. Es ist dies nicht die einzige Schrift, die Cicero dem gebildeten, auch als Schriftsteller mit Werken über das pflichtgemäße Handeln, die Tugend und die Geduld hervorgetretenen Verschwörer dediziert hat. Wieder einmal läßt der Philosoph die Vertreter der unterschiedlichsten Schulen auftreten: den Epikureer Velleius, den Stoiker Balbus und den Skeptiker Cotta. Wenn ich das Werk, das Ciceros Theologie in konzentrierter Form wiedergibt und eine geradezu enzyklopädische Fundgrube für die Vielfalt antiker Gottesvorstellungen bildet, vorhin einen Dialog genannt habe, so ist das nicht ganz richtig. Anders als Platon, dessen Schriften meist echte Zwiegespräche darstellen, läßt Cicero mehrere Männer zusammenkommen, deren drei dann Vorträge halten, denen die übrigen lauschen. Nur als Füllsel werden zu Beginn und jeweils zwischen den Referaten einige Wechselreden gebracht. Es geht um die Frage nach Wesen und Realität der Götter, deren Einwirkung auf das Weltgeschehen und ihre Beeinflußbarkeit durch die Menschen. Dies sind somit Probleme, die bereits drei Jahrhunderte nach Cicero mit bis zu mörderischer Wut sich steigerndem Glaubenseifer erörtert und noch in der europäischen Neuzeit mit Schwert, Gewissenszwang und Folter entschieden wurden. Wie ganz anders ist die Atmosphäre, die den Ciceronianischen Vortragszyklus durchdringt!
Man muß „De natura deorum” selber lesen, um einen unmittelbaren Eindruck von der liberalen Urbanität und gelegentlich mit den höchsten Dingen ehrfürchtig scherzenden Heiterkeit des Geistes zu gewinnen, die Cicero auszeichnet. Da spricht der Epikureer, der die Wirklichkeit der Götter zwar nicht leugnet, aber ihnen doch jeden Einfluß auf das Irdische abspricht. Wie alles Seiende, bestehen auch die Götter aus Atomen, allerdings ganz besonders feinen. Sie sind nichts als ätherisch schöne Gestalten, leidlos und weltenthoben, weder aus Zorn noch aus Zuneigung sich um die Welt kümmernd, souverän gleichgültig gegenüber Guten und Bösen. Daher haben die Sterblichen auch nicht den geringsten Grund, sich vor ihnen abergläubisch zu fürchten. Was von allem Kult übrigbleibt, ist eine Art von ästhetischer Religiosität, eine heitere Andacht zum glückselig Schönen, das sich in den Göttern gestalthaft-traumgleich kundgibt.
Dann kommt der Stoiker Balbus zu Wort, der ein ganz anderes Bild enthüllt. Er rühmt das allumfassende Walten göttlicher Vorsehung, die erstaunliche Zweckmäßigkeit der kosmischen Ordnung und insbesondere der irdischen Lebensverhältnisse sowie die hinreißende Schönheit der Welt. All dies beweise doch aufs eindringlichste, daß eine göttliche Vernunft die gesamte Natur in wunderbarer Weise lenke. In hymnischen Worten lobpreist Balbus den Kosmos, der „sozusagen das gemeinsame Heim der Götter und Menschen oder eine Stadt für beide” sei: Est enim mundus quasi communis deorum atque hominum domus aut urbs utrorumque. Das Weltall ist somit ein von Göttern, Menschen und andern Lebewesen bewohnter „Weltstaat”, der Kosmos eine Kosmopolis, gleichsam ein Römisches Reich im großen. Alles hängt mit allem weise geordnet zusammen. Nicht atomistischer Zufall, wie die Epikureer meinen, sondern erhabene Finalität zeichne die Verfassung des Universums aus. Es sei durchgehend teleologisch eingerichtet, von einer staunenerregenden Zielstrebigkeit durchwaltet. Alles ist, wenngleich in verschiedenem Maße, beseelt — auch die Sterne und der Kosmos insgesamt. Gustav Theodor Fechners Panpsychismus ist vollumfänglich vorweggenommen:
„Es gibt also eine Naturkraft, die das ganze Weltall zusammenhält und bewahrt, und die ist nicht ohne Empfindungsvermögen und Denkkraft. Denn jedes Wesen, das nicht für sich allein steht und nicht nur aus einem einzigen Teil besteht, sondern noch mit anderem verbunden und verknüpft ist, muß in sich eine herrschende Grundkraft haben, wie der Mensch die Seele, das Tier etwas der Seele Ähnliches, aus der alle Triebe entstehen … Nun sehen wir aber, daß den Teilen des Weltalls — es gibt im ganzen Weltall ja nichts, was nicht zugleich auch ein Teil des Ganzen wäre — Bewußtsein und Denkvermögen (sensum atque rationem) innewohnt. Also müssen in dem Teil, in dem die Grundkraft (principatus) des Weltalls enthalten ist, diese Eigenschaften auch enthalten sein, und zwar in noch schärfer ausgeprägtem und vollkommenerem Maße. Demzufolge muß das Weltall weise sein und das Wesen, das alle Teile zusammengefaßt hält, sich durch Vollkommenheit seines Denkvermögens auszeichnen, und deshalb muß das Weltall göttlich sein und die ganze Kraft des Weltalls durch göttliches Wesen erhalten werden … Und liegt damit diese Göttlichkeit des Weltalls (mundi divinitate) klar, dann muß die gleiche Göttlichkeit auch den Gestirnen zugesprochen werden,… man kann sie mit vollstem Recht ebenfalls für beseelte Wesen halten und ihnen Empfindung und Denkkraft (sentire atque intellegere) zusprechen … Das Empfindungsvermögen und den Verstand der Gestirne aber beweist vor allem die von ihnen stets eingehaltene und unwandelbare Gleichmäßigkeit ihrer Bahnen — denn ohne kluge Einsicht kann sich nichts vernünftig und regelmäßig bewegen —, bei der nichts unbedacht, launenhaft und zufällig abläuft. Der geordnete Lauf der Gestirne und die Beständigkeit ihrer Bewegung seit ewigen Zeiten deuten aber weder auf eine bloß mechanische Kraft hin — denn sie ist voll Überlegung (plena rationis) —, noch auf launischen Zufall, der die Abwechslung liebt und von Beständigkeit nichts wissen will. Es folgt also, daß sich die Gestirne aus eigenem Antrieb (sua sponte), aus eigener Empfindung und kraft göttlichen Wesens (suo sensu ac divinitate) bewegen.”