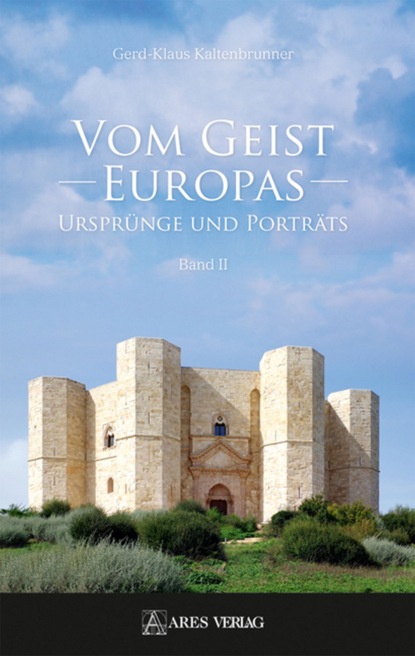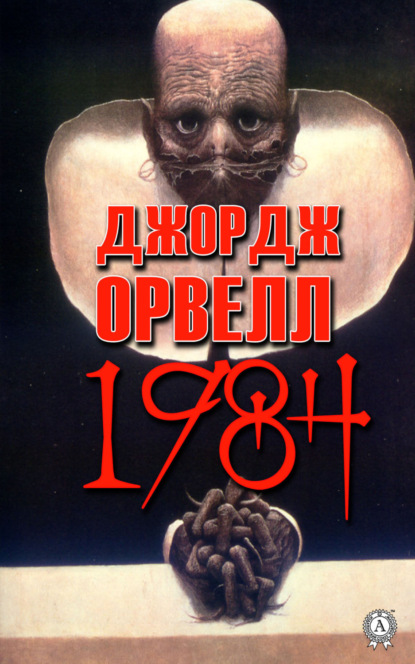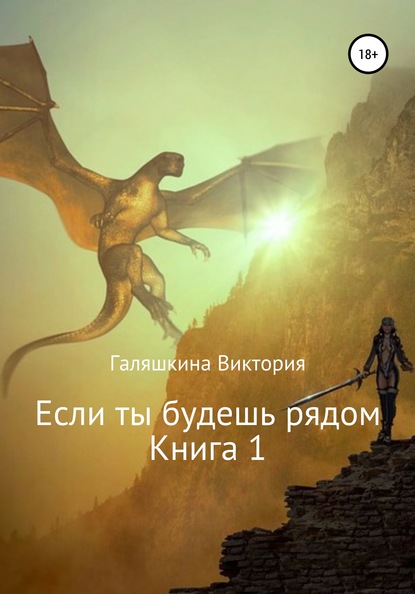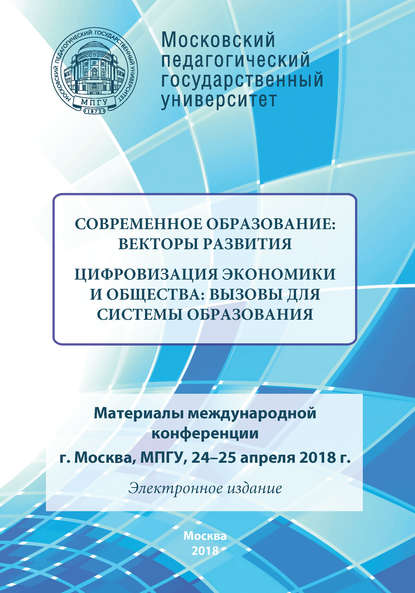- -
- 100%
- +
In einem dermaßen durchgotteten und seelenvollen Universum, das eine Menschen wie Götter familiär umfassende Heimstatt ist, sind auch Unglücksfälle und Untergänge nur Episoden, die die allgemeine Schönheit und Wohlordnung nicht beeinträchtigen. Sie stellen bloß dramatische Intervalle zwischen zwei symphonischen Zyklen dar. Alles Dunkle ist zuinnerst auf Erhellung angelegt. Noch die finstersten Verliese haben ihre leuchtenden Ampeln, werden durchlässig für den Einbruch himmlischer Erleuchtungen. Es gibt keine Hölle, und beinahe könnte auch Ciceros Stoiker mit dem Apostel überschwänglich ausrufen: „Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel?” Die ärgsten Verheerungen der Geschichte sind sozusagen jahreszeitlich bedingte Schlechtwetterlagen, die zwar hie und da vereinzelten Schaden bewirken mögen, sich aber dem Weisen als heilsame Zwischenspiele im rhythmischen Kreislauf universaler Wohlgeordnetheit zu erkennen geben. Niederlagen einzelner beweisen wenig gegen die Theodizee. Die Götter kümmern sich eben nach Art hochgestellter Persönlichkeiten nicht um jede Kleinigkeit, sondern geben nur auf den allgemeinen Gang der Dinge sorglich acht. Dennoch sprechen sie immer wieder freundschaftlich zu den Menschen, von denen zumindest die bedeutenden und hochherzigen auf ihren Beistand vertrauen dürfen: „Es hat noch niemals einen großen Mann ohne göttliche Eingebung (sine aliquo adflatu divino) gegeben. Großen Männern schlägt alles, was sie unternehmen, stets nur zum Glück aus.”
Am Ende aber spricht Caius Aurelius Cotta. Schon in der zweiten Hälfte des ersten Buches hat er die epikureische Theologie als ästhetisch-hedonistisch verschleierten Atheismus mit elegantem Spott bloßgestellt. Was sind denn das für Götter, die mit den Menschen gar keine Gemeinschaft pflegen? Wie könne es dankbar fromme Gesinnung (pietas) ihnen gegenüber geben, wenn die Menschen von ihnen nichts empfangen und ihnen deshalb auch nichts schulden, somit kein „Rechtsverhältnis” zwischen Sterblichen und Unsterblichen bestehe? Es sei ja gut und schön, wenn die Epikureer versichern, daß ihre heitere Götterlehre die Menschen vom Aberglauben befreie: aber dies sei auch keine Kunst, wenn man den Göttern jeglichen Einfluß auf den Lauf der Welt abspreche. Insofern sei es unaufrichtig, hier überhaupt noch von überirdischen Wesen zu sprechen. Deren Wirklichkeit sei von Grund aus aufgehoben; übrig bleibe nur noch ein bloßes Wort. Diese Argumentation erinnert ein wenig an Schopenhauers Einwand gegen einen naturalistischen Pantheismus, der Gott mit dem Weltall gleichsetzt; eine derartige Lehre sei nichts als ein rhetorischer Kunstgriff, um Gott „auf eine anständige Weise zu beseitigen”, dessen sich insbesondere Professoren bedienen, die zu feige sind, offen und unverblümt den Atheismus zu verkünden. Nun ergreift Cotta wieder, im dritten Teil von „De natura deorum”, das Wort, um die von Balbus so schwungvoll vorgetragene stoische Kosmotheologie oder Theokosmologie mit ihrem Vorsehungs- und Harmonieglauben vernichtend zu kritisieren.
Cotta ist somit die tragende Gestalt des Gespräches, das übrigens in seiner Wohnung stattfindet. Seine philosophische Position kommt derjenigen Ciceros nahe. Wie dieser, der schweigend zuhört, war auch Cotta Konsul und dann Statthalter einer Provinz gewesen. Gleich Cicero kennt er die Plagen einer politischen Laufbahn einschließlich des Exils. Mit dem um etwa zwanzig Jahre jüngeren Politiker-Philosophen teilt er ferner dessen rhetorische Interessen und skeptische Grundhaltung.
Cicero und Cotta haben sogar ein und denselben Lehrer in Sachen Skeptizismus gehabt: Philon von Larissa in Thessalien, der an der Platonischen Akademie unterrichtet hatte, bevor er im Jahre 88 vor Christus, während des Mithridatischen Krieges, nach Rom flüchtete, wo er als Meister der Philosophie und Rhetorik alsbald hohes Ansehen errang. Von seinen Schriften ist nichts übriggeblieben. Aber wir wissen von Cicero selbst, wie entscheidend er sich von dem Griechen beeinflussen ließ. Wahrscheinlich hat Philon von Larissa den jungen Römer auf die gemeinsam mit dem gleichgestimmten Freund Attikus nach Hellas unternommene Studienreise vorbereitet. In den „Tusculanes” rühmt Cicero Philons erlesenen Stil. Aber auch menschlich wie geistig blieb er dem griechischen Lehrmeister treu. Was wir über ihn als Philosophen wissen, verdanken wir größtenteils Cicero. Obwohl Leiter der Platonischen Akademie, vertrat Philon von Larissa keinen spekulativen Idealismus, sondern eine Haltung „akademischer Skepsis”.
Eine solche Position ist übrigens gar nicht so unplatonisch, wie es auf den ersten Blick scheinen mag; sie trifft allerdings bei weitem nicht den ganzen Platon. Aber in gewisser Weise ist Platon, der Schöpfer der Ideenlehre, durchaus auch ein Skeptiker. Er mißtraut den Sinnen. Den Augenschein hält er für trügerisch. Von den vergänglichen Dingen, so lehrt er, gibt es kein Wissen (episteme), sondern bloß ein Meinen (doxa). Die Welt des Werdens und Vergehens, mit der wir es im Alltag zu tun haben, rangiert in der Mitte zwischen dem unerkennbaren Nichts und dem wahrhaft Seienden, das sich nur dem zu den göttlichen Ideen erotisch aufschwingenden Weisen enthülle. Diese Ideenlehre ist zwar der eigentliche Platonismus, doch immerhin beruht sie auf dem vorgängigen Zweifel, auf einem grundlegenden Skeptizismus gegenüber der Sinneserfahrung.
Philon von Larissa, der Lehrer Cottas wie Ciceros, war also Skeptiker, insofern er behauptete, daß dem Menschen durch die Sinneswahrnehmungen keine absolute Erkenntnis zuteil werden könne. Er vertrat jedoch keinen an der Möglichkeit zu wissen völlig verzweifelnden epistemologischen Nihilismus, sondern eben nur einen maßvollen und im praktischen Lebensalltag tauglichen Skeptizismus. Man könne zwar nicht das ganze Wahre erkennen, immerhin aber das mehr oder minder Wahrscheinliche, das verisimile. Durch sorgfältiges und vorurteilsloses Sammeln, Prüfen und Vergleichen der verschiedenen Lehrmeinungen und selbständige undogmatische Forschung sei es möglich, zum Glaubwürdigen (probabile) zu gelangen. Dies ist jene Haltung, die Cicero gemäß war, von der er sich bereits als junger Mann ansprechen ließ und der er zeitlebens treu blieb: ein von doktrinärer Einseitigkeit und sektiererischem Heilsanspruch freier Standort, der zu kritischem Denken ermuntert und es gestattet, sich im einzelnen den verschiedensten Schulen anzuschließen oder sich zumindest von ihnen im Sinne des Ratschlags anregen zu lassen, daß man alles probieren und das Gute behalten solle. Philons Richtung einer moderaten und nach den unterschiedlichsten Seiten offenen Skepsis feierte Cicero als genus philosophandi minime adrogans, als die am wenigsten anmaßende Art zu philosophieren; sie gewähre uns „eine um so größere Freiheit und Unbefangenheit, weil unsere Urteilsmöglichkeit nicht im geringsten eingeschränkt ist und wir durch keinerlei Notwendigkeit genötigt werden, alles, was uns vorgeschrieben und gleichsam anbefohlen ist, zu verteidigen” (De divinatione II, 1; Academici libri II, 8). Wie Philon von Larissa näherte sich auch Cicero in bestimmten Fragen der stoischen, in andern der platonischen, aristotelischen oder — wie im Bericht über Scipios Traum — der pythagoreischen Philosophie und behielt sich dennoch die Freiheit vor, alle zu kritisieren.
Diese Haltung Philons und Ciceros teilt als dritter im Bunde der am Schluß von „De natura deorum” auftretende Cotta. Er ist gleich Cicero Jurist, Rhetor, hoher Magistrat, musisch aufgeschlossen und in philosophischer Hinsicht ein Vertreter der akademischen Skepsis. Als solcher bemängelt er geistreich und bisweilen äußerst scharfzüngig die Gotteslehren der Epikureer, Stoiker und am Rande auch die theologischen Doktrinen anderer Philosophen. Cotta ist ein urbaner und gebildeter Kopf mit Esprit, ein Weltmann und kultivierter Zweifler, in dem schon eine Prise vorweggenommenen Voltairianertums steckt. Er ist kein apolitischer Schöngeist, sondern ein in Regierung und Verwaltung erprobter Beamter. Er war Prätor, Konsul, prokonsularischer Statthalter in Gallien und tritt übrigens schon in Ciceros Frühwerk „De oratore” als Gesprächsteilnehmer auf.
Doch eines der hohen Ämter, mit denen Caius Aurelius Cotta betraut war, habe ich vorsätzlich noch nicht genannt. Diese Pointe wollte ich mir für den Schluß aufsparen. Der Skeptiker Cotta, der die Götterlehren der Philosophen witzig zerpflückt, war nicht nur ein arrivierter Politiker, sondern auch Pontifex maximus, der Vorsteher der obersten Sakralbehörde, des seit Sulla aus sechzehn Mitgliedern bestehenden collegium pontificum, und damit der ranghöchste Priester des ganzen Römischen Reiches. Später trugen die Kaiser diesen Titel, bis er im Laufe des fünften nachchristlichen Jahrhunderts, als das alte Heidentum untergegangen war, formell auf den Bischof von Rom überging. Seit Leo dem Großen werden bis auf den heutigen Tag die Päpste ehrenhalber wie der heidnische Oberpriester im alten Rom genannt: Pontifex maximus. Cicero war als Augur seit dem Jahre 53 ebenfalls mit einem hohen Priesteramt bekleidet, da die Auguren für die Auspizien zuständig waren, ohne die keine bedeutende Staatshandlung vorgenommen werden durfte. Doch Caius Aurelius Cotta stand noch über den Auguren. Er verkörperte die höchste religiöse Autorität der Römer. Er war der heidnische Papst der Ewigen Stadt. Ihm unterstanden die sechs vestalischen Jungfrauen, die nur er züchtigen oder töten durfte, sofern sie das heilige Feuer im Tempel der Herdgöttin vernachlässigt oder das Gebot strengster Keuschheit gebrochen hatten. Er vertrat als mit Disziplinargewalt über das ganze Kollegium ausgestatteter Sakralchef, der nicht bloß Erster unter Ebenbürtigen, sondern ranghöchster Vorgesetzter war, die Vollzahl der Pontifices gegenüber dem Senat und Volk von Rom. Als Inhaber der höchstpriesterlichen Würde des Reiches hatte er die genaue Beachtung aller rituellen Vorschriften zu überwachen, gegebenenfalls auftretende Streitfragen gottesdienstlicher Art zu entscheiden, einen ordentlichen Totenkult zu gewährleisten, den Kalender und die gebotenen Feiertage festzulegen, bei Eintreffen schlechter Vorzeichen (prodigia) Entsühnungszeremonien vorzunehmen und überhaupt mit heiliger Pedanterie für die Wahrung der überlieferten Formen in Wort, Handgriff und Gebärde bei Opfern, Gebeten, Gelübden und anderen religiösen Akten zu sorgen. Wer einmal Pontifex war, übte sein Amt lebenslänglich aus, gleichgültig welche staatlichen oder militärischen Würden er sonst noch erlangt hatte.
Es liegt auf der Hand, daß das collegium pontificum und insbesondere dessen Vorsteher, der Pontifex maximus, kraft der zahlreichen Aufgaben und Befugnisse nicht nur eine religiöse, sondern auch eine politische Macht darstellte. Grundsätzliche Trennung von Politik und Religion war der gesamten Antike bekanntlich völlig fremd. Sie ist erst ein sehr spätes und bis heute keineswegs allgemein anerkanntes, jedenfalls überaus zerbrechliches und immer wieder von beiden Seiten gefährdetes Ergebnis der europäischen Neuzeit. Die Pontifices waren zugleich Hohepriester und oberste Sachverständige für alle Belange des Kults, eingeschlossen Gräber- und Bestattungswesen, Omina und kalendarische Festsetzung der gebotenen Festtage; sie waren in dieser sakralen Eigenschaft wie durch sonstige politische Ämter zugleich auch Staatsdiener und Träger hoher Würden, die gewöhnlich nur von vornehmen und führenden Persönlichkeiten bekleidet werden konnten. Ein Priesteramt wahrzunehmen galt in römischer Sicht keineswegs als Verzicht auf „weltlichen” Erfolg, sondern als wichtige gesellschaftliche Auszeichnung, die sich mit anderen gut vertrug, oder als günstiger Start für eine politische Karriere. Jeder politisch Ehrgeizige mußte unvermeidlich die Religion als politischen Faktor berücksichtigen. Cicero selbst rechtfertigt diese enge Verbindung von Götterkult und Staatsmacht mit dem Hinweis, daß „auf diese Weise die angesehensten Bürger durch gute Verwaltung des Staates die Religion und durch weise Lenkung der Religion den Staat bewahren” (De domo sua 1). Weil es samt den Auguren, Haruspizes und zwei oder drei anderen Priesterschaften zur Zeit Ciceros nur etwa vierzig angesehene Sakralwürden gab, um die mindestens zehnmal soviele ehrgeizige Politiker rivalisierten, war die Konkurrenz groß und die Wartefrist oft sehr lang. Der Andrang war auch deshalb stark, weil die Priesterämter, anders als die im engeren Sinne politischen, lebenslänglich verliehen wurden. Cicero gelang es erst zehn Jahre nach seinem Konsulat, zum Augur gewählt zu werden. Er war stolz darauf, obwohl er als Skeptiker von der heiligen Kunst der Vorzeichendeutung nicht allzuviel hielt. Doch noch renommierter als das sechzehnköpfige Augurenkollegium waren die sechzehn Pontifices, an deren Spitze der Pontifex maximus stand.
Dies also war Cotta, der uns in Ciceros Dialog über die Götter begegnet und der die dem Autor eigentümliche philosophische Position vertritt: der Hohepriester und oberste Experte in sämtlichen Ritualfragen als Skeptiker, von dem Cicero, der zwischen den philosophischen Fronten eklektisch laviert, am Schluß sagt: „Nach diesen Worten trennten wir uns, und zwar so, daß der Epikureer Velleius den Vortrag Cottas für zutreffend hielt, während mir die Worte des Stoikers Balbus der Wahrscheinlichkeit näher zu kommen schienen.” Aber im Grunde ist Ciceros Haltung, wie bereits mehrfach angedeutet, wesentlich vielschichtiger, umfassender und differenzierter. Er ist Stoiker, Pythagoreer, Peripatetiker und Skeptiker zugleich, überdies aber, wie Cotta, Inhaber eines hohen römischen Priesteramtes. Die Gestalten des Dialogs sind gleichsam Masken Ciceros. Mag er auch vom Epikureismus am wenigsten halten und von der Stoa am meisten angetan sein, so ändern diese Schwergewichte nichts daran, daß ihm keiner der miteinander wetteifernden philosophischen Gedankengänge ganz widersinnig erscheint. An jedem ist etwas daran, jeder enthält zwar nicht die volle Wahrheit, aber immerhin ein Quentchen davon. Einmal neigt er mehr zu dieser, ein andermal eher zu jener Auffassung. In manchen Augenblicken hält er die Götter für schönen Schein, der die hochgemuten Menschen entzückt, aber den Weltlauf nicht im geringsten beeinflußt. Dann wieder begeistert er sich an der zwischen Monotheismus und Pantheismus schwebenden Idee einer göttlichen Weltvernunft, die das All mit weiser Voraussicht lenkt und alles zum besten eingerichtet hat. Es gibt aber auch Stunden, in denen ihm alle religionsphilosophischen oder theologischen Versuche, mit den Göttern ins reine zu kommen, als ebenso viele Schiffbrüche vorkommen. Dann ist er ein Agnostiker, der eine rationale Erkenntnis des Göttlichen für unmöglich hält: Ignoramus et ignorabimus, Wir wissen es nicht und werden es auch nie wissen. Zugleich aber ist er, obwohl die Berechtigung wahrsagerischer Verfahren grundsätzlich bezweifelnd, stolz auf sein Augurenamt, das ihn verpflichtet, vor jeder bedeutenden Staatshandlung, etwa einem Gesetzesbeschluß, einer Kriegserklärung oder der Einberufung des Senats, den Willen der Götter aus dem Verhalten der heiligen Hühner oder Vorzeichen wie Blitz, Donner und Rabenschrei zu erkunden. Er sah keinen Widerspruch darin, stoischer Pantheist und der Volksreligion ergebener Polytheist, die Vernünftigkeit von Auspizien bezweifelnder Skeptiker und loyaler Orakelpriester im Dienste des Staatskults zu sein. Julius Cäsar, sein politischer Feind, dachte in diesem Punkt nicht anders. Ihm gelang das seltene Kunststück, sowohl Augur als auch Pontifex maximus, also Nachfolger Cottas, zu werden. Als Papst der römischen Staatsreligion war er für die offiziellen Totenfeste in höchster Instanz zuständig. Diese kultische Kompetenz hinderte ihn nicht daran, öffentlich zu bekennen, daß „der Tod alle menschlichen Gebrechen beendet und daß es darüber hinaus weder Freude noch Leid gibt” (Sallust: De coniuratione Catilinae 51). Auch von Horaz, der die offiziellen Götter ehrte und dichterisch verherrlichte, gibt es ähnliche Äußerungen, die beweisen, daß er, anders als beispielsweise die Anhänger der Eleusinischen oder Mithräischen Mysterien, von der unerbittlichen Endgültigkeit des Todes überzeugt war: Omnes eodem cogimur … (carmen 2, 3, 25 ff.), wir alle werden in den Orkus getrieben, zusammengetrieben wie eine Herde wehrloser Schafe muß jeder von uns ins ewige Exil des Totenreichs.
Doch Horaz war Privatmann, kein Priester hohen Ranges wie Cotta, Cäsar und Cicero, der uns in „De natura deorum” das wahrhaft olympische Schauspiel eines die Theologie demolierenden Pontifex maximus vor Augen führt, die göttliche Komödie eines aufgeklärten Papstes, der sämtliche Gottesbeweise und Rechtfertigungen Gottes mit dem Witz eines Voltaire und dem Scharfsinn eines Feuerbach genüßlich zerstört und gleichwohl nach vollzogener Götterdämmerung mit hohepriesterlicher Würde die überlieferten Riten zu Ehren des römischen Pantheons vollzieht und unnachsichtig darüber wacht, daß die nonnenhaft lebenden Vestalinnen das ewige Feuer des Altars im Rundtempel der Herdgöttin auf dem Forum nicht ausgehen lassen.
Kein Wunder, daß sich bereits frühchristliche Apologeten entzückt auf Ciceros „De natura deorum” und insbesondere Cottas Ausführungen stürzten, weil sie darin Munition für ihre Polemik gegen den heidnischen Götterkult zu finden wähnten. „Versucht es doch, Cicero eines Irrtums zu überführen!” rief Arnobius triumphierend seinen nichtchristlichen Widersachern zu. Sein Schüler Lactantius, der sich den Ruf eines „christlichen Cicero” erwarb, benützte in seinen „Divinae institutiones”, dem Versuch eines Kompendiums kirchlich fundierter Sittenlehre, den Römer geradezu als von Gott gesandten Wahrheitszeugen für seine Attacken wider das zu Ende gehende antike Heidentum: „Das ganze dritte Buch vom Wesen der Götter zerstört von Grund aus jeden Glauben an die Götter.” Lactantius sagt ausdrücklich: es zerstört omnes religiones. Selbstverständlich meinte er damit nur die von ihm bekämpften vorchristlichen Kulte, nicht das Christentum, das er vielmehr als Fortsetzung des Besten antiker Philosophie ausgab. Der katholische Kirchenvater stützt sich auf den heidnischen Pontifex und Skeptiker Cotta, wie ihn Cicero verewigt hat, um mit dessen Argumenten das Heidentum als völlig unhaltbar und widersinnig zu erweisen. Das ist eine Ironie der Geistesgeschichte. Heute allerdings scheint Lactantius’ ciceronianische Rechtfertigung des Christentums hinfälliger zu sein als Cottas herausfordernde Doppelposition als Kritiker philosophischer Theologie und Hoherpriester des römisch-heidnischen Staatskults.
IV.
Wir fragen uns, wie so etwas möglich sei. Nach beinahe zweitausend Jahren Christentum scheint es fast unvermeidlich, im Zusammenhang mit diesen repräsentativen Beispielen aus dem alten Rom von Heuchelei oder Zynismus zu sprechen. Wie läßt sich dies alles zusammenreimen: ein Oberpriester, der zwar alle Theologien studiert hat, aber keine einzige für richtig hält; ein Hierarch, der die ehrwürdigen Gottesdienste in solenner Weise begeht und himmlische Winke durch Befragung des Vogelflugs sowie anderer Omina einholt, aber gar nicht recht weiß, ob es überhaupt Götter gibt, jedenfalls daran zweifelt, daß sich über die Dinge des Jenseits mit den Mitteln philosophischer Theorie bündig etwas ausmachen läßt? Für ein durch das Christentum geprägtes Bewußtsein ist ein solcher Mensch beinahe notgedrungen ein Monster und eine Religion, deren Kleriker ein solches Doppelleben führen, eine groteske Farce. Ein areligiöser Beobachter der Moderne wird kaum umhinkönnen, hier von perfidem Priestertrug und zynischer Volksverdummung zu sprechen.
Natürlich ist nicht zu bestreiten, daß zahlreiche Übungen der römischen Religion von den Pontifices und Auguren, insbesondere aber von den sich an sie wendenden Politikern, ganz bewußt zwecks Manipulation der Massen oder auch zur Ausschaltung konkurrierender Mitbewerber um hohe Ämter benutzt wurden. Wer das priesterliche Privileg hat, den Kalender laufend zu gestalten, der kann etwa durch Einlegung von Schalttagen oder -monaten die Amtsdauer eines Beamten zu dessen Vorteil oder Nachteil beeinflussen. Cäsar war nur kraft seines Pontifikalamtes in der Lage, neben einigen anderen Reformen auch die des Kalenders durchzusetzen, den sogenannten Julianischen Kalender, dem das reine Sonnenjahr zu Grunde liegt und der in Rußland bis 1918 gültig war. Auch der von dem katholischen Pontifex Papst Gregor XIII. 1582 eingeführte Gregorianische Kalender unterscheidet sich nur unwesentlich von dem Julianischen: bei Cäsar dauert ein Jahr durchschnittlich 365,25 Tage, Gregor XIII. setzte eine normale Jahreslänge von 365, 2425 Tagen fest. Wer für die zwingende Einhaltung der bei Staatsakten vorgeschriebenen Zeremonien zuständig ist, kann beispielsweise einen ihm mißfallenden Gesetzesbeschluß oder Versammlungsaufruf leicht wegen eines winzigen rituellen Formfehlers für ungültig erklären. Wenn ein Blitz genügte, um eine Staatsangelegenheit zu vertagen, weil er als ungünstiges Vorzeichen galt, dann brauchte ein gewitzter Konsul, dem daran lag, irgendetwas zu verzögern, bloß glaubwürdig zu behaupten, er habe am Himmel einen hellen Schein gesehen. Cicero zitiert den Ausspruch des älteren Cato, der sich darüber wunderte, daß ein Haruspex einen seiner Kollegen ansehen könne ohne zu lachen.
Aber damit haben wir die Eigenart altrömischer Religion nur mit aufklärerischer Oberflächlichkeit erfaßt. Sie ist uns durch den Siegeszug der griechischen Mythen, der bereits lange vor Cicero begonnen hat, weitestgehend fremd geworden. Wer durch das humanistische Gymnasium gegangen ist, wird durchwegs meinen, daß sich die römische Religion von der hellenischen im Grunde nur durch die voneinander abweichenden Götternamen unterscheide, daß Vergil, Horaz und Ovid eben statt Zeus Jupiter, statt Artemis Diana, statt Demeter Ceres, statt Aphrodite Venus und statt Poseidon Neptun gesagt haben. Die Gottesvorstellung und der Kult der Römer, so vermuten sogar mit den antiken Autoren einigermaßen vertraute Leser, seien bestenfalls geringfügige Abwandlungen des griechischen Originals. Das trifft aber schon bei den doch stark vom Griechentum geprägten Dichtern nicht völlig zu; und es ist ganz falsch im Hinblick auf die alltägliche, unreflektierte und sozusagen vorliterarische Frömmigkeit der Römer.
Ebenso hindert uns aber auch eine Übertragung von erst im Laufe der Ausbreitung des Christentums und seiner Säkularisierung aufgekommenen Begriffen auf die römische Religion daran, sie in ihrer Wesenheit zu verstehen. Kategorien wie Klerikalismus, Cäsaropapismus, Staatskirchentum oder totalitäre Verquickung von geistlicher und weltlicher Macht helfen da nicht weiter. Sie setzen allemal das Christentum voraus, die letzte überlebende antike Religion, die sich jedoch grundlegend sowohl von der des Olymps als auch der des Kapitols unterscheidet.
Es ist hier, wie sich von selbst versteht, nicht der Platz, die Wesensmerkmale der römischen Religion eingehender zu erörtern. Doch wenigstens einige Punkte seien in fast schon unzulässiger Verknappung festgehalten, weil sie uns Ciceros und Cottas Einstellung ein wenig näherbringen können.
V.
Das Römertum kennt — anders als die Griechen — keine Göttermythen so wie es auch keine kosmogonischen Mythen kennt. Die römischen Götter zeigen sich nicht in jener plastischen Rundheit und sinnfälligen Evidenz wie die homerischen Olympier. Sie haben im Grunde keine Geschichte, sie vollbringen keine Taten und ihnen widerfahren keine Abenteuer.
Das Römertum kennt — anders als die Christen — keine Dogmen, kein Credo, keine verbindlichen Glaubensbekenntnisse, keine Lutherschen Thesen, keine Confessio Augustana, keinen Syllabus und keinen Antimodernisteneid. Es kennt, genau betrachtet, keine Orthodoxie, keine rechte und angeblich alleinseligmachende Lehre, und deshalb auch keine Ketzerprozesse, keine Inquisition und keinen theologischen Fanatismus.
Das Römertum kennt — anders als die Moderne — keine vom profanen Alltag und den Erfordernissen potenter Staatlichkeit abgetrennte oder ihnen gar zuwiderlaufende Religion. Religion ist kein Reservat schwärmerischer Gefühle, kein Asyl mystischer Erleuchtungen, keine exterritoriale Enklave gewissensbedingter geheimer Vorbehalte gegenüber dem, was weltlich nottut.
Das Römertum kennt — wieder im Unterschied zum Christentum, als dieses noch mächtig war — keinen Glaubenszwang, keinen Begriff vergleichbar dem der „Gedankensünde” und keine Unduldsamkeit gegenüber Meinungen über transzendente Dinge. Römische Religiosität ist — anders als die in mancherlei rivalisierende Schulen zersplitterte griechische Philosophie — grundsätzlich tolerant, liberal und unfanatisch.