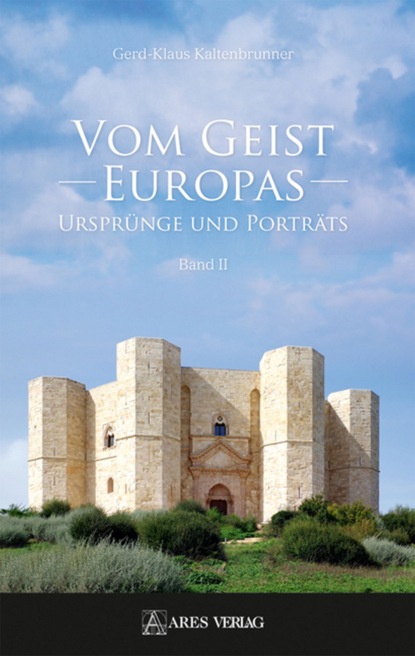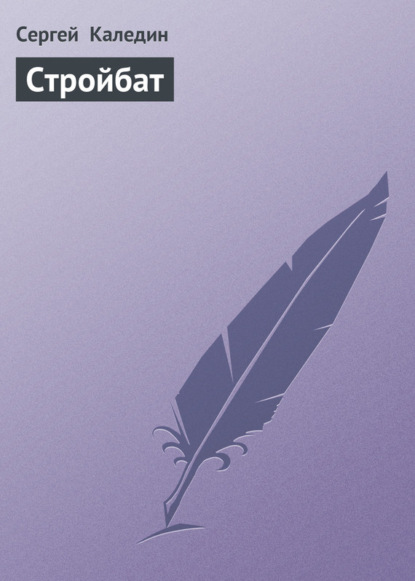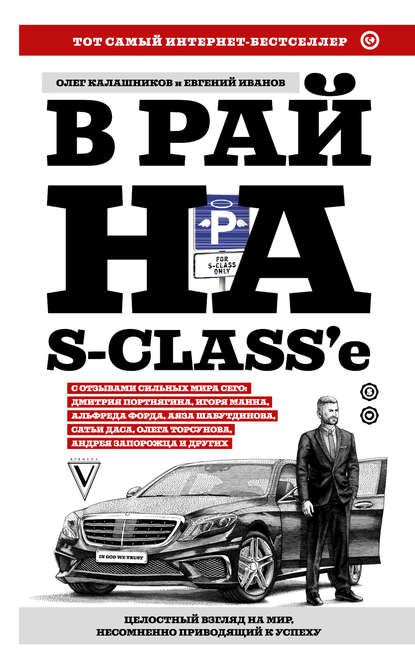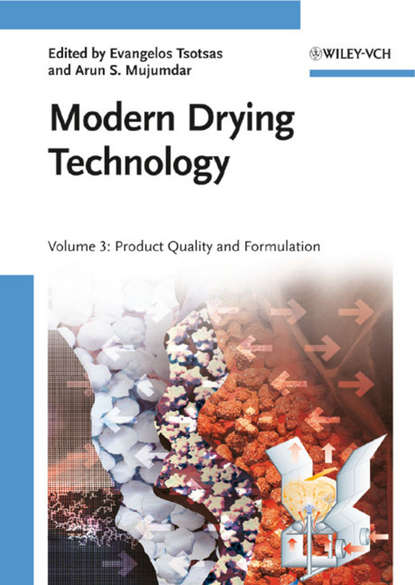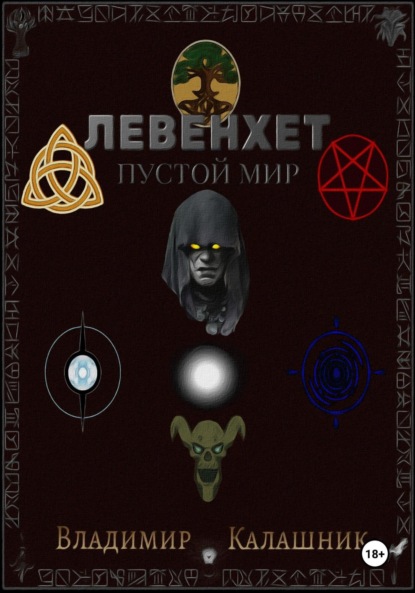- -
- 100%
- +
Das Römertum kann hinsichtlich noch so abweichender Lehrmeinungen und philosophischer Theorien großzügig sein, weil seine Religion wesentlich keine Lehre, sondern ein Tun ist: keine Orthodoxie, sondern eine Orthopraxis. Römische Religion enthält sich, von einigen Rudimenten abgesehen, aller Aussagen über Weltschöpfung, Erlösung, Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung von den Toten. Weil sie keine Dogmen kennt, reizt sie auch nicht zu intellektuellem Widerspruch, Sektierertum oder „Entmythologisierung”. Sie kennt deshalb keine Häretiker und Märtyrer, die wegen abweichender theoretischer Überzeugungen von den Priestern des Staatskultes verfolgt werden. Erst das Judentum, vor allem aber das Christentum mit seinem absoluten Ausschließlichkeitsanspruch veränderte die Situation.
Das Römertum kennt — abermals im Gegensatz zum Christentum — keine Trennung zwischen „geistlicher” und „weltlicher”, zwischen „kirchlicher” und „politischer” Gewalt. Es kennt deshalb keinen „Klerikalismus”, keine Priesterherrschaft. Die römischen Priester bilden keine eigene Kaste. Sie sind kein Staat im Staate, keine Agentur einer ausländischen Macht, keine Fünfte Kolonne, die im Ernstfall die staatsbürgerliche Treuepflicht zugunsten der Loyalität gegenüber einem anderen Souverän verweigern könnte, sei dieser Souverän nun ein Prophet, Guru oder auch das eigene unüberprüfbare Gewissen. Die Priester Roms sind grundsätzlich Beamte gleich den Konsuln und anderen Magistraten. Sie genießen zwar einige Privilegien, übernehmen dafür aber etliche schwerwiegende Pflichten.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die mit drakonischen Strafandrohungen abgestützte Verpflichtung der Vestalinnen zu dreißigjähriger klösterlicher Keuschheit. Desgleichen erwähne ich die vielen Tabuvorschriften, denen die Priester mancher Einzelgötter unterworfen waren. Insbesondere der Flamen Dialis, der sich dem Jupiterkult zu widmen hatte und dem Pontifikalkollegium angehörte, war in seinem alltäglichen Leben von derart strengen Sakralgeboten eingeschränkt, daß sein Posten trotz aller Ehrenvorrechte einmal fünfundsiebzig Jahre frei blieb, weil sich niemand um eine derart beschwerliche Stelle bewerben wollte. Die Priester waren hohe Beamte im Staate, ihnen unterstand die Administration der kultischen Belange, die bürokratische Erfassung und Verwaltung des Götterwesens. Aber die höchste Verantwortung für die Wahrung der pax deorum, den ordnungsgemäßen Frieden mit den Göttern, lag nicht bei den Priestern, sondern bei den gewählten Beamten und Hoheitsträgern des römischen Volkes. Die Priester fungierten weniger als selbsternannte Mittler zwischen Gott und Mensch, Diesseits und Jenseits, Offenbarung und irdischem Gesetz; sie waren Kultsachverständige, Experten für religiöse Altertümer und Fachmänner für Zeremonien, Riten und ehrwürdige Bräuche, die die Konsuln und andern Inhaber staatlicher Gewalt zu beraten hatten. Die Priester sind nicht bevollmächtigt, nach eigenem Ermessen die Götter anzurufen. Zwar muß jeder wichtige Staatsakt durch Einholung eines Auspiziums vorbereitet werden, aber der Konsul ist an die priesterliche Auslegung des Vorzeichens nicht gebunden. Den Auguren stand somit nur die Rolle hoher Berater, nicht aber die einer dem Staate gegenüberstehenden Gewalt zu. Sie hatten auch nicht die Zukunft vorherzusagen, sondern bloß anhand bestimmter Zeichen die ihnen von den Beamten vorgelegte Frage zu beantworten, ob die Götter ein bestimmtes Unternehmen billigen.
VI.
Aus dem Gesagten geht wohl genugsam hervor, was römische Religion nicht ist und wie abgrundtief sie sich von der christlichen unterscheidet. Sie hat mit dem altchinesischen Konfuzianismus und dem japanischen Schintoismus mehr gemeinsam als mit dem alten oder gar neueren Christentum.
Wie läßt sich die Religion der Römer positiv bestimmen? Hören wir Cicero, den Skeptiker und Augur (De haruspicum responsis 9, 19):
„Wir mögen noch so vernarrt sein in uns selbst, Senatoren, wir müssen doch zugeben, daß wir Römer weder an Zahl die Spanier noch an Kraft die Gallier noch an Verschlagenheit die Punier noch an Geschicklichkeit die Griechen noch endlich an vaterländischem Geist für dieses Land die Italiker und Latiner übertreffen; aber durch Frömmigkeit (pietate ac religione) und durch weise Einsicht, daß durch der Götter Walten alles ausgerichtet und geleistet wird, haben wir alle Völker und Stämme übertroffen und überwunden.”
Kraft ihrer Religion, so der theologische Agnostiker Cicero, haben die Römer ihnen in vieler Hinsicht überlegene Völker überwältigt und besiegt. Religion ist für ihn etwas durchaus Praktisches. Ähnlich wie Cicero hatte auch sein gelehrter Zeitgenosse Varro betont, „daß die Römer dank ihrer besonders sorgfältigen religiositas so hoch erhoben worden sind, daß sie den Erdkreis beherrschen”:„Diese Gottesfurcht hat den Römern ihr Reich gegeben, gemehrt, begründet, da ihre Stärke nicht so sehr in ihrer Tüchtigkeit (virtus) denn in ihrer Frömmigkeit (religio et pietas) bestanden hat.”
Diese römischen Selbstzeugnisse sind von Gewicht. Sie bestätigen, was auch andere Dokumente aussagen: etwa Sallust (De coniuratione Catilinae 12,3), der die Römer reliogissimi mortales nennt, „die frömmsten aller Menschen”, oder ein Brief des Senats an die kleinasiatische Griechenstadt Teos, der sich inschriftlich erhalten hat (Dittenberger: Sylloge inscriptionum graecarum II3, 1917, Nr. 601, 13 ff.): „Daß wir überhaupt und immer auf die Frömmigkeit gegenüber den Göttern stärkstes Gewicht legen …”
Diese erzrömische Frömmigkeit gleicht nicht im geringsten den intimen Herzensergießungen gläubig verzückter Betschwestern. Sie unterscheidet sich grundlegend von aller pietistischen, romantischen oder sentimentalen Religiosität. Jeglicher mystischer Zug fehlt ihr. Ebensowenig bedeutet sie die mit einem sacrificium intellectus verbundene Annahme irgendwelcher Dogmen im Sinne des Credo, quia absurdum. Sie erheischt keine Unterwerfung unter die Autorität eines geoffenbarten Gottesworts, das in inspirierten heiligen Büchern niedergelegt ist. Sie verlangt nicht, daß gewisse Behauptungen über die Erschaffung der Welt oder die Schicksale der Götter und ihrer Sendboten für unbedingt wahr gehalten werden. Sie entbehrt sogar einer bloß embryonalen kanonischen Theologie. Sie stützt sich weder auf eine in kirchlichen Diensten stehende Scholastik noch auf einen volkstümlichen Katechismus.
Aber was ist dies für eine seltsame Religion, die kaum ein einziges Merkmal dessen aufweist, was wir üblicherweise zum unabdingbaren religiösen Bestand rechnen?
Wieder lohnt es sich, auf Cicero zu hören. Er verwendet immer wieder das Wort religio, das dann aus dem Lateinischen in so viele spätere Sprachen eingegangen ist. Was bedeutet aber religio im ursprünglich römischen Sinn? Religio hat, wie bereits gesagt, wenig mit Gefühl, Schwärmerei oder „Glauben” zu tun. Cicero leitet es (De natura deorum II, 72) von dem Wort re-legere ab. Man kann es auf deutsch verschiedentlich wiedergeben, zum Beispiel mit wiederlesen, wieder durchgehen, überdenken, erwägen. Walter F. Otto (Religio und Superstitio, 1909) hält Ciceros etymologische Herleitung für richtig. Er hat gezeigt, daß relegere mit dem Stamm leg-(der sich auch in dem Wort legere findet: sammeln, lesen) ursprünglich die Bedeutung „sorgfältig beachten” gehabt haben muß. Namhafte Gelehrte sind Walter F. Otto und dadurch auch Cicero gefolgt. Re-legere ist das Gegenteil von neg-legere, das „vernachlässigen”, „sich nicht kümmern”, „übersehen” bedeutet. Religio ist somit das sorgfältige, gewissenhafte und nichts vernachlässigende oder übersehende Beachten, Erwägen und Bedenken. Was aber soll vom religiösen Menschen nach altrömischer Auffassung sorgfältig beachtet werden? Daß es dabei nicht um Dogmen und Theorien geht, habe ich schon gesagt. Lauschen wir Cicero, wenn wir erfahren wollen, was den homo religiosus eines Volkes auszeichnet, das durch pietate ac religione alle andern überwunden hat! Ich zitiere wörtlich die bereits oben flüchtig erwähnte Stelle aus dem zweiten Buch der „Natura deorum”:
… qui autem omna, quae ad cultum deorum pertinerent, diligenter retractarent et tamquam relegerent, sunt dicti religiosi ex relegendo …
„… diejenigen aber, die alles, was mit dem Kult der Götter zu tun hatte, mit Sorgfalt ausübten und gleichsam immer wieder erwogen (relegerent), wurden von diesem Worte (ex relegendo) als religiosi bezeichnet …”
Religion ist für den Römer eine Haltung der Achtsamkeit, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit gegenüber allem, was mit dem Götterkult zusammenhängt. Sie ist weder Glaube noch Ekstase, sondern die gewissenhafte, treue und genaue, auch den Vorwurf formalistischer Pedanterie nicht im geringsten scheuende, ihn vielmehr als hohes Lob auffassende Beobachtung der überlieferten Riten. Religion nach römischer Art ist Hingabe an die ehrwürdigen, feststehenden und peinlich einzuhaltenden Vollzugsformen der Götterverehrung. Sie hat mit Leidenschaft im affektiven Sinn wenig zu tun. Man kann sie eher als ausgeprägte Vorliebe für alteingebürgerte Umgangsformen mit der außermenschlichen Wirklichkeit charakterisieren. Sie ist sozusagen eine trocken-nüchterne Passion für Etikette in allen göttlichen Belangen, seien es Worte, Gebärden oder Handlungen, Gebete, Zeremonien oder Opfer, Beschwörungen, Auspizien oder Entsühnungen. Denken kann man von den Göttern, was einem beliebt. Es ist nicht einmal entscheidend, ob man an ihre Realität „glaubt”. Nichtig ist geradezu das Unterfangen, sie argumentativ „beweisen” zu wollen. Epikureer, Stoiker, Platoniker und Aristoteliker mögen alle auf ihre Fasson selig werden. Kein Pontifex maximus hindert sie daran. Sie können die Götter deuten, wie ihnen beliebt. Sie dürfen ihr Vorhandensein bezweifeln oder für unbeweisbar halten. Götter und Priester Roms kümmern sich nicht darum, ob und wie über die Götter spekuliert oder meditiert wird. Entscheidend ist einzig der korrekte Vollzug der altehrwürdigen Riten und die unveränderte Weitergabe der von den Vorfahren aus grauer Frühzeit übernommenen Kultformen an die Nachwelt. Die Philosophen haben die Götter nur verschieden interpretiert; es kommt darauf an, festgelegte gottesdienstliche Bräuche zu bewahren. In theologischen Fragen ist Laxismus gestattet; aber in rituellen Angelegenheiten wird jede Schlamperei bestraft. Theologen und Religionsphilosophen sind nur imstande, mehr oder minder geistreiche Theorien über die Götter vorzulegen. Aber nur Götter und von ihnen bevorzugte seltene Menschen, die deshalb schon Halbgötter sind, vermögen tradierfähige und durch Jahrtausende getreulich gepflegte Riten einzusetzen.
Numa Pompilius, der sagenhafte zweite römische König, wie ihn Cicero (De re publica, II, 23-30), Livius (I, 18-21) und Plutarch so eindrucksvoll schildern, war ein solcher Halbgott. Auf ihn gehen die meisten Priestertümer, Feste und Kulte zurück. Kein Intellektueller wäre fähig, derlei zu vollbringen. Deshalb gilt das unerbittliche Gesetz: Die theologische Diskussion ist frei; die Liturgie ist sakrosankt. Philosophie ist permanente Revolution; Kult ist permanente Tradition. Wer einen Ritus eigenmächtig ändert, der begeht einen unsühnbaren Frevel, ja einen Gottesmord. Wer einen Gott bezweifelt oder ihm theoretisch etwas am Zeuge flickt, mag das ungeniert tun. Es ist im Grunde nur ein kindliches Spiel zum Ruhme der Götter.
Dies war die ingeniöse römische Lösung des religiösen Problems. Deshalb die herzergreifende Duldsamkeit und Liberalität der doch sehr unsentimentalen und hartgesottenen Römer in allen Glaubensfragen. Deshalb die Beibehaltung magischer Formeln und Begehungen archaischen Ursprungs auch noch in einer vom Geist des Rationalismus durchwehten Spätzeit. Deshalb konnte ein leichtfüßiger Spötter wie Ovid den römischen Kalender in seinen „Fasti” mit ironischer Distanz und bisweilen derber Komik kommentieren. Deshalb konnte ein durch die Schule akademischer Skepsis gegangener Agnostiker wie Cotta, dem zweifellos der Sinn mancher von ihm ehrerbietig vollzogener Riten abhanden gekommen war, das Amt eines Pontifex maximus loyal und ohne Heuchelei ausüben. Deshalb konnte er alle Gottesbeweise beiseite schieben und die religionsphilosophischen Doktrinen mit einer hinreißenden Geistesschärfe kritisieren, die keinen Stein auf dem andern unverändert ließ, und dennoch stolz bekennen: „Ich werde die Opfer, Riten und religiösen Bräuche immer verteidigen und habe sie immer verteidigt, und von der Vorstellung, die ich von den Vorfahren über den Kult der unsterblichen Götter übernommen habe, wird mich weder ein Fachmann noch ein Laie jemals mit seinem Gerede abbringen. Wenn es sich um Fragen der Religion handelt, dann folge ich einem Pontifex maximus wie Tiberius Coruncanius, Publius Scipio und Publius Scaevola, nicht aber einem Zenon, Kleanthes oder Chrysippos, und halte mich an den weisen Augur Caius Laelius, den ich lieber hören will als irgendeinen führenden Vertreter der Stoiker … Ich habe keinen der heiligen Bräuche jemals für verächtlich gehalten und bin der Überzeugung, daß Romulus mit der Einführung der Auspizien und Numa mit der der Opfer die Grundlagen unseres Staates (fundamenta nostrae civitatis) gelegt haben, der sich bestimmt niemals zu einer solchen Größe hätte erheben können, wenn die unsterblichen Götter nicht in höchstem Maße mit uns versöhnt wären”, — versöhnt, besänftigt und geneigt durch die gewissenhafte Beobachtung der überlieferten Kulte und Bräuche. Forschung und Lehre sind auch in theologischen Fragen frei; aber der kleinste rituelle Fauxpas wird als blasphemischer Verstoß gegen göttliche Einrichtungen und die staatsbürgerlich notwendige pax deorum unnachsichtig geahndet.
Cicero sagt damit durch den Mund des Pontifex Cotta noch einmal, was er schon an anderen Stellen eindrucksvoll festgestellt hat: Mit solcher Religiosität, die so wenig „erbaulich” und herzerhebend ist, haben die Römer ein Weltreich geschaffen. Es lohnt sich, im Sinne einer weltgeschichtlichen Betrachtung von der Art Jacob Burckhardts, über den Einfluß der eigenartigen römischen Auffassung von Religion sowohl auf die binnenstaatliche Zivilisierung als auch auf den imperialen Aufstieg des Römervolkes nachzudenken.
Ciceros Werke sind dabei ein unentbehrlicher Leitfaden. Außerdem sind sie eine fesselnde und immer wieder auch vergnügliche Lektüre.
VII.
Cicero ist recht eigentlich der Stammvater, Lieblingsheilige und Schutzpatron aller europäischen Humanisten. Er ist der erste große Humanist in des Wortes doppelter Bedeutung. Cicero hat uns beispielhaft vorgelebt, was Freude an griechischer Bildung bedeutet. Und er hat uns nicht nur das Wort humanitas hinterlassen, sondern auch die Gestalt des im weiteren Sinne humanen, humanisierten und humanistischen Menschen eingeprägt: den homo humanus. Er gleicht weit mehr dem kultivierten Gentleman als dem sich selbst verleugnenden Heiligen. Er hat das Grobe, Plumpe und Dumpfe angeborener Roheit nach Möglichkeit überwunden, ohne deshalb das Maß des Irdischen überschreiten zu wollen. Er hat seine Anlagen zu Güte, Nachsicht und Milde zum Erblühen gebracht, ohne deshalb die Fähigkeit zu entschiedener Härte verloren zu haben. Er ist großmütig, hat Geschmack an schönen Dingen und Sinn für überlegene Ironie wie für lächelnde Weisheit. Er ist überlieferungsfrommer Skeptiker, weil er die Erkenntnismöglichkeiten des Menschen nicht überschätzt. Er ist nicht rechthaberisch, starrköpfig und rücksichtslos, aber auch kein schwächlicher Waschlappen. Gelassenheit, ja sogar ein Hauch von schwermütiger Resignation sind gestattet, nicht aber weinerliche Weichlichkeit. Extreme sind ihm fremd. Auf manche Fragen gibt er bisweilen mehrere Antworten. Zumindest weiß er, daß mehr als eine möglich ist, wenngleich er aus Klugheit manche verschweigt. Er schätzt in maßvoller Weise die Wonnen der Welt, aber er behält die Götter im Blick. Er verliert sie sogar dann nicht aus dem Auge, wenn ihre Sternbilder hinter dämmernden Wolken des Zweifels geschwunden sind.
Ein solcher Mensch war Cicero. Ein Gentleman-Philosoph. Ein Humanist. Der Genius und Augur aller späteren Humanisten. Ein Mann für alle Jahreszeiten. Bereits Augustus, der doch Ciceros Ermordung nicht verhindern konnte oder wollte, vermochte sich seinem Zauber nicht zu entziehen. Plutarch berichtet darüber folgende Anekdote:
„Wie ich erfahren habe, kam Cäsar Augustus viele Jahre später einmal zu einem seiner Enkel ins Zimmer. Dieser hatte gerade eine Schrift Ciceros in der Hand und versteckte sie erschrocken in der Toga. Augustus bemerkte dies, ließ sich das Buch geben und las im Stehen lange Zeit darin. Dann gab er es dem jungen Mann zurück und sagte: ‚Er war ein Meister des Wortes, mein Kind, ein Meister des Wortes und ein wahrer Freund seines Vaterlandes’.”
Die Männer, die ihn später geschätzt und geliebt haben, zählen zu den sympathischsten Gestalten des Abendlandes. Ich nenne einige aufs Geratewohl: Plinius der Ältere, Quintilian und Boëthius, dann Petrarca, Boccaccio, Erasmus von Rotterdam, Montaigne, Hume, Voltaire, Wieland und den Fürsten de Ligne. Erasmus bekannte: „Der heiligen Schrift kommt zwar der erste Platz zu, dennoch finde ich des öfteren bei den alten Heiden, ja sogar bei den Dichtern Gedanken, die so rein, so heilig, so göttlich gesagt oder geschrieben sind, daß ich mir die Überzeugung nicht versagen kann, eine Art göttlicher Kraft habe sie inspiriert.” Das erinnert fast wörtlich an die im vorgehenden zitierte Stelle in Ciceros „De natura deorum”: „Es hat also niemals einen bedeutenden Mann ohne Anhauch eines göttlichen Geistes gegeben.” Erasmus fährt fort: „So gibt es viele Heilige, die nicht in unserem Kalender stehen. Ich will hier vor meinen Freunden meine Neigung nicht verhehlen: Ich kann die Bücher Ciceros über das Alter, über die Freundschaft, über die Pflichten und die Tuskulanischen Gespräche nicht lesen, ohne von Zeit zu Zeit das Buch zu küssen und mich zu verneigen vor seinem heiligen, ganz von göttlichem Odem erfüllten Herzen.” Voltaire trat einem Angriff auf Cicero mit den Worten entgegen, „daß seine ‚Tusculanen’ und ‚De natura deorum’ die beiden schönsten Werke sind, welche die menschliche Weisheit jemals verfaßt hat; daß sein Traktat ‚De officiis’ das nützlichste Handbuch der Moral ist, das wir besitzen.” Wieland begann in hohem Alter sämtliche Briefe Ciceros ins Deutsche zu übersetzen, um sich aus der „fürchterlich einengenden Gegenwart” der Napoleonischen Kriege in eine sowohl angenehme als auch nützliche Arbeit zu flüchten, die ihm nach Vollendung das Recht gebe zu hoffen, „die letzten Jahre oder Tage meines Lebens nicht ohne alles Verdienst um meine geliebten Sprachgenossen zugebracht zu haben.” Der Fürst Charles Joseph de Ligne bekannte: „O Cicero, ich liebe dich weit mehr dort, wo du mich lehrst, der Welt zu entsagen, mir selbst zu genügen, als wo du eifernd redend gegen Größere auftrittst. Catilina war ein Verbrecher, aber er hätte ein Held sein können. Aber wie viel verdanke ich dir doch, o Cicero! Du stehst mir bei in meiner Liebe zur Literatur, die der Trost meiner alten Tage, Gefährte meiner Arbeiten und an meinem Zufluchtsort meine Gesellschaft sein wird.” Als der italienische Jesuit, Handschriftenexperte, Präfekt der päpstlichen Bibliothek und spätere Kardinal Angelo Mai um 1820 große Teile des bis dahin verschollenen Werks „De re publica” aufgefunden hatte, widmete ihm der Dichter Giacomo Leopardi die hymnischen Verse (Übersetzung von Hanno Helbling):
… Welch ein Auferstehen!
Mit einem Mal erschlossen sich aufs neue
die alten Blätter; so hat uns nun lang
die Klosterheimlichkeit
den Schutz für Großes, Heiliges versehen:
für unsrer Ahnen Wort. Ob solche Treue
das Schicksal dir verlieh, erlauchter Mann?
Ob dir das Schicksal sie nicht nehmen kann?
Gewiß, nicht ohne hohen Rat der Götter
geschieht es, daß zur Stunde
der tiefsten, heillosen Vergessenheit
der Bann gebrochen wird durch neue Kunde
von unsern Vätern. Siehe, noch verzeiht
der Himmel uns, und immer noch umsorgen
die Genien das Land…
… Du, im Entdecken Meister
fahr fort; die Toten wecke,
da die Lebendigen schlummern, und das leise,
vergangne Raunen mach zum Heldenchor,
daß endlich diese träge Zeit sich rühre,
zur Tat sich rüste — oder Scham verspüre.
(1988)
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.