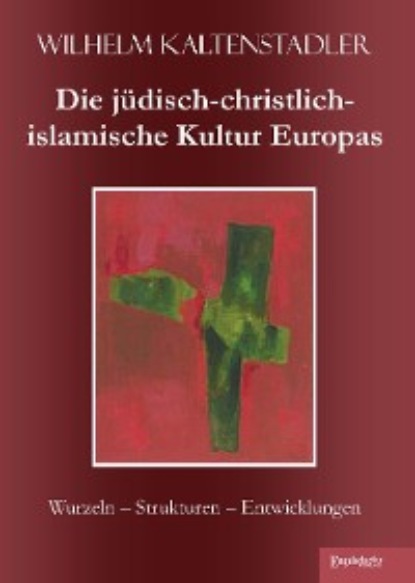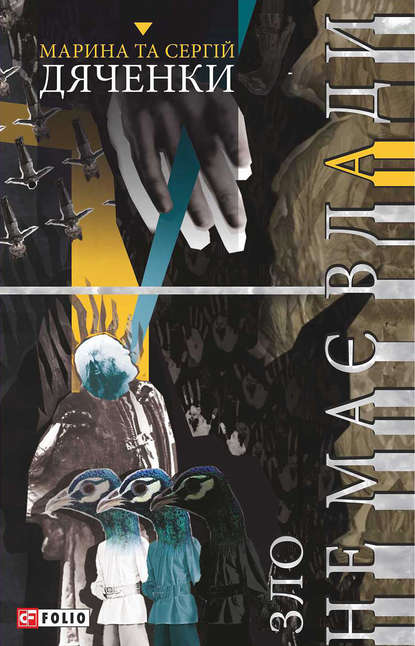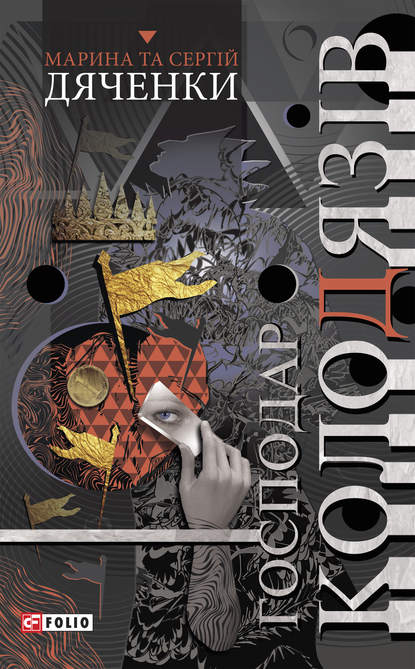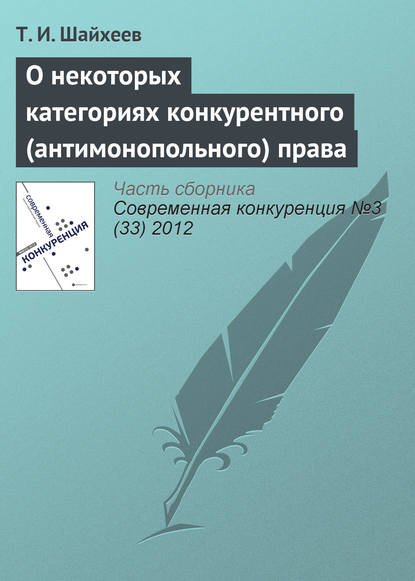Mit dem Titel »Die jüdisch-christlich-islamische Kultur Europas. Wurzeln – Strukturen – Entwicklungen« bringt der Verfasser verschiedene Perspektiven der europäischen Kultur zum Ausdruck. Diese war in der Antike und sogar im Mittelalter nicht national oder gar nationalistisch, sondern global. Die universelle Kultur des Römischen Reiches formte und prägte über die christliche Religion und das Papsttum das Mittelalter. Latein wurde im Westen des einstigen Römischen Reiches zur universalen Sprache der Geistlichkeit, der Klöster, der Verwaltung, der Schulen, der Universitäten etc. Diese totale Präsenz des Lateinischen wirkte weit in die sog. Neuzeit hinein. Latein als Hauptsprache der Antike und des Mittelalters hat sich in den katholischen Regionen (Kapitel »Die römisch-katholische Kultur und Europa«) des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation wesentlich länger gehalten als in anderen europäischen Staaten. Es gab also damals etwas, was wir im Grunde heutzutage immer noch nicht voll realisiert haben, eine gemeinsame Bildungs- und Kultursprache, nämlich Latein, das Englisch des Mittelalters (Kapitel »Die Idee der Bildung«). Luthertum, Kalvinismus etc. fangen schon im 16. Jahrhundert an, die lateinische Universalsprache immer mehr durch die sog. Nationalsprachen zu ersetzen und auf das supranationale Denken zu verzichten. Selbst die aschkenasischen Juden machen im christlichen Europa Taitsch (Jiddisch) immer mehr zu ihrer Hauptsprache. Die wissenschaftliche Bildung des Mittelalters baute auf dem Kanon der septem artes liberales, der sieben freien Künste bzw. Fachbereiche auf, welche bereits auf die Antike zurückgehen. Die Juden waren allerdings im christlichen Europa so gut wie nicht an den christlichen Universitäten zugelassen. Die christlichen Hochschulen waren nicht so tolerant wie die islamischen in Iberien. Die unterentwickelte Toleranz vor allem des christlichen Europas war die große Achillesferse des christlich-europäischen Systems. Die sephardischen Juden des Westens pflegten bis weit ins Mittelalter hinein Griechisch als ihre Kultursprache, Altkastilisch (Ladino, Judezmo) als ihre Umgangssprache. Auch die Muslime in Iberien und auf dem Balkan waren mehr mit Griechisch vertraut als die westlichen Christen. Der Autor macht deutlich, dass die griechische Kultur im christlichen Europa des Westens für längere Zeit vergessen bzw. nicht für so wichtig gehalten wurde. Es war vor allem den Trägern der muslimischen Kultur zu verdanken, den »Arabern«, dass griechische Sprache und Kultur dem christlichen Europa wieder geschenkt wurde und dazu beitrug, neue Wissenschaften wie z.B. Naturwissenschaften und die Medizin (Hippokrates, Galenos) zu begründen bzw. zu neuen Höhen zu führen. Es haben also auch der Islam und das stark vom Islam geprägte sephardische Judentum vom Süden Europas aus (Iberien, Süditalien, Balkan) in das christliche Europa hineingewirkt (Kapitel »Wie islamisch ist die europäische Zivilisation?«). Der Autor beschränkt sich nicht auf Antike und Mittelalter, sondern setzt sich auch kritisch mit wichtigen Themen der Neuzeit auseinander (Kapitel »Die Aufklärung – Theorie und Praxis«, die »Säkularisation und die Klöster«, »Das Copyright an der Moderne«). Die Klöster werden nicht nur als religiöse Einrichtungen, sondern auch als wichtige Träger von Bildung, Kultur und Wirtschaft (Arbeitgeber) geschildert. Im Schlusskapitel »Ein kritischer Ausblick« kommt der Autor zu dem Ergebnis, dass es vor allem die Juden waren, die wahrhaft europäisch dachten und handelten. Es gab nur wenige Christen, welche in Mittelalter und Neuzeit so viele Sprachen beherrsch(t)en und mit den Kulturen der europäischen Nationen so vertraut waren wie die europäischen Juden.
- Книги
- Аудиокниги
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация