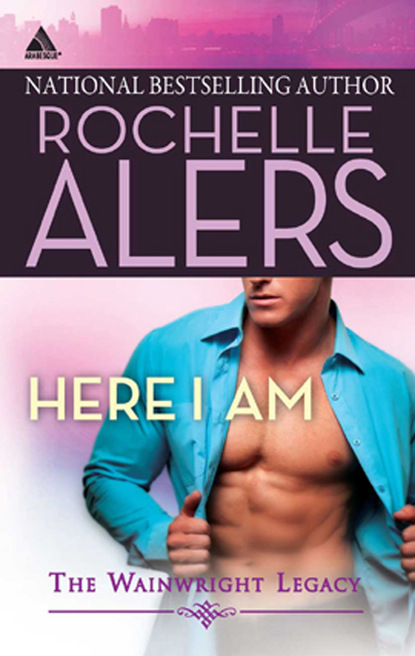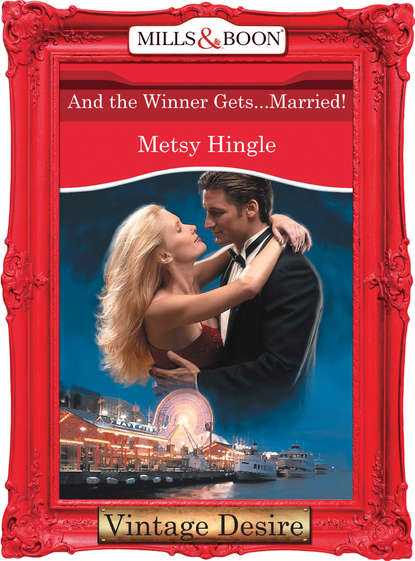- -
- 100%
- +
Sein ursprünglicher Name lautete Wa-Tho-Huk, was seiner Herkunft als Angehörigem des Stammes der Sac and Fox entsprang. Allerdings war er der Spross eines wirren Stammbaums, in dem nicht nur einige namhafte Häuptlinge vertreten waren, sondern väterlicherseits auch noch irische und mütterlicherseits französische Verzweigungen.
Da es keine Geburtsurkunde gab, kursierten später widersprüchliche Angaben darüber, an welchem Tag er eigentlich auf die Welt gekommen war. Am 22. Mai 1887, wie es in der Taufbescheinigung steht, die die katholische Kirche Sacred Heart in Konawa Ende desselben Jahres ausstellte? Oder im Mai ein Jahr danach, wie er selbst sechzig Jahre später gegenüber der Lokalzeitung in seiner Heimat verriet? Nur soviel war und blieb unumstritten: sein bürgerlicher Name – Jacobus Franciscus Thorpe.
Der junge Thorpe, bald nur noch Jim genannt, war so etwas wie ein sportliches Wunderkind. Er demonstrierte schon früh besondere grobmotorische sportliche Fähigkeiten, war allerdings am normalen Schulunterricht nicht besonders interessiert und fand erst, als ihn im fernen Pennsylvania die Carlisle Indian Industrial School rekrutierte, eine Bildungseinrichtung, die ihm behagte. Das Internat mit dem pädagogischen Leitbild, junge amerikanische Ureinwohner in die angelsächsische Gesellschaft zu assimilieren, investierte in ihn und seine Altersgenossen damals eine streng-militärisch ausgerichtete Ausbildung, mit dem Ziel einer kompletten kulturellen Umerziehung.
Ihr Motto: „Kill the Indian, save the man“.
Bring den Indianer um, rette den Menschen.
Er war sechzehn, als er an der Ostküste eintraf und sogleich nicht nur zum Star-Leichtathleten, sondern auch zu einem Leistungsträger der Football-Mannschaft wurde, betreut von niemand anderem als dem legendären Trainer Glen Warner, genannt Pop.
Seine Qualitäten sprachen sich rasch herum. Denn er und seine Mitstreiter bezwangen 1911 nicht nur die höher eingestufte Auswahl der Universität Harvard, sondern auch das Team der Kadetten der Militärakademie in West Point, in dem der spätere Oberbefehlshaber der alliierten Truppen im Zweiten Weltkrieg und US-Präsident Dwight D. Eisenhower spielte. Die Begegnung prägte sich zwar nicht in Thorpes Gedächtnis ein, aber in Eisenhowers: Thorpe habe „nie in seinem Leben“ ernsthaft trainiert, mutmaßte der Offiziersschüler. Trotzdem spiele der dieses uramerikanische Spiel „besser als irgendein anderer Footballspieler, den ich jemals gesehen habe“.
Doch diese scheinbar geradlinige Geschichte produzierte wenig später eine tragische Wendung. Nachdem Thorpe 1912 bei den Olympischen Spielen in Stockholm zwei Goldmedaillen gewann – bei den zwei Mehrkampfwettbewerben der Leichtathletik, die es damals gab: den Fünfkampf und den Zehnkampf – und nach der Rückkehr in New York mit einer Konfettiparade begrüßt wurde, wurde er das Opfer des feudalen Zeitgeists im organisierten Sport. Der Mann, den der schwedische König Gustav V. bei der Siegerehrung mit den Worten beglückwünscht hatte, „Sir, Sie sind der großartigste Athlet der Welt“, wurde die Zielscheibe von Rassismus, Klassenarroganz und purem Neid. Beide Medaillen wurden ihm aberkannt, weil Thorpe 1909 und 1910 in einer unteren Liga in North Carolina professionell Baseball gespielt und dafür 60 Dollar pro Monat kassiert hatte. Es handelte sich um einen Verstoß gegen die damaligen Amateurregeln. Seine Verteidigung – „Ich war ein einfacher Indianerjunge und hatte keine Ahnung von diesen Dingen“ – stieß auf taube Ohren.
Erst 1982, als sein Landsmann Avery Brundage endlich in Pension war, den er bei beiden Wettbewerben in Stockholm deutlich geschlagen hatte und der sich während seiner Amtszeit als amerikanischer NOK-Chef und als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees ausdrücklich gegen eine Rücknahme der Entscheidung eingesetzt hatte, wurde Thorpe erneut zum Olympiasieger erklärt.
Die Geschichte seiner sterblichen Überreste ist übrigens nicht weniger spektakulär, allerdings sehr viel abenteuerlicher. Denn Jim Thorpe kann nichts dafür, dass seine Gebeine hier an der Route 903 Richtung Albrightsville und in dieser kleinen Stadt mit der nichtssagenden Postleitzahl 18229 gelandet sind, in die er in seinem ganzen Leben nie auch nur einen Fuß gesetzt hatte.
Und er kann schon gar nichts dafür, wie diese Stadt inzwischen ganz offiziell heißt: Jim Thorpe.
Richtig. Jim Thorpe. Genauso wie er.
Denn er war bereits tot, als die Lokalpolitiker 1954 auf der Suche nach einer neuen Identität auf diesen Handel eingingen und ihr einstmals blühendes Städtchen im Kohlerevier von Pennsylvania, das nach Schließung der Tagwerke in eine schwere wirtschaftliche Depression verfallen war, umtauften. Das Geschäft kam mit Thorpes Witwe zustande. Mit Patricia, der Ehefrau Nummer drei, die für ein kleines Handgeld den beiden Orten Mauch Chunk und East Mauch Chunk die Gebeine ihres Mannes überließ und daran noch eine Bedingung knüpfte: Sie sollten ihm im Gegenzug ein ordentliches Mausoleum errichten. Und sie sollten den Namen der Kommune ändern.
Thorpes Leichnam war ursprünglich per Eisenbahn von Kalifornien nach Oklahoma gebracht worden, wo er nach einer Trauerfeier nach katholischem Ritus auf dem Fairview-Friedhof von Shawnee beigesetzt wurde. Doch wenig später ließ Patricia ohne Einwilligung der anderen Familienangehörigen die sterblichen Überreste exhumieren und nach Pennsylvania überführen.
Seine letzte Ruhe fand Jim Thorpe – der Sportler – deshalb in Jim Thorpe – der Stadt, die seinen Namen trägt – nicht sogleich. Denn vor ein paar Jahren begannen seine Söhne eine Kampagne, um die Gebeine nach Oklahoma zurückzuholen. Dorthin, wo man noch heute über die böse Stiefmutter schimpft.
Die Auseinandersetzung mit der Stadt in Pennsylvania lief selbst noch 2012, als man das hundertjährige Jubiläum der Olympiasiege von Stockholm hätte feiern können. Sie wurde erst im Herbst 2015 in letzter Instanz beendet, als der Oberste Gerichtshof in Washington ablehnte, sich mit der Sache zu beschäftigen, und auf diese Weise die Entscheidung der Berufungsinstanz zu Gunsten der Stadt Jim Thorpe Rechtskraft erlangte.
Die Enttäuschung in Oklahoma war enorm. Nicht nur unter Familienmitgliedern, sondern auch unter einflussreichen Menschen, die sich von der Rückkehr der Knochensammlung ebenfalls eine touristische Aufwertung ihrer Gegend erhofft hatten. Die Kläger hatten sich auf ein Gesetz berufen, das seit 1990 die Gebeine von Indianern und etwaige Grabbeigaben unter besonderen Schutz stellt und verlangt, dass sie den unmittelbaren Verwandten und Stammesorganisationen übergeben werden. Finanziell unterstützt worden war die Initiative vom Stamm der Sac and Fox. Der betreibt ein Casino und hat das Geld, solche teuren Rechtshändel zu finanzieren.
Justin Lenhart, 2012 Direktor des dortigen Jim Thorpe Museums, heute als Kurator in der Oklahoma Sports Hall of Fame in Oklahoma City beschäftigt, schimpfte damals: Patricia Thorpe sei nur aufs Geld aus gewesen. Sie habe alle Memorabilien verkauft, die ihr Mann im Laufe seiner Karriere angehäuft hatte. Noch schlimmer: Sie sei unvermittelt während der indianischen Begräbnis-Zeremonie zusammen mit der Polizei aufgetaucht und hätte die Leiche einfach mitgenommen.
Eine solche Räuberpistole passt irgendwie zu einem Lebenslauf, der von hohen Hochs und tiefen Tiefs geprägt war: Zu dem Nackenschlag nach der Heimkehr aus Schweden (Justin Lenhart: „Thorpe weinte oft ganz ungeniert. Und er sagte: Ich verstehe das nicht, warum sie mir meine Medaillen abgenommen haben. Ich habe bei Olympia kein Geld bekommen. Ich habe Geld fürs Baseballspielen erhalten.“), zu seinen triumphalen Auftritten als Footballprofi in den frühen Tagen der National Football League, zu den wirtschaftlich eher mageren Verhältnissen, in denen er leben musste. Und zu der Behandlung als Darsteller von Indianern in billigen Hollywood-Western.
Geld verdiente er anschließend trotzdem – unter anderem als Football-Profi. Und später noch als Komparse in billigen Hollywood-Western, wo er allerdings nur den tumben Indianer mimen durfte. Eine richtige Schauspielerkarriere war ihm nicht vergönnt. Überdies litt er irgendwann an Alkoholproblemen, erlebte Schiffbruch mit zwei Ehen und galt bei seinem Tod nur noch als tragischer Held. Ein Image, gegen das die dritte Ehefrau anzukämpfen versuchte, als sie mit den Stadtvätern in Pennsylvania den Deal einfädelte, ihre Kommune Jim Thorpe zu nennen.
Die Stadt mit ihren 5000 Einwohnern ist heute aus dem Gröbsten heraus. Man hat die viktorianische Architektur in der Hauptstraße, genannt Broadway, erhalten und herausgeputzt und wurde deshalb 2012 in einer amerikaweiten Umfrage zu einem der fünf hübschesten Orte des ganzen Landes gewählt. Es gibt Institutionen wie die Jim Thorpe National Bank und das Jim Thorpe Film Festival. Und jedes dritte Wochenende im Mai eine Feier aus Anlass des Geburtstags des Namensgebers.
Aber die meisten Besucher, die kommen, so gibt Al Zagofsky in einem Gespräch zu, der jahrelange Herausgeber vom Carbon County Magazine und deshalb in der Region bestens vernetzt, „wissen überhaupt nicht, wer Jim Thorpe war, und haben auch gar kein Interesse, die Gedenkstätte zu besuchen“.
Sicher, ein paar Traditionalisten wie jene, die sich um die Gedenkfeiern zu seinem Geburtstag kümmern, wären enttäuscht gewesen, wenn der Namenspatron wieder verschwunden wäre. Auch deshalb, weil der Erwerb der sterblichen Überreste juristisch betrachtet sehr wohl mit rechten Dingen zugegangen war. Was William Schwab als Anwalt der Stadt jedem gerne erklärte, der ihn während der Auseinandersetzung in seinem Büro besuchte. Zumal der Sportler Thorpe kein Testament besaß und deshalb persönlich rein gar nichts verfügt hatte.
Schwab, typisch Jurist, sah in der ganzen Angelegenheit interessanterweise keine Spur von Ironie. Dass der großartigste Sportler Amerikas, der Zeit seines Lebens oft genug herumgeschubst worden war, auch nach seinem Ableben nicht viel mehr als ein Spielball unterschiedlicher Interessen geblieben war, schien eine Laune der Geschichte.
Mehr nicht.
„Es gibt ungefähr elf Nachkommen, die gegen eine Umbettung sind. Sie haben ihren eigenen Anwalt. Wenn die elf gegen die anderen zwei antreten, werden die vielleicht nachgeben. Jim Thorpe war Zeit seines Lebens praktizierender Katholik. Die Kirche sieht es gar nicht gerne, jemanden zu exhumieren.“
Dazu kam es nicht, als ein Berufungsgericht in Philadelphia den Streit endgültig beerdigte.
Zumindest der Ort Jim Thorpe ist seither mit sich im Frieden.
(2015)
Es hat in der Geschichte der Olympischen Spiele nur wenige Fälle gegeben, in denen Athleten eine Medaille wieder zugesprochen wurde, die ihnen zuvor aberkannt wurde. Aus deutscher Sicht ist sogar nur ein Fall aktenkundig: der des Eiskunstlauf-Paares Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler. Die beiden hatten ihre Amateurlaufbahn nach den Olympischen Winterspielen von Innsbruck 1964 beendet, bei der sie die Silbermedaille gewonnen hatten. Später wurde bekannt, dass sie bereits vor der Veranstaltung einen Vertrag über ihren Auftritt in dem Kinofilm Die große Kür unterschrieben hatten. Dies stufte das Internationale Olympische Komitee als Verstoß gegen die damaligen Amateurregeln ein. Nach einigem Hin und Her erklärten sich Kilius und Bäumler 1966 bereit, die Medaille abzutreten. Nach der offiziellen Aufhebung des Amateurstatuts 1987 bekamen sie eine Neuprägung als Geste der Wiedergutmachung. Allerdings werden sie erst seit 2014 wieder offiziell vom IOC in der Statistik der Innsbrucker Spiele geführt.
Bäumler war nach dem Ende seiner sportlichen Laufbahn als Schlagersänger, Schauspieler und Fernsehmoderator erfolgreich. Marika Kilius nahm ebenfalls Schallplatten auf und landete zweimal auf Platz zwei der deutschen Schlager-Hitparade. Als Unternehmerin entwarf sie Acrylmöbel, baute einen Merchandising-Betrieb auf, führte ein Restaurant und entwickelte eine eigene Kosmetik-Linie.
MIRACLE ON ICE
Der Sieg der amerikanischen Eishockey-Amateure bei den Winterspielen von Lake Placid über die sowjetischen Favoriten gilt als der spektakulärste Außenseiter-Sieg aller Zeiten. Buzz Schneider war nicht nur dabei, sondern mittendrin.
22. Februar 1980. Ein Freitagabend in Lake Placid, einem kleinen Wintersportort auf halber Strecke zwischen New York und der kanadischen Grenze.
Das erste Eishockey-Spiel des Tages im ausverkauften Olympic Field House ist gerade zu Ende gegangen. Und die 8000 Zuschauer strömen aus der ausverkauften Halle in die Straßen des Dorfs.
Viele schreien begeistert, stakkatohaft immer nur dieselben drei Buchstaben: „USA! USA! USA!“.
In vorbeifahrenden Autos liegen die Fahrer auf der Hupe. Und von irgendwo schießt außerplanmäßig ein Feuerwerk in den Himmel, in dem dicke Wolken einen Tanz aus kleinen Schneeflocken entfacht haben.
Was macht man mit einem angebrochenen Abend wie diesem?
Buzz Schneider, Ken Morrow und Bobby Suter haben eine Idee: Sie wollen die ausgelassene Stimmung so intensiv wie möglich einatmen. Eine Atmosphäre, die kurz davor ist, eine ganze Nation zu elektrisieren.
Sie entscheiden sich für das Holiday Inn, aber drehen vorher ihre Trainingsjacken um, damit man sie nicht als Nationalspieler erkennt, und tauchen ein in die Menge im Hotel, die das Match, das soeben zu Ende gegangen ist, nun im Fernsehen sehen will.
Es ist keine Wiederholung. Zu den wunderlichen Dingen rund um diesen Abend zwei Tage vor dem Ende der dreizehnten Olympischen Winterspiele gehört, dass dieses Spiel in den Vereinigten Staaten nicht live, sondern zeitversetzt mit sage und schreibe drei Stunden Verspätung übertragen wird.
„Wir haben ein Bier getrunken und mitgejubelt. So wie jeder andere auch“, erinnert sich Schneider 40 Jahre später. Er hat im ersten Drittel das Tor zum 1:1-Ausgleich geschossen und kann nun diesen Augenblick quasi live noch einmal nacherleben. Die Entwicklung. Seinen Sturmlauf auf der linken Seite entlang der Bande. Die kurze, schnelle Ausholbewegung mit dem linken Arm. Und den gewaltigen Schuss aus fast 20 Metern in die linke, obere Ecke des sowjetischen Tores.
So atemlos klang das damals im amerikanischen Fernsehen: „Pavelich holt sich den Puck für die USA. Pavelich. Vorne ist Schneider. Schlagschuss. Er geht rein. Buzz Schneider. Die Vereinigten Staaten gleichen das Spiel nach 14 Minuten und drei Sekunden aus. Buzz Schneider, der einzige von ihnen, der ‚76 in Innsbruck dabei war. Was für ein Turnier für ihn. Das ist Buzz‘ fünftes Tor.“
Seitdem hat er die Szene zigmal gesehen. Aber für denjenigen, der sie nicht kennt, ruft er sie gern noch mal aus dem Gedächtnis ab: „Das hat mein Center Mark Pavelich eingefädelt. Er hatte den Puck und stürmte los, aber hat dabei alle nach rechts gezogen. Und dann hat er die Scheibe nach links gepasst.“
Schneider braucht nach so vielen Jahren für die Nacherzählung deutlich länger als die vier Sekunden, die damals zwischen dem Beginn des Angriffs und seinem wuchtigen Schuss vergehen. In seiner Rückbesinnung spielen auch Kleinigkeiten eine Rolle. Zum Beispiel, wie er Wladislaw Tretjak bezwang, den 1,85 Meter großen Major der Roten Armee, damals der beste Torwart der Welt.
„Ich war auf dem linken Flügel und habe ziemlich schnell abgezogen. Das hat Tretjak überrascht, der sich von einer Seite auf die andere bewegte. Ich wusste, dass ich den Puck gut getroffen hatte. Ich habe bewusst auf den oberen Teil des Tores gezielt. In die Ecke. Und so habe ich ihn kalt erwischt.“
Die drei Spieler bleiben allerdings nicht bis zum Schluss der Übertragung. Sie wissen, was passieren wird, sobald die Menge im Hotel nicht mehr gebannt auf den Fernsehschirm starrt, sondern auf sie. „Keiner von uns wollte, dass man herausfindet, wer wir sind.“
Es gibt für die drei keinen Grund, sich von der Stimmung mitreißen und womöglich einlullen zu lassen. Amerikas Eishockeynationalmannschaft hat zwar an diesem Abend Großartiges vollbracht, aber eigentlich noch nichts gewonnen. Erst zwei Tage später gegen Finnland geht es um den großen Preis: die Goldmedaille. Herb Brooks hämmert ihnen dies einen Tag nach dem Triumph noch einmal ein, wie Buzz Schneider sich erinnert.
„Nachdem wir die Russen geschlagen hatten, trafen am nächsten Tag Telegramme von überall her ein, und es wurden in der Umkleidekabine Schläger unterschrieben. Herb kam herein und fegte die Schläger vom Tisch. Er sagte: ‚Ihr Jungs habt noch nichts gewonnen.‘ Dann sind wir rausgegangen und haben trainiert. Wir hatten – einen Tag vor dem Spiel um die Goldmedaille – eine der härtesten Trainingseinheiten des Jahres. Er hat dafür gesorgt, dass unsere Köpfe nicht zu sehr anschwellen. Dafür, dass wir bei der Sache waren.“
Die Begegnung und die Goldmedaille gewinnen sie. Und das vor allem deshalb, weil sie einmal mehr, wenn auch relativ spät im Match, ihre überragende Kondition ausspielen und so den 4:2-Sieg sicherstellen.
Dass man vorher in mehreren Spielen immer wieder am Rand zu einer Niederlage steht, ist eine der nachdrücklichen Erfahrungen des Teams während des ganzen Turniers. Zum Beispiel zwei Tage vorher in der letzten Partie der Vorrunde unmittelbar vor der Auseinandersetzung mit den haushohen Favoriten aus der UdSSR. Gegen einen ziemlich eckigen Gegner namens West Germany liegt man nach dem ersten Drittel mit 0:2 zurück, weil Torwart Jim Craig gleich bei zwei Distanzschüssen zu spät reagiert. Derselbe Craig, der gegen die Sowjetunion wie eine Wand so gut wie alles abwehrt, was auf ihn zukommt. Was bitternötig ist. Denn die Angreifer der UdSSR dominieren. In der Statistik der Torschüsse sieht die Übermacht geradezu überwältigend aus: Die Sowjetunion verbucht 39. Die USA gerade mal 16.
Die Amerikaner kontern jedoch in den beiden restlichen Dritteln gegen die Bundesrepublik und gewinnen mit 4:2. Nicht genug für manche US-Experten, die auf einen höheren Erfolg gesetzt haben, mit dem sich das Team in der Vorrundentabelle vor die Schweden geschoben hätte und einen sofortigen Showdown mit den Sowjets vermieden.
Die amerikanischen Spieler finden solche Überlegungen unsinnig. „Worin besteht denn da der Unterschied?“ sagt Torwart Craig. „Wir müssen doch so oder so gegen sie spielen.“
Warum müssen sie das? Der internationale Eishockeyverband hat die Regeln über die Medaillenvergabe nach dem kuriosen Ausgang der Spiele von Innsbruck vier Jahre vorher verändert, bei denen die Bundesrepublik den USA die Bronzemedaille aufgrund der Berechnung eines ominösen Torquotienten weggeschnappt hat. So gibt es diesmal für die besten vier eine neuerliche Punkte-Runde mit zwei Spielen gegen die beiden Top-Teams der anderen Vorrundengruppe. Die Resultate aus den Vergleichen in der eigenen Gruppe – das Unentschieden zwischen den USA und Schweden und die 2:4-Niederlage der Finnen gegen die UdSSR – werden übernommen.
Aber zurück zu dem triumphalen Abend, bei dem das Fernsehen dem Spiel gleich auf zweierlei Weise einen besonderen Stellenwert verleiht. Es gehört zu dessen eigenwilligen Begleitumständen, wie der amerikanische Fernsehsender ABC mit dem Ereignis umgeht, dessen Kommentator Al Michaels das Spiel nach der Schlusssirene spontan zu einem Wunder hochstilisiert. Zum Miracle on Ice. Die Programmverantwortlichen haben vor dem Spiel den internationalen Eishockeyverband gedrängt, das Match in die zuschauerträchtigere Prime Time zu verschieben, aber sind auf taube Ohren gestoßen. So entscheiden sie sich kurzfristig für den Verzicht auf eine Live-Übertragung und verlegen die Ausstrahlung einfach nach hinten.
In anderen Ländern würde es als Affront eingestuft, einer ganzen Nation eine derartige künstliche Spannung aufzubürden. Doch im Kampf um Einschaltquoten scheint jedes Mittel recht. Chef-Ansager Jim McKay tut vor Beginn der Übertragung so, als sei es das Normalste von der Welt, dass der Sender den Menschen im Austragungsland der Olympischen Spiele eine solche Partie vorenthalten hat.
Es ist die Geburtsstunde dessen, was das amerikanische Sportfernsehen Jahre später im Rahmen der Berichterstattung von Olympischen Spielen immer wieder praktiziert und wird mit dem Begriff plausibly live belegt.48 „Die Ereignisse, die Sie heute Abend sehen werden, sind bereits vorbei. Möglicherweise kennen bereits mehrere Millionen das Resultat. Aber wir wollen es nicht verraten.“
Das Resultat ist das eine. Etwas ganz anderes ist die Art und Weise, wie es zustande kommt, als eine ziemlich unerfahrene Truppe mit jungen Collegespielern und lupenreinen Amateuren eine der besten Eishockeymannschaften aller Zeiten mit ihren eingespielten Berufsoffizieren bezwingt. Der Endstand: 4:3, ein knapper Sieg. Aber niemand wird nachher bestreiten, dass die Amerikaner verdient gewonnen haben. Nicht mal die Verlierer, die die Schmach, ihren Zorn und ihre Verwirrung herunterschlucken, als sie aus der Halle hinaus in die Winternacht treten.
Das Prickeln von damals ist verflogen. Dafür ist die Wertschätzung für die Akteure mit jedem Jahr ein Stückchen mehr gewachsen. Dieses eine Spiel gilt noch heute als Miracle on Ice, eine Bezeichnung, die auf den denkwürdigen Satz zurückgeht, den der Fernsehkommentator Al Michaels kurz vor der Schlusssirene in den Äther brüllt:
„Do you believe in miracles? Yes.“
„Glaubt ihr an Wunder? Ja.“
Michaels erinnert sich Jahre später in einem Video-Interview an diesen Moment, in dem er das Außerordentliche am Sieg der amerikanischen Außenseiter in einen Gedanken gießt, der das Spiel auf ewig im öffentlichen Bewusstsein verankert: „Die Zeile ‚Glaubst du an Wunder? Ja‘, ist einfach Teil meines Kommentars während der Übertragung. Ich habe deshalb Glück gehabt, dass die Leute bis heute darüber reden. Als der Film mit dem Titel Miracle gedreht wurde, haben mir die Leute gesagt, die ihn produziert haben: ‚Hey, wenn du nicht das sagst, was du damals gesagt hast, dann haben wir wahrscheinlich gar keinen Film.‘“
Diese auf den wenigen spontanen Worten eines Fernsehreporters basierende Wahrnehmung entspricht dem Platz, den das Ereignis seitdem im kollektiven Gedächtnis der Vereinigten Staaten einnimmt: Dies war nicht irgendein Eishockeyspiel. Es war das Äquivalent zu einer Schlacht in einem Krieg in einer Zeit des ständigen Säbelrasselns der beiden Atommächte. Wenn auch mit stumpfen Waffen auf einem ideologisch geprägtem Fundament. Eine Schlacht mit Eishockeyschlägern und Hartgummischeiben.
Von den beiden Gegnern hatte der eine – die Sowjetunion – kurz zuvor mit dem Einmarsch in Afghanistan gezeigt, wie man gegebenenfalls mit der Armee in einem Nachbarland einmarschiert. Während der andere – die Vereinigten Staaten – moralisch angeschlagen von einer anhaltenden Wirtschaftskrise, dem langen Echo auf das Fiasko des Vietnam-Kriegs und von der langen Geiselnahme amerikanischer Diplomaten im Iran dringend ein Anti-Depressivum mit durchschlagender Wirkung braucht.
Das Spiel wird so zum Symbol eines Wettstreits voller nationalistischer Gefühle, das die Menschen in Amerika dazu inspiriert, die jüngste Eishockey-Auswahl, die das Land je zu Olympischen Spielen geschickt hat, mit ungeheurer Ekstase und Schwärmerei aufzuladen. Ein Phänomen, das die Lake Placid News Jahre später so beschreibt: „Wir können gar nicht deutlich genug unterstreichen, wie dieses Miracle on Ice die Stimmung in Amerika veränderte. Das Wunder gab uns Hoffnung für die Zukunft. Es sorgte dafür, dass wir uns wieder besser fühlen – nach einem politisch und wirtschaftlich tristen Jahrzehnt.“
Nach dem Turnier lädt Präsident Jimmy Carter die Mannschaft nach Washington ein. Bis dahin hat keiner von ihnen eine Vorstellung davon, welche Bedeutung dieser Sieg für ihre Landsleute hat. Aber als sie im Bus auf der Fahrt vom Flughafen ins Weiße Haus erleben, wie die Menschen an den Straßen Spalier stehen und ihre Namen brüllen, sickert es allmählich ein.
„Ja“, sagt Buzz, damals einer der Leistungsträger und mit 25 der älteste im Kader. „Man hat uns immer wieder gesagt, was für ein positives Gefühl das für die Menschen war.“ Er macht eine Pause und fügt hinzu: „Aber wir haben das ebenfalls sehr genossen.“
Verständlich: Es ist ja zu allererst auch ihr ganz persönlicher Triumph. Zum Beispiel für David Christian, dessen Vater Bill und dessen Onkel Roger bei den Spielen 1960 in Squaw Valley ebenso überraschend die Goldmedaille gewonnen hatten und der 1980 seinen Teil zu einer erstaunlichen Eishockey-Dynastie beiträgt: insgesamt acht Assists verteilt über das gesamte Turnier von Lake Placid.