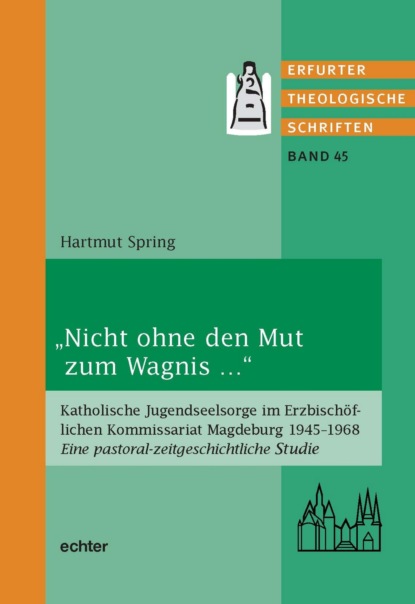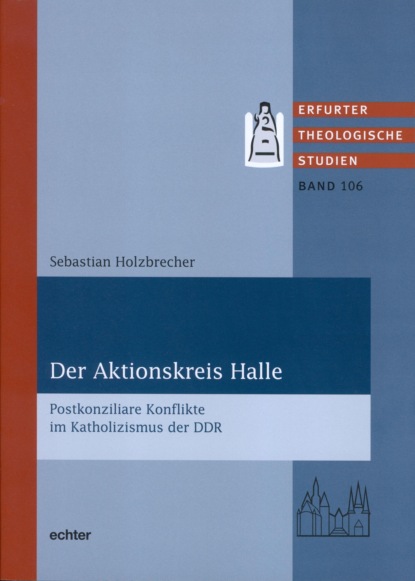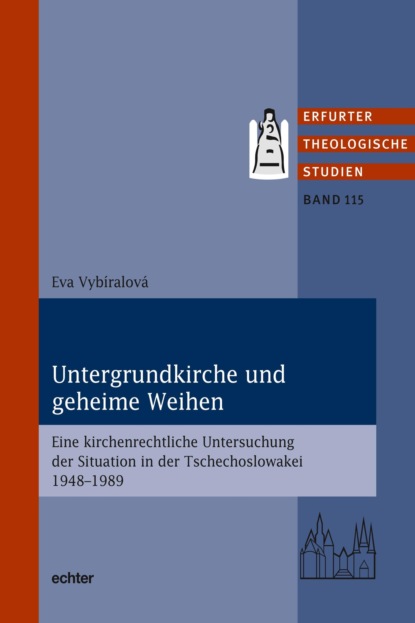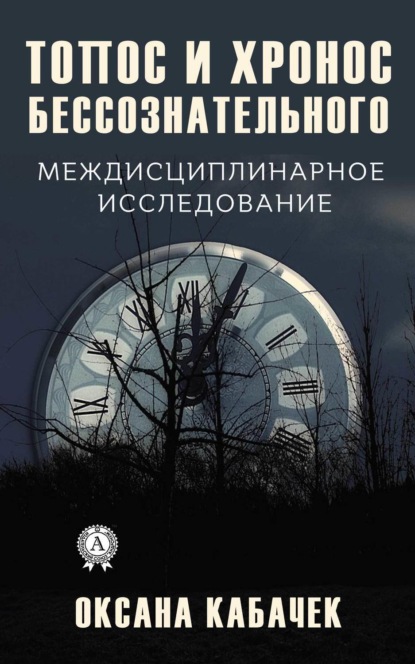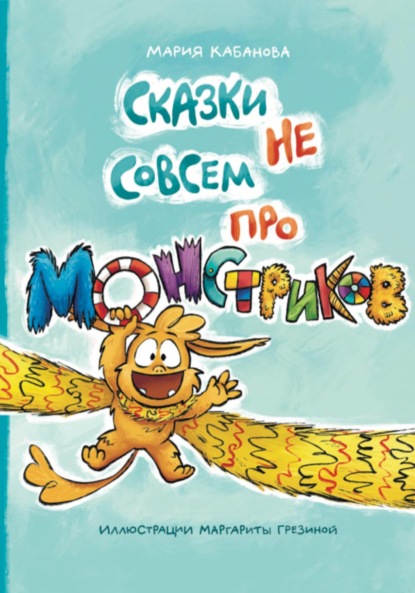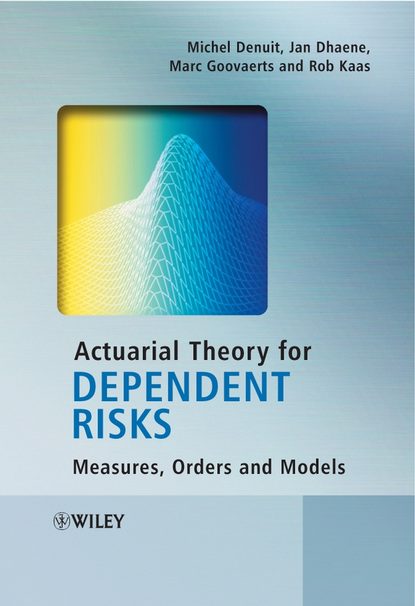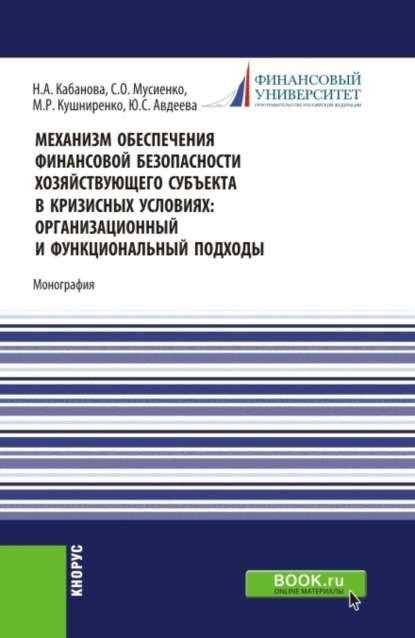Kirchliches Begräbnis trotz Euthanasie?
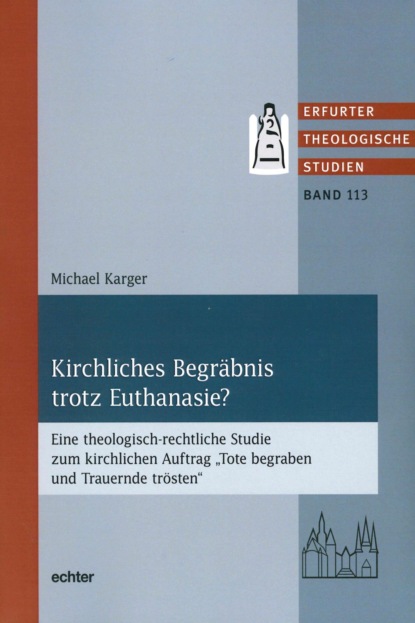
- -
- 100%
- +
Entwicklungen im 20. Jahrhundert
Die Selektionstheorien über die Volksgesundung führten im Übergang zum 20. Jahrhundert zu einer rechtstheoretischen Reflexion hinsichtlich ihrer Umsetzung. In Deutschland legte der Rassenhygieniker Roland Gerkan einen Gesetzesentwurf vor, der für unheilbar Kranke „ein Recht auf Sterbehilfe (Euthanasie)“ vorsah.29 Gerkans Entwurf geht zu großen Teilen auf die Gedanken des Psychologen Adolf Jost (1874-1908) zurück, der auf Basis utilitaristischen und sozialdarwinistischen Gedankenguts für ein Recht auf Tötung auf Verlangen plädierte, indem er den individuellen Wert eines menschlichen Lebens für das Individuum als auch die Gesellschaft in einem Verhältnis von Nutzen und Kosten darstellte.30 Waren die Kosten für die Aufrechterhaltung des Lebens größer als dessen Nutzen, sah Jost aus Gründen menschlichen Mitleids ein Recht auf Tötung auf Verlangen gegeben.31 Unter Betonung des gesellschaftlichen Mitleids mit dem Kranken als auch des Nutzenfaktors für Individuum und Gesellschaft sprach sich auch Haeckel explizit für die Ausscheidung des Schwachen aus.32
Abschließend bereiteten der Jurist Karl Binding (1841-1920) und der Psychiater und Neurologe Alfred Hoche (1865-1943) mit ihrer theoretische Studie Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Mass und ihre Form33 den inhaltlichen Boden für die diffamierende Verwendung des Euthanasiebegriffs durch das NS-Regime.34
Binding vertrat die These, dass jeder ein Recht auf seinen Tod beanspruchen und an eine andere Person delegieren könne, weshalb der mit der Ausführung der Tötung Beauftragte nicht nach eigenem Interesse, sondern auf Wunsch des Sterbewilligen handele.35 Durch diese Rechtsübertragung könne Euthanasie im Sinn einer Tötung auf Verlangen nicht verboten sein.36 Bezüglich des Umgangs mit schwachen, kranken und behinderten Menschen verwies Binding auf die Anwendung utilitaristischer und sozialdarwinistischer Prinzipien und sah bei negativem Lebenswert gemäß dem Jost’schen Berechnungsmaßstab37 den Gesetzgeber sogar in der Pflicht, das Leben der sogenannten Lebensunwerten unter bestimmten Voraussetzungen zur Vernichtung freizugeben.38 Diese Erweiterung des Euthanasiebegriffs um die Vernichtung lebensunwerten Lebens führte im Dritten Reich realiter aber zu einer semantischen Reduktion auf ebendiese. Da sich das NS-Regime die bestehende Ambivalenz des Euthanasiebegriffs in Wissenschaft und Gesellschaft zu Nutze machte und sein Vorhaben zur Stärkung der arischen Rasse auf Basis von Bindings und Hoches Rechtstheorie zur Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens und unter dem Deckmantel einer als Mitleidshandlung propagierten Euthanasie verwirkliche,39 verschwand die Tötung auf Verlangen als Erlösung vom Leiden gänzlich aus dem Deutungshorizont.40 Auch wenn die NS-Euthanasie unter der Bezeichnung aufgrund von Protesten aus der Gesellschaft41 und anderen Ursachen 1941 eingestellt wurde42, hatte der Euthanasiebegriff im deutschsprachigen Raum zu dem Zeitpunkt eine gravierende terminologische Metamorphose durchlaufen und bedeutete ausschließlich die „Ausmerzung von ‚lebensunwürdigen‘ Menschen (Geistesgestörte, Erbgeschädigte, schwerkranke, alte Menschen) kraft staatlicher Anordnung, ohne Frage nach Zustimmung oder Nicht-Zustimmung der Betroffenen oder ihrer Angehörigen.“43
Im internationalen Sprachgebrauch entwickelte sich der Euthanasiebegriff disparat, da er inhaltlich wieder von den selektionstheoretischen Tendenzen abgegrenzt wurde. Vor allem in Großbritannien und den USA fand er in der Diskussion um die Zulässigkeit der ärztlichen Herbeiführung des Todes für schwer kranke Menschen, sofern diese darum baten, eine neue Verwendung.44 Zu keiner Zeit war das Gedankengut der Vernichtung lebensunwerten Lebens Bestandteil der Debatten um Tötung auf Verlangen, sodass für den internationalen Kontext nicht von einem neuerlichen Wandel des Euthanasiebegriffs gesprochen werden kann.
Nach Kriegsende ist sowohl für den deutschen als auch den internationalen Sprachraum eine Ruhephase bzw. Tabuisierung der Diskussion um die Zulässigkeit der Tötung auf Verlangen und anderer medizinischer Handlungen am Lebensende zu verzeichnen.45 Damit endete im deutschsprachigen Raum nicht nur der Diskurs um Tötung auf Verlangen abrupt, sondern auch die Verwendung des Euthanasiebegriffs. Er wurde für unbrauchbar erklärt und durch den Terminus Sterbehilfe ersetzt, wodurch eine weltweit einheitliche Terminologie bezüglich Tötung auf Verlangen aufgegeben wurde.46
Nach in der Phase der Tabuisierung lässt sich im internationalen Sprachgebrauch für die erste Nachkriegsphase47 (1950-1960) eine zunehmende Unterscheidung der Formen von euthanasia in aktive und passive als Differenzierung des ärztlichen Handelns verzeichnen. In dieser nahm auch Papst Pius XII. (1876-1958, Papst: 1939-1958) zu konkreten, medizinethischen Problemen Stellung und übte dadurch einen großen Einfluss auf die Begriffsinterpretation über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus aus.48 Auf den enormen medizinischen Fortschritt in den 1950/60er Jahren folgte eine zweite Nachkriegsphase (1960-1970), in der spektakuläre Einzelschicksale und -fälle bekannt wurden, in denen lebensbeendende und -verkürzende Maßnahmen erbeten und in Anspruch genommen wurden. Dadurch wurde die Debatte um Tötung auf Verlangen als Ausdruck des gestaltenden Mitspracherechts der Patienten am Ende ihres Lebens zu einem bis heute zentralen Thema der öffentlichen Wahrnehmung und des gesellschaftlichen Diskurses.
Abschließend ist für den internationalen Sprachgebrauch eine breite Verwendung des Euthanasiebegriffs als Bezeichnung von ärztlich-medizinischen Handlungen festzuhalten, die in den menschlichen Sterbeprozess lebens- oder therapiebeendend oder schmerzlindernd mit in Kauf genommener Todesfolge eingreifen. Dementgegen ist bis ins 21. Jahrhundert hinein jeder Versuch zur Rehabilitation des Euthanasiebegriffs im deutschsprachigen Raum aufgrund seiner historischen Vorbelastung und euphemistischen Verwendung in der NS-Diktatur bereits im Ansatz zum Scheitern verurteilt.
2.1.2. Zum Sterbehilfebegriff
Seit der Nachkriegszeit ist für den deutschsprachigen Raum in Politik, Gesellschaft und Wissenschaftslandschaft eine Vermeidung des Euthanasiebegriffs festzustellen, um einer Verwechslung mit den Handlungen des NS-Regimes zu entgehen. Dieses hatte den Begriff aufgrund seiner Vernichtung lebensunwerten Lebens unter dem Deckmantel einer erlösenden Euthanasie innerhalb von nur sechs Jahren konterkariert. Stattdessen wird vorwiegend der Sterbehilfebegriff verwendet.49 Obwohl oftmals vermutet wird, dass er als Ersatz des Euthanasiebegriffs erst in der Nachkriegszeit geprägt wurde50, war er bereits Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt51 und wurde partiell als Äquivalent zu Euthanasie gebraucht wurde.52 Während 1914 der Sprachforscher und Philosoph Fritz Mauthner (1849-1923) den Sterbehilfebegriff als „vergeudung von sprachenergie“53 verspottete, führte ihn das Deutsche Wörterbuch der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm von 1941 mit folgender Erklärung:
„[S]terbehilfe, hilfeleistung beim sterben durch todbeschleunigende mittel, neue wortbildung“54.
Der Austausch der beiden Termini Euthanasie und Sterbehilfe im deutschen Sprachgebiet ist letztlich nicht exakt zu datieren. Die Debatte um vorzeitige Lebensbeendigung, d. h. Tötung auf Verlangen wurde jedoch nach Ende des II. Weltkriegs und überwundener Tabuisierung vorwiegend unter Zuhilfenahme des Sterbehilfeterminus aufgegriffen.55 Spätestens ab Mitte der 1970er Jahre hatte Sterbehilfe den Euthanasiebegriff im deutschen Sprachraum als adäquaten Terminus abgelöst.56
Kritisch ist anzumerken, dass der Sterbehilfebegriff kontinuierlich von Fehlinterpretationen und Missverständnissen begleitetet wurde, sodass mit zunehmender Differenzierung der bezeichneten medizinischen Handlungen die Forderung nach anderen Termini geäußert wurde. Die Ambivalenz des Sterbehilfebegriffs wird zum einen in der inhärenten Semantik des Begriffs selbst gesehen, der eine Verbindung der substantivierten Verben Helfen und Sterben darstellt. Aus Sicht der Kritiker bringe das Kompositum Sterbe-hilfe nicht klar zum Ausdruck, ob die Verknüpfung temporaler oder finaler Natur sei. Während die
- Hilfe beim/im Sterben eine zeitliche Kontingenz ausdrücke und einzig auf die umsorgende und schmerzlindernde Begleitung im Sinn einer palliativmedizinischen Grundversorgung im Sterbeprozess abziele, eine bewusste Lebensbeendigung aber nicht intendiere (temporal), bezeichne hingegen die
- Hilfe zum Sterben einen bewusst intendierten Eingriff in den Sterbeprozess des Menschen durch medizinisches Handeln oder Unterlassen, der auf die vorzeitige Herbeiführung des Todes des unheilbar Kranken hingeordnet ist bzw. dessen krankheitsbasierten Sterben keine Therapie entgegensetze (final).57
Auch die Begriffe Hilfe und Sterben wurden aufgrund ihres weitläufigen Interpretationsspielraums kritisiert. Die Verwendung des Wortes Hilfe erscheine hochgradig problematisch, da der Leser mit diesem Begriff eine wohlwollende, am Willen einer in Not geratenen Person orientierte Handlung assoziiere. Der Gebrauch des Wortes im Kontext von Tötung auf Verlangen sei eine Karikatur.58 Ebenso kritisch wurde der Begriff Sterben hinterfragt, da er nicht genau angebe, welche Phase innerhalb des Sterbeprozesses eines Menschen bezeichnet werde: jener Zeitraum, der dem krankheitsbedingten unausweichlichen Tod vorausgeht (Terminalphase, Final- oder Sterbephase), oder der Moment des Todeseintritts an sich.59 Je weitläufiger der Begriff Sterben ausgelegt und je früher der Zeitpunkt des Sterbebeginns angesetzt werde, desto komplexer gestalte sich die Frage nach einer angemessenen Sterbehilfe. Aufgrund des Fehlens eines einheitlichen Konzeptes, zu welchem Zeitpunkt das Sterben des Menschen beginnt,60 ist der Sterbehilfebegriff somit derzeit nicht vor Missverständnissen geschützt.
In Konsequenz der terminologischen Unzulänglichkeiten gibt es im deutschen Sprachraum kein einheitliches terminologisches Konzept, welches ganzheitliche Akzeptanz erhält. Es existieren nebeneinander Ansätze von absoluter Vermeidung des Euthanasiebegriffs61 über die Verwendung beider Begriffe als synonyme Oberbegriffe62 mit partieller adjektivischer Spezifizierung63 bis hin zum Gebrauch von Euthanasie als Äquivalent zur direkten, aktiven Sterbehilfe.64 Zudem gibt die Divergenz der terminologischen Konzepte kontinuierlich Anlass für neue Vorschläge, um irreführende und missverständliche Begriffe abzulösen.
Im Kontext eines Entwurfs eines Sterbehilfegesetzes in Deutschland wurde bereits 1986 die klassische Dreiteilung in aktive, passive und indirekte Sterbehilfe scharf kritisiert und als veraltet bezeichnet. Bei gleichzeitigem Verzicht der gängigen Begriffe wurde die Verwendung von Tötung auf Verlangen, Abbruch oder Unterlassung lebenserhaltender Maßnahmen und leidensmindernden Maßnahmen vorgeschlagen.65 Die jeweiligen medizinischen Handlungen sollten individuell benannt und nicht durch Subsumtion unter einen Oberbegriff sowohl formal wie auch materiell miteinander verknüpft werden. Für den medizinischen Bereich in Deutschland plädierte die Bundesärztekammer (=BÄK) in ihren Grundsätzen zur ärztlichen Sterbebegleitung von 1998, 2004 sowie letztmalig 2011 konsequent für den Verzicht auf den Sterbehilfebegriff.66 Auch der Nationale Ethikrat forderte 2006,
„die eingeführte, aber missverständliche und teilweise irreführende Terminologie von aktiver, passiver und indirekter Sterbehilfe aufzugeben. Entscheidungen und Handlungen am Lebensende, die sich mittelbar oder unmittelbar auf den Prozess des Sterbens und den Eintritt des Todes auswirken, können angemessen beschrieben und unterschieden werden, wenn man sich terminologisch an folgenden Begriffen orientiert: Sterbebegleitung, Therapie am Lebensende, Sterbenlassen, Beihilfe zur Selbsttötung, Tötung auf Verlangen.“67
Sofern der Nationale Ethikrat den Behandlungsabbruch bzw. -verzicht unter Sterbebegleitung verstanden wissen wollte, wurde wiederum kritisiert, dass er zumindest aus strafrechtlicher Perspektive ebenfalls missverständlich sei.68 Daher stand der Rechts- und Staatswissenschaftler Thomas Verrel in seinem Gutachten zu Patientenautonomie und Strafrecht bei der Sterbebegleitung für den 66. Deutschen Juristentag im Jahr 2006 für die Verwendung einer klaren und emotionsentladenen Terminologie wie Tötung auf Verlangen, Behandlungsbegrenzung und Leidensminderung ein.69
Trotz der stichhaltigen und schlüssigen Argumente gegen die Verwendung des Sterbehilfebegriffs konnte sich zumindest in der gesellschaftlichen Debatte im deutschsprachigen Raum keiner der vormals benannten Ablösungsvorschläge durchsetzen, ohne dies als Kompetenzzuweisung an den Sterbehilfebegriff aufgrund seiner Tradition misszuverstehen.
2.1.3. Zusammenfassung
Der Begriff Euthanasie diente in der Antike lediglich der Beschreibung eines guten Todes, der den Sterbenden auf leichte, schnelle, ruhmreiche oder auch würdevolle Art und Weise ereilte. Der Gedanke, selbst für einen guten Tod zu sorgen, trat erstmalig in den utopischen Schriften der Renaissance zum Vorschein, womit der Euthanasiebegriff einen ersten aktiven Einschnitt erfuhr. Zur Zeit der Aufklärung wurde unter Euthanasie die Aufgabe der Ärzte verstanden, für ein schmerzloses und angenehmes Sterben im Sinn einer palliativmedizinischen Sterbebegleitung zu sorgen. Im Horizont darwinistischen, selektionstheoretischen und utilitaristischen Gedankenguts wurde unter Zuhilfenahme des Euthanasiebegriffs ein Recht auf Tötung auf Verlangen in der Hermeneutik menschlichen Mitleids reflektiert. Diese theoretischen Gedanken setzte das NS-Regime in die Praxis um und verfolgte zur Stärkung der arischen Rasse die Vernichtung lebensunwerten Lebens, wodurch der Euthanasiebegriff im deutschsprachigen Raum konterkariert wurde. Während er im internationalen Kontext über die Nachkriegszeit hinaus für die Debatte über Tötung auf Verlangen kontinuierlich Verwendung fand, ist für den deutschsprachigen Raum ein Austausch zugunsten des Sterbehilfebegriffs zu verzeichnen. Zwar werden einerseits sowohl der Begriff selbst als auch die zur Differenzierung verwendeten Adjektive kritisch betrachtet, sodass aus dem medizinischen, juristischen und politischen Bereich terminologische Vorschläge geäußert werden, andererseits aber konnten sich diese nicht durchsetzen.
Nicht nur für den Seelsorger, der eine medizinische Handlung vor dem Hintergrund der kirchlichen Lehre nach ethischen Kriterien bewerten muss, um Möglichkeiten und Grenzen der Seelsorgegestaltung zu eruieren, sondern auch für den um die Feier eines kirchlichen Begräbnisses bittenden Gläubigen kann die aufgezeigte terminologische Varianz erhebliche Konsequenzen haben. Konfrontiert mit dem Vollzug von Tötung auf Verlangen oder Behandlungsabbruch bzw. -verzicht und der entsprechenden Entscheidung seitens des schwerkranken Menschen muss der Seelsorger die konkret verwendeten Begriffe auf ihre Valenz hinterfragen, um zu wissen, welche medizinische Handlung auch tatsächlich vollzogen wurde. In diesem Stadium seines Entscheidungsprozesses wird er aber mit weiteren disparaten terminologischen Konzepten konfrontiert, mit denen einerseits in Politik und Gesellschaft, andererseits vom kirchlichen Lehramt die Oberbegriffe spezifiziert werden. Hierin konkretisiert sich bereits ein erster und ernster Moment des Zweifels.
2.2. Terminologische Konzepte
Wie bereits angedeutet, finden sowohl der Sterbehilfe- als auch der Euthanasiebegriff im deutschsprachigen wie internationalen Kontext trotz Kritik und Ablösungsversuche weiterhin Verwendung. Ungeachtet seiner ungenügenden und unzureichenden Klarheit soll daher in einem ersten Schritt das geläufige Konzept zur Unterscheidung von lebensverkürzenden bzw. -beendenden Maßnahmen am Lebensende anhand der Begriffe aktive und passive Sterbehilfe bzw. euthanasia70 auf der Handlungsebene, direkte und indirekte auf der Intentionsebene sowie freiwillige, nichtfreiwillige und unfreiwillige auf der situativen Ebene dargestellt werden.71 Diese notwendige Differenzierung dient der Analyse jener Handlungen und Sachverhalte, die aus Sicht der katholischen Kirche eventuell als ethisch unzulässig zu bewerten sind und Konsequenzen für die Anwendung des kirchlichen Rechts nach sich ziehen könnten. So ist beispielsweise die Intention, mit der ein Medikament verabreicht wird, kirchenrechtlich höchst relevant. Die Intention, den Tod durch Medikamentengabe vorzeitig herbeizuführen, stellt einen vollkommen anderen Sachverhalt dar, als die anvisierte Schmerzlinderung mit in Kauf genommener Todesfolge. Zudem ist die Willenshaltung des Patienten bezüglich der vollzogenen Handlung für deren ethische Beurteilung und somit auch über die kirchenrechtlichen Konsequenzen bezüglich Gewährung oder Verweigerung des kirchlichen Begräbnisses entscheidend. Aus diesem Grund soll in einem zweiten Schritt das terminologische Konzept dargestellt und hinterfragt werden, das in den lehramtlichen Dokumenten Verwendung findet. Diese Differenzierung dient der Klärung und Sondierung jener Sachverhalte, die aufgrund ihrer moralischen Fragwürdigkeit für die vorliegende kirchenrechtliche Studie von Belang sind.
2.2.1. Gängige Differenzierung des Sterbehilfebegriffs
Trotz vorgebrachter Alternativen wird auch weiterhin auf die klassische Dreiteilung des Sterbehilfebegriffs in aktiv, passiv und indirekt zurückgegriffen, obwohl diese unter medizinischen und juristischen Gesichtspunkten unzulänglich ist.72 Dem früheren Bamberger Moraltheologen Volker Eid zufolge wurde bereits 1975 unter
- aktiver Sterbehilfe die direkte Herbeiführung des Todes,
- unter passiver das durch Behandlungsverzicht oder -abbruch zugelassene Sterben und
- unter indirekter die intendierte Schmerzlinderung mit nicht intendierter, aber billigend in Kauf genommener Todesfolge als Nebenwirkung der Medikamentengabe
verstanden.73 Die erste offensichtliche Unterscheidung in aktiv/passiv bezeichnet kein physisches Handeln oder Unterlassen eines Dritten am Patienten, sondern qualifiziert das äußere Einwirken auf den natürlichen Sterbeprozess. Aktiv ist Sterbehilfe dann, wenn sie den natürlichen Sterbeprozess abbricht und der Tod aufgrund der Handlung eintritt. Sie ist passiv, wenn der Sterbeprozess nicht mehr mithilfe von Medikamenten oder Therapien verlangsamt oder aufgehalten wird und der Tod durch die Krankheit verursacht wird. An dieser Stelle ist klar hervorzuheben, dass die Begriffe aktiv wie passiv ohne nähere Bestimmung auf deskriptiver Ebene verharren und daher als solche wertneutral bleiben. Sie geben über die Todesursache Auskunft: Abbruch des natürlichen Sterbeprozesses (aktiv) oder das ungebremste und ungehinderte Zulassen des Sterbens durch die Krankheit (passiv).74
Eid verknüpfte den Begriff aktive Sterbehilfe mit der direkten Absicht, den Tod herbeizuführen. Er verstand darunter die direkte (aktive) Sterbehilfe, deren sachlogisches Pendant die indirekte Sterbehilfe darstellt, da auch sie de facto eine Herbeiführung des Todes und den Abbruch des natürlichen Sterbeprozesses bezeichne, auch wenn diese nicht intendiert wurden. Aufgrund ihrer Natur aber muss sie als Teilbereich der aktiven Sterbehilfe betrachtet werden, der bei gleichem Handlungsergebnis, der, wenn auch nicht intendierten Herbeiführung des Todes durch das Begriffspaar direkt/indirekt auf der Intentionsebene näher differenziert wird.75
Es bedarf für die moralische und juridische Klärung noch einer dritten Differenzierung, die im Kriterium der Willenshaltung des Patienten angesiedelt und durch freiwillig, nichtfreiwillig und unfreiwillig zu klassifizieren ist. Diese wird oftmals außer Acht gelassen, obwohl sie den Unterschied zwischen direkter aktiver, indirekter aktiver sowie passiver Sterbehilfe einerseits und Mord, Totschlag sowie fahrlässiger oder vorsätzlicher Tötung andererseits ausmacht.
Unterscheidung auf der Ebene der Todesursache – aktiv/passiv
Es wurde aufgezeigt, dass die erste Unterscheidung lebensverkürzender bzw. -nichterhaltender medizinischer Maßnahmen im Kontext von unheilbarer Krankheit in aktive und passive Sterbehilfe keine Information über die Intention oder die Art der Handlung seitens eines Dritten preisgibt, sondern etwas über die Qualität der Todesursache aussagt: Verstarb der Patient an der durch Behandlungsabbruch bzw. -verzicht ermöglichten ungehinderten Ausbreitung der Krankheit (passiv) oder aber ist der Tod als direkte Folge eines Eingriffs einer außenstehenden Person (aktiv) eingetreten.
Als aktive Sterbehilfe sind jene medizinischen Eingriffe einzuordnen, die unmittelbar zum Tod des schwerkranken Patienten führen, sodass der Todeseintritt primär als Folge des äußeren Eingriffs und nicht der bestehenden Krankheit anzusehen ist. Im Gegensatz zu einem üblicherweise präsumierten Tod durch Krankheit kommt es zu einem Wechsel der Todesursache im Zeichen eines dem natürlichen krankheitsbedingten Tod vorweggegriffenen Todes. Für die Charakterisierung einer Handlung als aktive Sterbehilfe ist die Intention des Handelnden irrelevant. Tritt der Tod unabhängig der Intention zur Todesherbeiführung oder zur Schmerzlinderung als Resultat einer Medikamentengabe ein, erfolgte unweigerlich ein Austausch der Todesursache, sodass die Handlung als aktive Sterbehilfe zu qualifizieren ist. Ebenso irrelevant für die Bestimmung einer Handlung als aktiv oder passiv ist die Situation der schweren, unheilbaren Krankheit selbst, die ein entsprechendes (ärztliches) Handeln erst möglich bzw. nötig gemacht hat. Sie ist zwar die conditio sine qua non für das äußere Handeln, nicht aber die direkte Ursache für den Tod.
Als passive Sterbehilfe werden indes jene medizinischen Interventionen angesehen, bei denen die Verlängerung des Lebens bzw. Verzögerung des Sterbeprozesses mithilfe lebenserhaltender oder -verlängernder Therapien nicht mehr verfolgt wird.76 Nach Änderung des Therapieziels gemäß einem würdevollen Sterben wird dem Sterbeprozess nicht mehr mithilfe therapeutischer und intensivmedizinischer Maximalbehandlung entgegengewirkt, sondern stattdessen das aufgrund der Krankheit unausweichliche Sterben lediglich palliativmedizinisch und schmerzlindernd begleitet. Der schwerkranke Patient stirbt zwar in Folge des Behandlungsabbruchs und -verzichts, der Tod aber ist keine direkte Folge des ärztlichen Einwirkens ist, sondern tritt aufgrund der fortschreitenden Krankheit als natürlicher Tod eintritt.77 Weder wird der Tod herbeigeführt noch der Sterbeprozess verkürzt, da lediglich die lebenserhaltenden bzw. -verlängernden therapeutischen Maßnahmen beendet werden oder bereits vor deren Beginn auf diese verzichtet wurde.
Als Argument gegen die Verwendung des Begriffspaares aktiv/passiv wird immer wieder die Konnotation dieser beiden Adjektive mit der Beschreibung menschlichen Handelns als Tun (aktiv) und Unterlassen (passiv) ins Feld geführt. Diese Hermeneutik hätte das Missverständnis zur Folge, dass jedes Tätigwerden eines Dritten – z. B. des Arztes oder Krankenpflegers – als aktive Sterbehilfe und einzig das physische Nichtagieren als passive Sterbehilfe zu bezeichnen seien. Demnach müssten neben der Tötung auf Verlangen und der intendierten Schmerzlinderung mit billigend in Kauf genommener Todesfolge auch sämtliche Formen des Behandlungsabbruchs wie das Abschalten von Beatmungsgeräten oder die Beendigung von künstlicher Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr zum Bereich der aktiven Sterbehilfe gezählt werden, da sie alle eine Tätigkeit implizieren. Als passive Sterbehilfe könnte nach diesem Verständnis einzig der Verzicht auf eine Therapie oder Behandlung verstanden werden.78 Dem ist logisch zu erwidern, dass gerade die Zuordnung sowohl des Behandlungsabbruchs (aktives Verhalten) als auch -verzichts (passives Verhalten) zum Bereich der passiven Sterbehilfe zeigt, dass sich der Begriff passiv eben nicht am menschlichen Tun oder Unterlassen orientiert, zumal weder nach deutschem noch internationalem Recht in der juristischen Bewertung zwischen der Einstellung einer bereits laufenden Therapie und des Behandlungsverzichts unterschieden wird.79