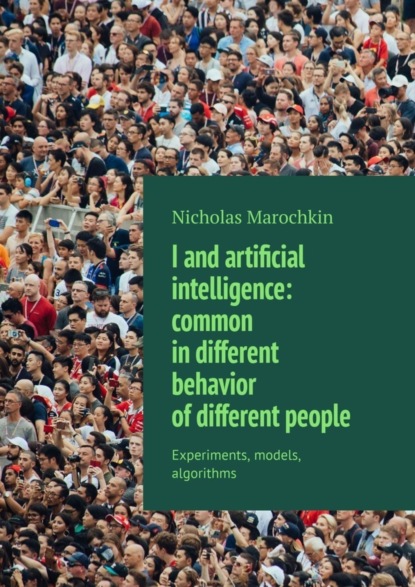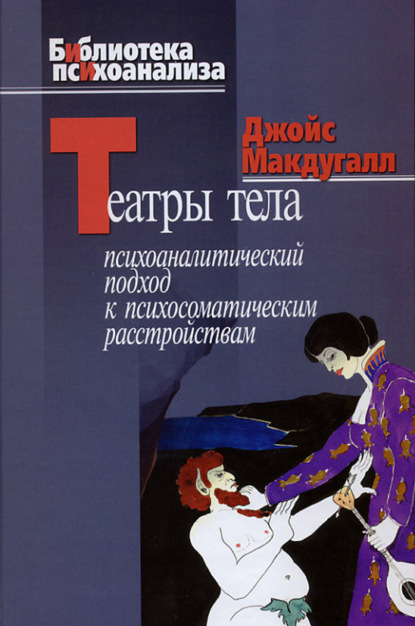Zwischen Gartenbau und Gartenkunst: Gärtner und Gartengestalter in Wien und Umgebung 1918–1945
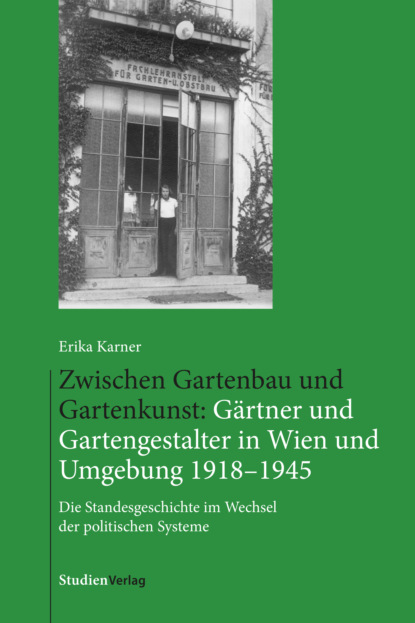
- -
- 100%
- +
2.5 Nachkriegszeit
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der damit einhergehenden Zerstörung waren der Wiederaufbau und das Herstellen von „Normalität“ wichtig für das weitere Zusammenleben in Österreich.
Auf politischer Ebene kam es zur Wiedereinführung der Verfassung von 1920/29 und damit zum Versuch, das Leben dort fortzusetzen, wo es vor Hitler aufgehört hatte. Dadurch konnten die alten Eliten rasch wieder Fuß fassen.286 Eine Neuerung der Zeit war die Etablierung einer stabilen Sozialpartnerschaft und die daraus folgende rasche Neubildung von Interessenverbänden. Ernst Hanisch beschrieb, wie leicht dieser Übergang in manchen Berufsgruppen fiel:
„Bei der Handels- und Landwirtschaftskammer gelang der Sprung vom ‚Dritten Reich‘ in die Zweite Republik ziemlich reibungslos – über die Salzburger Handelskammer wird berichtet: ‚Die Beamten versahen wie selbstverständlich ihren Dienst und nicht einen Tag ist der Parteienverkehr abgerissen.‘ Nur der Reichsadler und das Hakenkreuz wurden aus dem Stempel herausgeschnitten.“287
Zwei wichtige Fragen stellten sich in der nun folgenden Zeit: die des Umgangs mit ehemaligen Mitgliedern der NSDAP und das Problem der Restitution von Vermögenswerten an die noch lebenden Juden bzw. deren Erben.
Auch einige bekannte Gartenarchitekten fanden sich nun auf den Registrierungslisten für Nationalsozialisten und vertriebene jüdische Gärtner versuchten ihre Vermögenswerte wiederzuerlangen.
2.5.1 „Entnazifizierung“
Der Begriff „Entnazifizierung“ bzw. das US-amerikanische Original „denazification“ ist eine Wortkreation, entwickelt im politischen Beraterstab des US-Generals und späteren US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower.288 Der Begriff umfasste ursprünglich folgende Aufgabengebiete: Auflösung der NSDAP, Entfernung des Nationalsozialismus aus Gesetzen und Verordnungen, Abschaffung von NS-Symbolen, Straßennamen und Denkmälern, Beschlagnahme des Vermögens und der Unterlagen der NSDAP, Internierung von NS-Führern, Verbot von aus der NSHerrschaft herrührenden Privilegien, Ausschluss von mehr als nur nominellen Mitgliedern der NSDAP vom öffentlichen Leben, Unterbindung von NS-Indoktrination in jeder Form und Verbot von Paraden und NS-Demonstrationen.289 In Österreich verstand man unter dem Begriff „Entnazifizierung“ meist die Entfernung von „Reichsdeutschen“ aus beruflichen Positionen.290
In Wien gingen unmittelbar nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs Wiener Lokalstellen an die Registrierung von Nationalsozialisten. Diese sogenannten „Vorregistrierungen“ erfolgten ohne gesetzliche Grundlage und wurden von der vom Bürgermeister damit betrauten Magistratsabteilung abgelehnt.291
Der Historiker Dieter Stiefel unterteilte die Entnazifizierung in Österreich im zeitlichen Ablauf in fünf Phasen, in denen er die Verfahren der Besatzungsmächte und der österreichischen Behörden getrennt darstellte:
„1. Von April 1945 bis Juni 1945, die militärische Sicherheitsphase, in der hauptsächlich Internierungen durch die Alliierten vorgenommen wurden.
2. Von Juni 1945 bis Februar 1946, die Phase der autonomen Entnazifizierung durch die Alliierten. In dieser Phase versuchten fünf verschiedene Instanzen (die österreichische Regierung und die vier Besatzungsmächte) in den einzelnen Besatzungszonen die Entnazifizierung durchzuführen, was zu Überschneidungen und widersprüchlichen Maßnahmen führen musste.
3. Von Februar 1946 bis Februar 1947, die Phase der österreichischen Entnazifizierung auf Grund der Gesetze von 1945 (Verbotsgesetz, Wirtschaftssäuberungsgesetz und Kriegsverbrechergesetz). Im Februar 1946 wurde der österreichischen Regierung die Entnazifizierungskompetenz für das ganze Land übertragen, die Alliierten zogen sich auf eine Kontrollfunktion zurück. Die Ergebnisse dieses autochthonen Entnazifizierungsprozesses waren jedoch auch unbefriedigend.
4. Von Februar 1947 bis Mai 1948, die Phase der österreichischen Entnazifizierung auf der Grundlage des Gesetzes von 1947. In dieser Phase wurden die vorgegebenen Entnazifizierungsmaßnahmen durchgeführt und abgeschlossen.
5. 1948 bis 1957, die Zeit der Amnestien.“292
In Österreich gab es nach Beendigung des Krieges 536.662293 NSDAP-Mitglieder, das entsprach in etwa acht Prozent der Wohnbevölkerung.294 Zwei Drittel dieser Personen sahen sich selbst als Ausnahmen und stellten sich als „gute Menschen“ dar.295
Der Historiker Ernst Hanisch betrachtete die Ergebnisse der Entnazifizierung zwiespältig. Während es in der ersten Phase zu einem Elitentausch kam, „das nationalsozialistisch durchsetzte Bürgertum verlor kurzfristig seine Positionen“, ergaben sich bald entgegengesetzte Ziele: „das Ziel des wirtschaftlichen und politischen Wiederaufbaues, das Fachkräfte einforderte, und das Ziel der Entnazifizierung, das einen großen Teil der Fachkräfte entfernte.“296
Ab 1946 schuf der Kalte Krieg ein neues Feindbild, den Kommunismus, das es zu bekämpfen galt. Eine Aufgabe, der ehemalige Nationalsozialisten etwas abgewinnen konnten. Für Ernst Hanisch war das, neben anderen, ein Grund für die „Minderbelastetenamnestie von 1948 (480.000 Betroffene)“, in weitere Folge „wirkte der Konkurrenzdruck der Parteien zugunsten der ehemaligen Nationalsozialisten“ und die „Parteien suchten sich bei der raschen Durchsetzung der Gnadengesuche zu überflügeln“.297
Im österreichischen Parlament wurde nun zusehends die Meinung vertreten, dass es in einer Demokratie auf Dauer unerträglich sei, Bürger zweiter Klasse zu haben. Als Konsequenz daraus wurde mit der Eingliederung ehemaliger Nationalsozialisten in die Gesellschaft begonnen. Als Erfolg der Entnazifizierung bewertete Hanisch, „dass sich keine offene faschistische Partei wie in Italien bilden konnte“, dafür bildete sich neben der offiziellen antinazistischen Position „eine graue Zone des heimlichen Einverständnisses mit dem Nationalsozialismus heraus (so schlecht war das gar nicht; Übertreibungen sind gewiß passiert; es war eben Krieg…), von Traditionsverbänden gestützt, die jede ehrliche Diskussion der NS-Problematik blockierte“ und die ehrliche Aufarbeitung der Zeit lange verhinderte.298
Unter den Gartenarchitekten gab es mehrere NS-Registrierte:
• Albert Esch wurde zwar in die Registrierungsliste eingetragen, jedoch mit Bescheid vom 2. Dezember 1947 aus der Liste gestrichen;299
• Wilhelm Hartwich wurde nach seiner Rückkehr aus jugoslawischer Kriegsgefangenschaft 1947 in die NS-Registrierungsliste eingetragen, als „minderbelastet“ eingestuft und mit Bescheid vom 20. Juni 1949 amnestiert;300
• Eduard Ihm wurde nach seiner Entlassung aus englischer Kriegsgefangenschaft in Wien in die Registrierungsliste 61/47/IX eingetragen und als „minderbelastet“ eingestuft. Die Streichung aus der Liste erfolgte 1950;301
• Viktor Mödlhammer wurde 1946 als Nationalsozialist registriert, als „minderbelastet“ eingestuft und musste Sühneabgabe leisten. Es ist unklar, wann Mödlhammer aus der Liste gestrichen wurde, laut A.V. vom 5. März 1952 war er in der Registrierungsliste des 7. Bezirkes mit der Nummer 398/Okt. 48 eingetragen;302
• Otto Trenkler wurde in die NS-Registrierungsliste eingetragen und als „belastet“ eingestuft; er erhob Einspruch und sollte mit Bescheid vom 17. November 1947 aus der Liste gestrichen werden. Die Kommunistische Partei Österreichs erhob Einspruch gegen diesen Bescheid. Das darauffolgende Verfahren wurde im November 1949 im Sinne Trenklers entschieden;303
• Josef Oskar Wladar wurde in die NS-Registrierungsliste eingetragen und als „minderbelastet“ eingestuft, musste Sühneabgabe leisten und war zumindest bis 4. April 1950 rechtskräftig in dieser Liste verzeichnet. Der Zeitpunkt der Streichung oder Amnestie ist unklar.304
2.5.2 Restitution
Nach Kriegsende wurde nach Wegen gesucht, mit den in Österreich während der NS-Zeit stattgefundenen Beraubungen umzugehen.
Die Haltung Österreichs war zwiespältig. Einerseits betrachtete man sich als „Opfer“ und berief sich darauf, dass Österreich in der Zeit von März 1938 bis April 1945 kein souveräner Staat mehr gewesen sei und daher grundsätzlich keine Haftung oder Verantwortung für Verbrechen aus diesem Zeitraum übernehme. Andererseits erklärte die Regierung „diskriminierende Gesetze und auch darauf basierende Rechtsgeschäfte, die unter dem Druck rassischer und politischer Verfolgung in diesem Zeitraum zustande gekommen waren, für null und nichtig“, womit der Wille bekundet wurde, Opfer wieder in ihre Rechte einzusetzen.305
Die für die Restitution von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen wesentliche Rechtsgrundlage bildeten die ersten drei Rückstellungsgesetze: das Erste Rückstellungsgesetz, das der Nationalrat am 26. Juli 1946 verabschiedete, regelte die Rückstellung entzogener Vermögen, die sich in der Verwaltung des Bundes oder der Bundesländer befanden.306 Das Zweite Rückstellungsgesetz, das am 6. Februar 1947 verabschiedet wurde, behandelte die Rückstellung entzogener Vermögen, die sich auf Grund von Vermögensverfall im Eigentum der Republik befanden. Am gleichen Tag, an dem das Zweite Rückstellungsgesetz beschlossen wurde, verabschiedete der Nationalrat auch das Dritte Rückstellungsgesetz, dem gemeinsam mit dem Ersten Rückstellungsgesetz für die Rückstellung entzogener Liegenschaften die größte Bedeutung zukommen sollte.307 Dieses Gesetz bezog sich auf Vermögensentziehung durch Privatrechtsgeschäfte zwischen – bedingt durch die politischen Verhältnisse des vorangegangenen Zeitraums – ungleichen Vertragspartnern. Besonders der Verabschiedung des zuletzt genannten Gesetzes waren langwierige Diskussionen vorangegangen, die die Beschlussfassung durch das Parlament monatelang verzögerten.308
Tatsächlich wurden diese Gesetze oft nur halbherzig oder in sehr bürokratischer Weise vollzogen, sodass viele Opfer bei dem Versuch, ihr geraubtes Vermögen wiederzuerlangen, Kompromisse zulasten ihrer Ansprüche eingehen oder im Falle von Bargeld, Autos, Kunstsammlungen etc. gänzlich darauf verzichten mussten.309
Die vertriebenen jüdischen Gärtnerinnen Hanny Strauss und Yella Hertzka beantragten die Restitution ihrer Vermögenswerte, erlebten die Rückgabe jedoch persönlich nicht mehr. Einzig Helene Wolf erhielt ihre, unter Zwang an ihren „arischen“ nunmehrigen Ex-Ehemann verkauften Grundstücke restituiert und konnte verkaufen. Zu diesem Zweck kam sie Anfang der 1960er-Jahre aus den USA nach Österreich, kehrte jedoch nach dem erfolgreichen Geschäftsabschluss nach Kalifornien zurück.310
2.6 Zusammenfassung
Der am Beginn des Betrachtungszeitraums stehende Zerfall der Habsburger-Monarchie ging einher mit großen territorialen Verlusten ebenso wie mit einem, in heutiger Zeit unvorstellbaren, Bedeutungsverlust des Staates Österreich – von der europäischen Großmacht zum Zwergstaat.
Die territoriale und politische Neuordnung Europas führte in Österreich zur Republiksgründung, gepaart mit dem Wunsch, sich an Deutschland anzuschließen – dies wurde jedoch im Friedensvertrag von Saint Germain untersagt. Das Trauma der Bedeutungslosigkeit wirkte noch lange im kollektiven Bewusstsein der Bürger nach.
Für die Gärtner bedeutete das Ende der Monarchie auch das Aus für die Berufsgruppe der Herrschaftsgärtner und einer besonderen Form der Weiterbildung, nämlich des praktischen Austausches im Rahmen von Arbeitsaufenthalten auf verschiedenen Besitzungen ihrer Arbeitgeber. Mit der Abschaffung des Adels verloren die Gärtner zudem nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Förderer des Berufsstandes.
In Österreich gab es in den ersten Jahren der neuen Republik, getragen durch die Vormachtstellung der Sozialdemokratie auf Bundesebene, beachtliche sozialpolitische Fortschritte. Die neu geschaffenen Arbeits- und Sozialgesetze hatten auch für Gärtnereiarbeiter in gewerblichen Betrieben Geltung und verhalfen ihnen zu sozialer Absicherung und, im Falle der Landschaftsgärtner, zu Kollektivverträgen.
Nach dem politischen Wechsel auf Bundesebene – die Christlich-Sozialen hatte ab 1920 die Mehrheit – wurde das „sozialpolitische Experiment“ im „Roten Wien“ fortgeführt. Hier gelang es durch den kommunalen Wohnbau, die drückende Wohnungsnot zu lindern und wirtschaftliche Impulse zu setzen. Ermöglicht wurden diese Schritte durch die Loslösung Wiens von Niederösterreich und dem 1922 erlangten Bundesländerstatus, mit dem das Steuerfindungsrecht verbunden war. Die Politik des sozialdemokratischen Wien bildete damit ein Gegenmodell zur christlich-sozialen Politik auf Bundes- und Länderebene.
Die österreichweite schlechte Wirtschaftslage und der damit einhergehende Währungsverfall verbesserten sich mit Hilfe der „Völkerbundanleihe“ und der Währungsumstellung langsam. Die unabhängig davon weiter bestehende schlechte wirtschaftliche Situation der Gartenbaubetriebe, die meisten davon Gemüseanbaubetriebe, lag zum Teil am geringen Mechanisierungsgrad, der geringen Kapitalausstattung, unsicheren Pachtverhältnissen und der mangelhaften fachlichen Ausbildung der Inhaber und ihrer Mitarbeiter. Die der Sozialdemokratie nahestehenden Branchenvertreter sahen einen Lösungsansatz in der Regulierung und Steuerung der Produktion, also einer Planwirtschaft – dies wurde jedoch von den Christlich-Sozialen strikt abgelehnt, die ihrerseits die „hohen sozialen Lasten“, geschaffen durch die neuen Gesetze, als ein Grundproblem sahen und zudem Einfuhrbeschränkungen bei gärtnerischen Produkten sowie Zölle verlangten.
Mit der Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre verschärfte sich die Situation der Gärtner zusätzlich. Die Gemüseproduzenten hatte Mühe, ihr Gemüse zu verkaufen, da aufgrund der stark gestiegenen Arbeitslosigkeit die Zahl der potenziellen Kunden sank; Gemüseimporte brachten zusätzliche Konkurrenz. Auch die Gartenarchitekten waren von der Krise betroffen, die Auftragslage war schlecht und renommierte Firmen wie die von Wilhelm Debor oder Albert Esch mussten Ausgleich anmelden. Sogar die damals größte Privatgärtnerei in Wien, die Rothschild-Gärtnerei, war gezwungen, Gärtner zu entlassen und Teile der Anlage zu schließen.
Die Arbeits- und Sozialgesetze stellten eine bedeutende sozialpolitische Verbesserung dar und erleichterten die Lage der zum Gewerbe gehörigen Gärtnereigehilfen zumindest auf dem Papier; in der Praxis war die Umsetzung oft schwierig. Acht-Stunden-Tag und Krankenversicherung, Arbeitslosengeld und Pensionssystem gab es für die Beschäftigten im Bereich der Landwirtschaft nicht. Von der hohen Arbeitslosigkeit waren die Gärtnereiarbeiter doppelt betroffen: erstens durch die wiederkehrende saisonale Arbeitslosigkeit und zweitens durch die hohe Arbeitslosigkeit aufgrund der schlechten Wirtschaftslage.
Die Machtübernahme durch Engelbert Dollfuß war begleitet von einem Verbot aller politischen Parteien, massivem Sozialabbau und der Ausschaltung demokratischer Strukturen einerseits und einer Bedeutungssteigerung der Landwirtschaft andererseits. Die geplante berufsständische Ordnung konnte nur in Ansätzen verwirklicht werden. In Wien kam der kommunale Wohnbau zum Erliegen, und Bürgermeister Schmitz versuchte durch Investitionen im Straßenbau (Höhenstraße, Wientalstraße), realisiert mit Hilfe des „Freiwilligen Arbeitsdienstes“, gegenzusteuern. Die Gartenarchitekten und Gartengestalter sahen darin unlautere Konkurrenz, konnten sich jedoch aufgrund der geringen Bedeutung ihres Gewerbes nur schlecht dagegen wehren.
Eine weitere bedenkliche Entwicklung dieser Zeit stellte der wachsende Antisemitismus dar.
Mit dem „Anschluss“ änderte sich die Situation, die hohe Arbeitslosigkeit wurde durch die anlaufende Rüstungsindustrie und die Vertreibung von Juden aus der Arbeitswelt stark gesenkt. Die drängende Wohnungsnot wurde infolge von Vertreibung und Deportation ebenfalls gemildert, aber nicht wie ursprünglich versprochen durch ein neues Wohnbauprogramm gelöst.
Viele Österreicher versuchten aus unterschiedlichen Gründen NSDAP-Mitglieder zu werden und entgegen späteren Aussagen erfolgte der Beitritt freiwillig. Die Antragsformulare mussten eigenhändig unterschrieben werden, Aufnahmen ohne eigenes Wissen waren demzufolge nicht möglich.
Die jüdische Bevölkerung hatte massiv unter den neuen Machthabern zu leiden. Neben dem Berufsverbot und den „Arisierungen“ jüdischer Betriebe (auch Gärtnereien) trug der Vermögensentzug rasch zur Verarmung der Betroffenen bei. Die zu Beginn des Dritten Reiches forcierte Auswanderung und die später immer weiter eingeschränkten Ausreisemöglichkeiten der jüdischen Bevölkerung wurden begleitet von „Umschichtungskursen“ der IKG mit dem Ziel, die Ausreisewilligen mit handwerklichen Fähigkeiten auszustatten, die ihnen in ihren Zielländern ein Überleben erleichtern sollten. Neben Kursen für holz- und metallbearbeitende Berufe wurden in Wien Kurse in Hauswirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau angeboten.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs standen neben dem Wiederaufbau die Fragen der Entnazifizierung und der Restitution ganz oben auf der politischen Agenda.
So rasch die Wiedereingliederung ehemaliger registrierter Nazis erfolgte – bereits 1948 wurden 480.000 „Minderbelastete“ amnestiert, weitere Amnestien folgten –, so schleppend kam die Gesetzgebung in Sachen Restitution voran. Im Juli 1946 wurde ein erstes und im Februar 1947 ein zweites und drittes Rückstellungsgesetz verabschiedet. Die eigentliche Restitution entzogener Vermögenswerte ist jedoch bis heute nicht abgeschlossen, wie zahlreiche in den Medien kolportierte Fälle belegen.
______________
24 Sandgruber, 2003, S. 30.
25 Eigner, 1999, S. 132.
26 Pfeiffer, 1894, S. 1–27; Pfeiffer, 1905, S. 13.
27 Solkim, 1905, S. 354.
28 Solkim, 1905, S. 355 ff.
29 Wibiral, 1908, S. 1.
30 Erich Wibiral (* 1878 in Herzogenburg, NÖ, † 24. Juli 1950 in Graz).
31 Unter „neuer Mode“ versteht Wibiral die zunehmende Beliebtheit von formal gestalteten Gärten.
32 Wibiral, 1908, S. 3.
33 Wibiral, 1908, S. 3. Anmerkung der Redaktion.
34 Alfred R. Benesch berichtete in seinem am 6. April 2011 im Rahmen der Generalversammlung der ÖGHG gehaltenen Vortrag „Aktuelle Maßnahmen bei der Revitalisierung im Schlosspark Artstetten (NÖ)“ über die Praxis des „Verborgens“ von Gärtnern.
35 TU Berlin: http://gartentexte-digital.ub.tu-berlin.de/gaertnerbiographien/gaertnerbiographien.pdf [Stand 12.02.2014].
36 Sobischek, 1914, S. 21.
37 o.V.: Grüße aus dem Felde, in: Allgemeine Gärtner Zeitung, XXII, 10.1915, S. 53.
38 o.V.: Nachrichten über Feldzugsteilnehmer, in: Gartenkunst, 29, 2.1916, Beilage S. 1–2.
39 BArch (ehem. BDC), RK B38 Anton Eipeldauer 1893.
40 Karner, 2012, S. 12.
41 Österreichische Gartenzeitung, 10, 1915, S. 47 f.
42 Auer, 1929, S. 74.
43 A.C., 3.1917, S. 85.
44 Wiener Illustrirte Gartenzeitung, XXVI., 1901, Heft August – September, S. 327 f.
45 Wiener Illustrirte Gartenzeitung, XXVI., 1901, Heft Mai, S. 205.
46 Urban, 1995, S. 23.
47 Eigner, 1999, S. 132.
48 Sandgruber, 2003, S. 43.
49 Sandgruber, 2003, S. 43.
50 Sandgruber, 2003, S. 43.
51 Sandgruber, 2003, S. 43.
52 Eigner, 1999, S. 132.
53 Hanisch, 2005, S. 291.
54 „Reliefkredite“ waren Unterstützungskredite, die Österreich von den Siegerstaaten des Ersten Weltkrieges, aber auch von einigen neutralen Staaten gewährt wurden. Sie wurden Österreich gleich nach Kriegsende zur Überwindung der Hungersnöte bereitgestellt. Mehr dazu bei: Berger Peter: Im Schatten der Diktatur, Böhlau Verlag, Wien, 2000; und Schüller, Richard: Unterhändler des Vertrauens, Verlag für Geschichte und Politik, Wien, 1990.
55 Eigner, 1999, S. 133 f.
56 Hanisch, 2005, S. 282.
57 Hanisch, 2005, S. 283.
58 Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Währungsreformen_in_Österreich [Stand 20.02.2012].
59 Hanisch, 2005, S. 295 ff.
60 Gemeint ist damit die Sanierung des von Salomon Meyer Freiherr von Rothschild im Jahr 1820 gegründeten Bankhauses Creditanstalt, das am 11. Mai 1931 seine Zahlungsunfähigkeit erklären musste. Die Creditanstalt hatte ihrerseits bereits 1929 auf Druck der Regierung Schober die Verpflichtungen der schwer angeschlagenen Boden-Credit-Anstalt übernehmen müssen.
61 Eminger, 2005, S. 93 f.
62 Ignotus, 1924, S. 89.
63 o.V.: Der Gartenbau im Auslande. Deutsch-Oesterreich, in: Die Gartenwelt, 28, 25.1924, S. 280.
64 Baumgartner, 6.1928, S. 3.
65 Tabelle erstellt nach Baumgartner, 6.1928, S. 3.
66 Mayer, 3.1927, S. 5.
67 Steyskal, 5.1927, S. 13.
68 Stowasser, 4.1929, S. 1 f.
69 Pollanetz, 1927, S. 254.
70 Stowasser, 4.1929, S. 1 f.
71 Böhm, 5.1929, S. 4 f.
72 Der Erwerbsgärtner, 3, 10.1929, S. 1.
73 Als öffentliche Vertreter anwesend waren unter anderem: Dr. Karl Luxarda vom Bundesministerium für Finanzen, Dr. Wobisch vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Kammerrat Strakosch und Kommerzialrat Heurtisch von der Handelskammer, der niederösterreichische Landeshauptmann Dr. Buresch, der niederösterreichische Landwirtschaftskammerpräsident Josef Reither, Franz Riederer vom österreichischen Land- und Forstarbeiterverband, Josef Häusler von der österreichischen Land- und Forstwirtschaftsgesellschaft, der Geschäftsführer der Wiener Landwirte Matthäus Steinlechner, als Vertreter der burgenländischen Landesregierung Theodor Dorasil, als Vertreter der christlich-sozialen Partei Otto Volker, als Vertreter der sozialdemokratischen Partei Hans Hammerstorfer, als Vertreter der großdeutschen Volkspartei Nationalrat Zarbach, als Vertreter des christlich-sozialen Nationalratsklubs Minister a.D. Buchinger sowie Vertreter der Presse. (Der Erwerbsgärtner, 3, 10.1929, S. 1).
74 Böhm, 10.1929, S. 2.
75 Böhm, 10.1929, S. 4.
76 Der Erwerbsgärtner, 4, 3.1930, S. 1.
77 Walla, 1933, S. 1.
78 Archiv der WKÖ, Gewerbeschein Debor.
79 Archiv der WKÖ, Gewerbeschein Esch.
80 Archiv der WKÖ, Gewerbeschein Hartwich.
81 Archiv der WKÖ, Gewerbeschein Vietsch.
82 F.R., 2.1934, S. 3.
83 o.V.: Gartenbau im Auslande: Deutsch-Österreich, in: Die Gartenwelt, 35, 48.1931, S. 671.
84 Eigner, 1999, S. 137.
85 Eigner, 1999, S. 138.
86 Maderthaner, 2006, S. 348 f.
87 Chaloupek, 1991, S. 498.
88 Weihsmann, 2002, S. 26 f.
89 Chaloupek, 1991, S. 499.
90 Weihsmann, 2002, S. 25 f.
91 Pelinka, 2005, S. 24.
92 Maderthaner, 2006, S. 362.
93 Chaloupek, 1991, S. 500.
94 Seliger, 2005, S. 163.
95 Sandgruber, 2005, S. 347.
96 Hanisch, 2005, S. 276 f.
97 Allgemeine Österr. Gärtner-Zeitung, 8, 6–5.1932, S. 2 ff.
98 Weber, 1981, S. 613 f.
99 Stiefel, 1979, S. 29 (zit. nach Weber, 1981, S. 614).
100 Stiefel, 1979, S. 29 (zit. nach Weber, 1981, S. 614).
101 Tálos, 2005, S. 224.
102 Allgemeine Österr. Gärtner-Zeitung, 2, 1.1926, S. 7.
103 Allgemeine Österr. Gärtner-Zeitung, 3, 3.1926, S. 4 f.
104 Allgemeine Österr. Gärtner-Zeitung, 6, 2.1930, S. 1.
105 Allgemeine Österr. Gärtner-Zeitung, 8, 6–7.1932, S. 3.
106 Tálos/Manoschek, 2005, S. 16 f.
107 Tálos/Manoschek, 2005, S. 18 f.
108 Tálos, 2005, S. 222 ff.
109 Tálos, 2005, S. 234.
110 Eigner, 1999, S. 150.
111 Tálos, 2005, S. 404.
112 Ausführliche Biografien dieser Männer in Kap. 7.2.
113 Haas, 1988, S. 2.
114 Tálos, 2005, S. 127 f.
115 Tálos, 2005, S. 137.
116 Dabei kann nicht von einem „echten Berufsstand“ gesprochen werden, da es sich bei öffentlich Bediensteten ausschließlich um Arbeitnehmer, also unselbstständig erwerbstätige Personen, handelte und die Zusammenführung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern somit nicht gegeben war.