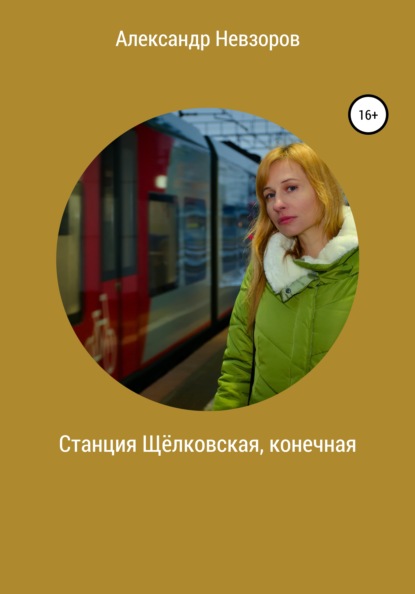- -
- 100%
- +
Zumindest in anderer Hinsicht begann ich ihm zu glauben. Denn inzwischen hatte der Beladevorgang begonnen. Tatsächlich sollten alle 250 Menschen auf das Schiff. Wie sollte das funktionieren? Die Barkasse hatte am Bug einen kleinen Raum, in dem normalerweise Taue untergebracht wurden. Er war kaum mehr als einen Meter zwanzig hoch und umfasste keine sechs Quadratmeter. Die Schlepper pferchten über 20 Menschen dort hinein. Außerdem gab es auch über der Bilge, direkt vor dem Motor noch Platz. Wir wurden in dieses Untergeschoss verfrachtet. Ich hörte Gabriel nur leise fluchen. Ich wusste auch, was ihm Sorge machte. Sollte das Schiff in Seenot geraten, wären wir die letzten, die hier herauskämen.
›Es hat auch etwas Gutes. Das Schiff hat keine Sonnensegel und wir haben Juli. Das wird ganz schön heiß da oben‹, versuchte ich ihm Mut zu machen. Doch als wir dort unten eingepfercht wurden, bereute ich schon wieder, was ich gesagt hatte. Wir hatten kaum noch Platz uns zu bewegen. Es war eng und stickig und natürlich kroch die Hitze auch schnell durch alle Ritzen hier herunter. Unter der Bilge sammelte sich öliges, brackiges Wasser.
Der Motor sprang an und erfüllte den Raum mit einer infernalischen Geräuschkulisse, einem Krach, den wir jetzt die nächsten Tage ertragen mussten. Außerdem gab nirgendwo ein Klo. Selbst wenn es eines gegeben hätte, man hätte es nicht erreichen können. So dicht waren die Menschen gestapelt. Ich hatte in einem Museum in Dakar einmal die Zeichnung vom Inneren eines Sklavenschiffes gesehen. Das unterschied sich nicht sehr von unserer Situation. So etwa stellte ich mir den Vorhof der Hölle vor.
Immerhin: Jeder von uns hatte eine Zweiliterflasche Wasser erhalten. Das war offensichtlich nicht gerade üblich, aber wir hatten keine Ahnung, wie lange das Wasser vorhalten sollte. Also versuchten wir, sehr sparsam damit umzugehen.
Gabriel, der neben mir saß, atmete schwer. Ich tippte ihn an. Er reagierte nicht.
Besorgt fragte ich, indem ich ihn laut anschrie, um den Diesel zu übertönen: ›Was ist?‹
›Jich … jich, jich krieg keine Luft‹, japste er. Gabriel war im Begriff, einen Panikanfall zu bekommen. Ich wollte Iris um Rat fragen, doch da war es schon geschehen. Er versuchte, aufzuspringen und an die Luke zu kommen.
›Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich ersticke … ich ersticke.‹ Tatsächlich gelang es ihm, bis an die Luke zu kommen und sie auch aufzustemmen. Doch kaum war sie geöffnet, trat ihm jemand mit dem Fuß voll ins Gesicht, so dass er wieder rückwärts zurückfiel. Wir betteten ihn vorsichtig zwischen uns. Aus seiner Nase quoll ein heftiger Blutstrom. Irgendwie gelang es Iris, die Blutung zu stoppen. Immerhin hatte er so kurz das Bewusstsein verloren und vergaß seine Panik wenigstens für den Moment.
Er erwachte wieder und tatsächlich konzentrierte er sich zunächst auf seinen Schmerz. Doch bald bemerkte er wieder, wo er eigentlich war und begann erneut schwer zu atmen. Er hechelte immer mehr und plötzlich verlor er wieder das Bewusstsein. Sein Atem setzte aus. Doch Iris wusste genau, was zu tun war.
›Hyperventilation‹, erklärte sie mir. ›Wenn du das in der Panik zu heftig machst, kommt von hinten der kleine Mann mit dem Hammer.‹ Sie setzte zu einer Mund-zu-Mund-Beatmung an. Und Gabriel fing tatsächlich wieder an zu atmen.
Obwohl die Situation sehr aufregend war, überfiel mich auf einmal eine entsetzliche Müdigkeit, verbunden mit bohrenden Kopfschmerzen. Trotzdem verfiel ich plötzlich in Schlaf.
Jemand ohrfeigte mich. Ich konnte die Augen nicht öffnen, weil ein gleißendes Licht mich blendete. Im ersten Moment glaubte ich, ich sei tot. Aber ich glaube nicht, dass man unmittelbar nach dem Sterben mit Ohrfeigen im Jenseits empfangen wird. Ich hörte eine Stimme sagen: ›Der ist okay, seine Frau auch, aber ich glaube, den Kleinen hat’s erwischt. Komm, raus mit ihm und über Bord, dann haben die anderen hier mehr Platz.‹
Später habe ich dann erfahren, was passiert ist. Der Bilgenraum war nur unzureichend durchlüftet. So war es zu einer schleichenden Kohlenmonoxidvergiftung gekommen. Gabriel hatte mit seiner Hyperventilation die Situation für sich nur noch extrem verschlimmert. Er war schließlich kläglich erstickt. Das Schicksal teilte er mit fünf anderen, die dort unten zusammengepfercht saßen. Alle waren sie an der schlechten Luft erstickt. Es war nur einem großen Zufall zu verdanken, dass man uns entdeckt hatte, sonst wären wir alle da unten in dieser Barkasse elendiglich draufgegangen.
Nun blieb die Luke stets halb geöffnet, damit der Raum hier unten auch durchlüftet wurde. Das war einerseits gut, weil wir so ständig frische Luft bekamen, andererseits auch wieder nicht so gut, weil ich am fünften Tag unserer Reise das Unglück auf uns zukommen sah. Die ersten Tage war das Mittelmeer so ungewöhnlich glatt wie selten. Es schien, als schippere da ein Boot über einen Ententeich. Doch am vierten Tag spürten wir schon einige Wellen. Noch war das Stückchen Himmel, das wir durch die Luke sehen konnten, strahlend blau, doch tags darauf hatte er sich in ein schweres, eisgraues Laken verwandelt, das von Minute zu Minute dunkler wurde. In gleichem Maße wuchsen die Wellen. Manchmal ging es wie in einem Fahrstuhl rasant nach oben, nur um im nächsten Moment wieder ins Bodenlose zu fallen. Die Ersten begannen sich zu übergeben, mit der Folge, dass es nun immer mehr wurden.
Ich dachte mit Schrecken an die morschen Holzplanken. Wie sollte so ein marodes Schiff solch einen Sturm überstehen? Immer häufiger schwappten nun auch große Wellen durch die Luke in den Bilgenraum. Doch nicht nur von dort, von überall schien nun Wasser einzudringen. Wir mussten hier unten raus. Lange konnte es nicht mehr gutgehen. Das Schiff nahm immer mehr Wasser auf. Es war bereits knöcheltief und stieg weiter. Allerdings war mir noch wohlbewusst, was dem armen Gabriel passiert war, als er versucht hatte, den Kopf aus der Luke zu strecken. Egal, ich musste es riskieren. Ich deutete Mo und Iris an, mir zu folgen. Dann kletterte ich die Stufen hoch, immer darauf gefasst, dass jemand nach meinem Kopf treten würde. Doch nichts passierte. Oben an Deck war der Teufel los. Die Menschen schrien und heulten. Sie hielten sich gegenseitig umklammert. Von der Mannschaft war weit und breit nichts zu sehen. Das Schiff war führerlos und das mitten im Sturm. Es bestand nicht nur die Gefahr, dass das marode Stück auseinanderbrechen konnte, es konnte auch jeden Moment kentern.
Diese Barkasse war den Fischerbooten meiner Heimat einigermaßen ähnlich. Ich hatte schon früh von meinem Vater gelernt, auch ein relativ kleines Boot durch hohe Wellen zu steuern. Ich kämpfte mich zu dem verwaisten Ruder durch und kam genau zur richtigen Sekunde an, denn gerade drohte die Barkasse sich seitwärts zu einer Welle zu drehen, was sie unweigerlich zum Kentern gebracht hätte.
Die Besatzung hatte schon vor Stunden, als der Sturm aufzog, das Schiff mit einem Schlauchboot mit starkem Außenborder verlassen. Die Komplizen, die sie auffischen würden, waren wohl längst informiert.
Ob wir das alles heil überstehen würden, konnte zu diesem Zeitpunkt keiner sagen. Ich suchte unter dem Steuer nach Rettungswesten. Zwei waren noch da – zwei für über 200 Menschen. Ich reichte eine an Iris, die andere an Mo.
›Und du?‹, fragte Iris entsetzt.
›Ich kann wenigstens schwimmen, und du?‹
Sie schüttelte den Kopf und auch Mo hatte nie schwimmen gelernt.
Es dämmerte langsam und noch immer kämpfte unsere tapfere kleine Barkasse gegen die Wellen an. Doch es war nur noch eine Frage der Zeit, wann die See sich das kleine Schiff holen würde. Vielleicht waren wir ja schon ganz in der Nähe der italienischen Küste, vielleicht suchte auch schon ein Schiff der Küstenwache nach uns. Es gab viele Hoffnungen, an die ich mich klammern konnte, aber die Realität sah düster aus.
Es schien, als seien die Wellenberge kleiner geworden, doch so richtig war das in dem fahlen Licht nicht mehr zu erkennen. Es wurde immer schwerer nun gegen die Wellen zu fahren. Ich musste mich auf mein Gefühl verlassen. Noch immer war die Gefahr groß, dass das Schiff kentern würde, wenn wir quer zu Welle kommen sollten.
Inzwischen war ich völlig erschöpft. Es war Schwerstarbeit, das Boot mit der großen Ruderpinne auf Kurs zu halten. Mit einem Steuer wäre es wohl einfacher und weniger kräftezehrend gewesen. Trotz der Gischt, die immer wieder in mein Gesicht spritzte, trotz des ewigen Auf und Ab war ich so erschöpft, dass ich für einen Moment einnickte. In diesem Moment traf ein schwerer Brecher das Boot ein wenig schräg von der Seite. Ich wurde klatschnass. Gleichzeitig hörte ich den gellenden Schrei von Iris. Gerade hatte sie noch neben mir gesessen, doch der Platz war leer. Die Welle hatte sie über Bord gespült. Ich wollte umdrehen, wollte die Wasseroberfläche absuchen, doch inzwischen war es finstere Nacht. Ich hörte sie nicht schreien, sondern nur das Toben des Meeres. Sie war einfach verschwunden.
6. Kapitel
Es gibt noch freundliche Menschen, trotz des großen Elends.
Wieder herrschte Stille am Tisch. Keiner wagte es, das Wort an Souliman zu richten, dessen Blick jetzt wieder in einer unbestimmten Ferne haften blieb. Draußen wirbelten einige Schneeflocken durch die kalte Berliner Luft. Ein Handy klingelte. Es gehörte Mansur. Er zog es heraus und drückte den Anrufer weg, ohne überhaupt auf das Display geblickt zu haben. Etwa eine Stunde hatte er sich für die Geschichte von Souliman nehmen wollen. Nun saßen sie schon fast dreimal so lange hier zusammen. Keiner wagte es, an Aufbruch zu denken.
Souliman schüttelte sich, als wolle er für einen Moment die Vergangenheit loswerden, um sich gleich darauf wieder voll in sie zu stürzen.
Unser Boot sank nicht, obwohl ich in dem Moment, als ich realisierte, dass Iris im Meer verschwunden war, mir es sehnlichst gewünschte hätte, dass unser Schiff nun auch untergehen würde. Irgendwie überstanden wir auch noch die Nacht. Am nächsten Morgen strahlte die Sonne von einem strahlend blauen Himmel. Mir kam es vor, als wolle mich der Himmel verhöhnen. Das Schiff aber würde nicht mehr lange durchhalten. Es war so voll Wasser gelaufen, dass zwischen Bordkante und Wasser vielleicht nur noch ein oder zwei Handbreit lagen. Da hörten wir plötzlich ein Knattern und wenige Sekunden später tauchte auch der dazugehörige Hubschrauber auf. Eine Stunde später näherte sich eine Fregatte der italienischen Küstenwache.
Die Matrosen, die uns von Bord holten, waren hilfsbereit und freundlich. Es dauerte nicht lange, da hatten sie alle an Bord geholt. Vielleicht konnten wir Iris ja doch noch retten, schoss es mir durch den Kopf. Ich fragte einen der Matrosen, ob ich mit dem Kapitän sprechen dürfe. Er lachte nur und sagte ›Impossibile‹.
Plötzlich trat Mo, der stets schweigende Mo, neben mich und begann wie ein Wasserfall zu reden. ›Was glauben Sie, wer das ist, Sir?‹, fragte er den Matrosen auf Englisch. ›Ihm haben wir unser Leben zu verdanken, er ist nicht irgendwer. Wenn er nicht gewesen wäre, hätten Sie heute nur 200 Leichen aus dem Wasser fischen können. Wäre Ihnen das lieber gewesen, Sir? Der Mann ist ein Held.‹ Auch andere der Geretteten kamen nun hinzu und begannen, ein Loblied auf meine Heldentat zu singen.
Schließlich gab der Matrose nach. ›Schon gut, schon gut, ich werde euren Helden zu unserem Kapitän bringen.‹
Der Kapitän hatte einen struppigen Vollbart und trug einen Ohrring. Das fiel mir als erstes auf. Der Matrose erklärte dem Kapitän etwas auf Italienisch. Der nickte nachdenklich und schickte den Matrosen wieder weg.
›Du bist so etwas wie ein Held, hab’ ich gehört?‹
›Ich weiß gar nicht, warum.‹
›Wo kommst du her, mein Sohn?‹
Ich zögerte. Mir fielen die Worte von Gabriel wieder ein. Keinesfalls sollte ich sagen, dass ich aus dem Senegal käme, sonst würden sie mich im großen Käfig behalten und möglicherweise wieder zurückschicken. Ich holte tief Luft. ›Aus Dafur.‹
Er nickte gemächlich. ›Soso, in Dafur lernt mal also, wie man eine 15-Meter-Barkasse mit einer Ruderpinne durch sechs Meter hohe Brecher steuert. Respekt. Nein, mein Junge, du warst bisher genauso wenig in Dafur wie ich in der Kalahari.‹
Mir wurde heiß und kalt. Er hatte mich also sofort erwischt. Was sollte nun mit mir passieren? Eigentlich wollte ich ihn bitten, nach Iris zu suchen, doch das konnte ich nun vergessen.
›Es ist ein Jammer. Bist ein couragierter Bursche. Jemanden wie dich könnte ich glatt auf meiner Fregatte gebrauchen. Bist leider kein Italiener. So werden sie dich wahrscheinlich dahin zurückschicken, wo du herkommst. Gambia, Ghana? Ach, sag’s mir lieber nicht. Es ist allemal eine Schande, wie man mit euch armen Teufeln umgeht. Pass auf, ich geb’ dir einen Rat: Bleib bei deiner Geschichte und schärfe deinen Freunden ein, dass sie niemandem von deiner Heldentat erzählen. Dafür ist Dafur einfach viel zu weit vom nächsten Meer entfernt, als dass dir das jemand abnehmen würde. Du hast nichts gesagt, und ich muss ja niemandem sagen, was ich mir denke.‹
Ich war völlig verdattert über die unerwartete Wendung, so dass ich glatt vergaß, mich zu bedanken. Aber Iris vergaß ich nicht. ›Trotzdem, Herr Kapitän, ich habe noch eine Bitte. Meine Gefährtin ist in der Nacht über Bord gegangen. Vielleicht hat sie überlebt, sie trug eine Rettungsweste. Vielleicht kann ja Ihr Helikopter …‹
Er runzelte die Stirn. Mir schien, als bilde sich über seinen Augenbrauen eine kleine Gewitterwolke. Dann brummte er: ›Na, mal sehen. Wenn er noch genügend Sprit hat. Wann war das?‹
Ich musste raten, denn ich hatte kaum eine Vorstellung. Ich wusste nur, dass es rabenschwarze Nacht war. Ich sagte aufs Geratewohl: ›Gegen 23 Uhr.‹
Er nickte. ›Mal sehen, da hatten wir euch schon auf dem Radar, versprechen kann ich aber nichts, mein Sohn.‹
Neue Hoffnung keimte in mir auf. Ich war sicher, dass ich Iris spätestens am Nachmittag wieder in meine Arme schließen konnte. Doch bis wir im Hafen von Lampedusa einliefen, bekam ich keine Nachricht. Wir wurden die Gangway hinuntergeführt. Ich drehte mich um und sah den Kapitän auf der Brückennock stehen. Er zuckte mit den Schultern und schüttelte leicht den Kopf. Dann winkte er mir zum Abschied zu.
Ich hatte mir vorgestellt, dass alle Italiener, ja alle Europäer so freundlich waren wie der Kapitän der Küstenwache. Das war dann leider doch nicht so. Nachdem wir von Bord gegangen waren, wurden wir registriert, und es kam uns vor, als behandelten sie uns wie Vieh. Die Beamten bei der Registrierung waren unfreundlich. Überall standen bewaffnete Polizisten, die darauf achteten, dass keiner von uns flüchtete. Ich hatte Mo und den anderen eingeschärft, niemandem von meiner Rolle auf dem Boot zu erzählen. Stattdessen gab ich bei der Registrierung an, ein Flüchtling aus Dafur zu sein. Der Beamte füllte das Formular aus, ohne mich überhaupt näher anzusehen. Wenn ich sagte, ich käme aus Dafur, dann war das wohl auch so.
Die Bezeichnung Großer Käfig war nicht übertrieben. Ich hatte mir vorgestellt, dass es in Europa selbst bei einer Art Internierung bedeutend besser zugehen würde, als in Libyen. Doch die Verhältnisse waren genauso schlimm – mit dem Unterschied, dass wir nun im Knast saßen und offenbar niemand so genau wusste, was mit uns passieren sollte. Wir wurden von den Aufsehern schikaniert, von den Einwanderungsbeamten und eigentlich von allen, die mit uns zu tun hatten. Die Botschaft war klar: Ihr seid hier nicht willkommen. Auch untereinander wuchs die Aggressivität wieder beträchtlich. Manche Flüchtlinge saßen schon seit Monaten in dem Käfig. Keiner wusste, wie lange er hierbleiben würde.
Mo und ich hatten Glück. Wir mussten nur fünf Tage auf Lampedusa verbringen. Dann plötzlich wurden wir abgeholt. Ein Carabiniere brachte uns auf ein Schiff, auf dem bereits drei andere Flüchtlinge warteten. Wohin wollten sie uns bringen? Keine Antwort. Wir wurden von zwei Carabinieri begleitet. Sie brachten uns nach Messina auf den Bahnhof. Einer der beiden Beamten erklärte: ›Ihr habt jetzt fünf Tage, um das Land zu verlassen. Werdet ihr danach in Italien aufgegriffen, schicken wir euch zurück in eure Heimatländer. Also, wo wollt ihr hin?‹
Die anderen drei tuschelten und sagten etwas von Schweden. Ich fragte Mo: ›Deutschland?‹ Mo zuckte mit den Schultern und nickte. Der Carabiniere ging an den Schalter und sagte: ›Dreimal Malmö, zweimal München.‹
Zwei Stunden später saßen wir zu fünft in einem Abteil und tauschten unsere Geschichten aus. Die drei anderen hatten sich ebenfalls als Flüchtlinge aus Dafur ausgegeben. Tatsächlich kamen sie aus Mali. Sie hatten schon eine gescheiterte Flucht hinter sich. Vor zwei Jahren hatten sie es über die sogenannte Westroute über Marokko nach Spanien versucht. Doch sie scheiterten beim Versuch in die spanische Exklave Melilla zu kommen. Ich erfuhr, dass dort über 30 000 Menschen in einem Camp lebten, die alle irgendwie versuchen wollten, die sechs Meter hohen Zäune zu überwinden. Auch Marokko, so wurde gemunkelt, hatte schon Flüchtlinge in der Wüste ausgesetzt. Deshalb hatten es die drei dieses Mal über die mittlere Route versucht.
Ich wollte wissen, warum sie ausgerechnet nach Schweden wollten. Soweit ich wusste, lag Schweden so weit im Norden, dass dort ewig Schnee lag. Die drei anderen mussten lachen, als ich ihnen mein Schwedenbild zeichnete. So zeigten sie mir Fotos von Schweden, auf denen kein Krümelchen Schnee lag. Im Gegenteil. Alles war grün, lag im Sonnenschein. Nur die roten Häuschen fand ich ein wenig merkwürdig.
In Schweden, erklärte einer der drei, würden die Menschen einfach am besten behandelt. Ich wurde stutzig. ›Aber ich dachte, in Deutschland sei alles so einfach?‹ Wieder lachten die drei.
Mo indes meinte, ich sollte mich jetzt nicht verrückt machen lassen. Er habe Freunde in Berlin und irgendwie würde man ja schon von München nach Berlin kommen. Die Freunde würden uns sicher weiterhelfen. Die drei anderen wünschten uns grinsend viel Glück.
Wir redeten noch ein wenig miteinander, dann fielen wir einer nach dem anderen in einen tiefen Schlaf.
Es war früher Morgen, als der Zug in München einlief. Wir verabschiedeten uns von unseren drei Mitreisenden und stiegen aus. Wir waren völlig eingeschüchtert von der Größe, den Menschen, den Autos, aber irgendetwas mussten wir jetzt ja tun. Hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, hätte ich für mein allerletztes Geld eine Fahrkarte nach Berlin gekauft. Leider folgte ich dem Vorschlag von Mo. Er sagte, dass es das Schlaueste wäre, sich bei der Bahnpolizei zu melden und einfach mal das Wort Asyl zu sagen. Alles Weitere werde sich dann schon ergeben.
So standen wir nach einer halben Stunde in der Wache der Bahnhofspolizei und sagten wie aus einem Mund: ›Asyl‹. Ein Beamter saß am Schreibtisch, notierte noch etwas und schaute uns dann gelangweilt über den Rand seiner Brille an. Dann drehte er sich um und rief über die Schulter: ›Schorsch, da san wieder zwoa.‹
Wir wurden in einem provisorischen Containerdorf untergebracht.
Wir waren froh über die Unterkunft, darüber, dass es regelmäßig etwas zu essen gab und dass die sanitären Verhältnisse stimmten, zumindest nach unseren damaligen Vorstellungen, hatten wir auf unserer Flucht doch unsagbar schlimme Dinge erlebt.
Wir wollten so schnell wie möglich weiter nach Berlin reisen. Doch da erlebten wir eine böse Überraschung.
›Das wird nicht möglich sein‹, erklärte uns ein freundlicher, aber sichtbar gestresster Mitarbeiter der Ausländerbehörde auf Englisch, der nur dafür abgestellt war, sich mit unseren Wünschen auseinanderzusetzten, um sie dann praktisch immer freundlich aber bestimmt abzulehnen.
›Als Asylbewerber unterliegen Sie der sogenannten Residenzpflicht.‹
›Was heißt das?‹, wollte ich wissen.
›Das heißt, dass Sie die Stadt München nicht verlassen dürfen.‹
Wir waren beide völlig perplex.
›Warum denn das?‹, fragte ich.
›Die Regelung gilt natürlich nur, solange Ihr Antrag auf Asyl läuft. Wenn darüber entschieden ist, werden sie entweder abgeschoben oder anerkannt, dann können sie sich natürlich frei bewegen. Naja, sie können auch nach der Ablehnung ihres Asylantrages versuchen, eine Duldung zu bekommen. Aber dann unterliegen sie natürlich wieder der Residenzpflicht.‹
›Aber warum denn?‹
Der Beamte zuckte mit der Schulter. ›So ist die Rechtslage. Haben Sie vielleicht Verwandte in Berlin? Kinder? Eine Ehefrau? Eltern?‹
Ich schüttelte nur traurig den Kopf.
›Ich habe Freunde‹, rief Mo.
Der Beamte lächelte nachsichtig. ›Das wird leider nicht reichen.‹
›Aber ich könnte bei ihnen wohnen, essen und trinken, ich würde auch meinen Freund hier mitnehmen. Dann kostet es den deutschen Staat doch nichts. Daran müssen Sie doch auch Interesse haben.‹
›Es tut mir leid meine Herren, aber da sind mir leider die Hände gebunden. Wenn sie nichts mehr Wichtiges haben … bitte, da draußen warten noch andere Fälle, die meine Hilfe brauchen.‹
Völlig verdattert verließen wir das Container-Büro und liefen prompt einem jungen Deutschen in die Arme, der uns aufgeregt fragte, was da drinnen abgelaufen sei. Mo und ich schauten uns an und erzählten dann von unserem doch etwas merkwürdigen Erlebnis mit dem Beamten.
Der junge Mann winkte nur ab. ›Das ist ja noch längst nicht alles. Ihr dürft hier gar nichts. Arbeiten beispielsweise, um eigenes Geld zu verdienen – keine Chance. Eine Ausbildung, um sich hier zu qualifizieren – kannst du vergessen‹, rief er empört. ›Aber damit soll nun Schluss sein. Wir werden die jetzt unter Druck setzen. Nächste Woche starten wir zum Marsch nach Berlin, gegen die Residenzpflicht, gegen das Arbeitsverbot und für ein bedingungsloses Bleiberecht.‹
Das hörte sich imposant an, doch wir hatten nur die Hälfte von dem verstanden, was er uns sagen wollte. Was uns klar war, war, dass er ein engagierter junger Mann war, dem unser Schicksal naheging. Das war doch schon mal was.
›Seid ihr gut zu Fuß?‹, wollte er plötzlich wissen. Wieder schauten wir beide uns an und zuckten mit den Schultern. Natürlich waren wir gewohnt, größere Strecken zu Fuß zurück zu legen. Deutsche nahmen sicherlich für jede Strecke das Auto, auch wenn’s nur um vier oder fünf Kilometer ging. Da waren wir Afrikaner schon anders. Also nickten wir.
›Fein!‹, rief der junge Mann begeistert aus. ›Wir werden am 8. September in Würzburg starten und nach Berlin marschieren. Wollt ihr mitmachen?‹
Mo fragte als erstes: ›Wie weit ist das?‹
›Wir rechnen mit 600 Kilometern, wir können ja schlecht über die Autobahn marschieren. Sonst wären es 150 Kilometer weniger.‹ Er lachte über seinen Scherz, den wir nicht so recht verstanden. Ich hatte Bedenken.
›Aber was ist mit der Residenzpflicht? Wenn uns die Polizei erwischt, dann schicken sie uns zurück nach Dafur.‹
›Unsinn‹, wandte der junge Mann ein. ›Erstens dauert es ewig, bis der Antrag bearbeitet wird und dann kann man bei einem abschlägigen Bescheid noch immer an einer Duldung arbeiten. Aber he, ihr zwei kommt aus Dafur. Da geht der Asylantrag hundertprozentig durch. Das ist sicher. Und außerdem würde kein Polizeibeamter in Deutschland es wagen, einen Flüchtling aus dem Zug rauszuholen, um ihn dann abschieben zu lassen. In dem Protestzug seid ihr sicher.‹
Das leuchtete uns ein.
›Aber wie kommen wir bis nach Würzburg? Wenn wir mit dem Zug fahren und kontrolliert werden?‹
›Natürlich werdet ihr von der Bahnpolizei kontrolliert, deswegen fahrt ihr auch mit dem Auto. Ich hole euch in drei Tagen ab. Aber verratet dem Vogel da drin nichts.‹
Er deutete mit dem Daumen auf das Büro im Container.
So hatten wir also doch noch eine Chance, nach Berlin zu kommen. Allerdings – 600 Kilometer zu Fuß?
Mo klopfte mir auf die Schulter und sagte: ›Nach allem, was wir erlebt haben, sind 600 Kilometer zu Fuß quer durch Deutschland ein gemütlicher Spaziergang.‹
Und Mo sollte diesmal recht behalten. Drei Tage später holte uns der junge Mann ab, von dem wir jetzt erst erfuhren, dass er Simon hieß und sich in einer Gruppe für Flüchtlingshilfe engagierte. Zum ersten Mal fuhren wir über eine Autobahn und waren schwer beeindruckt. Allerdings noch beeindruckter waren wir von der Gruppe, die sich da in Würzburg auf den Weg machte. Zunächst fühlten wir uns als Fremdkörper, obwohl die meisten auf dem Marsch ein ähnliches oder gar schlimmeres Schicksal mit uns teilten. Trotzdem: Wir waren gerade erst angekommen und fühlten uns zunächst auch dankbar, auch wenn uns solche Dinge wie die Residenzpflicht unsinnig oder das Arbeitsverbot absurd vorkamen. Doch wir sollten schnell lernen, wie bedrückend das für jene war, die nicht nur wenige Wochen, sondern Monate und oft Jahre auf eine Entscheidung über ihren Antrag warteten. Zwar gab es Essen, Unterkunft und auch ein wenig Geld, aber viel zu wenig, als dass man hätte wagen können, es nach Hause zu schicken.