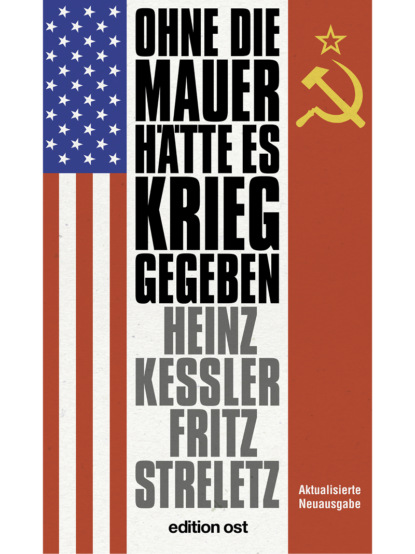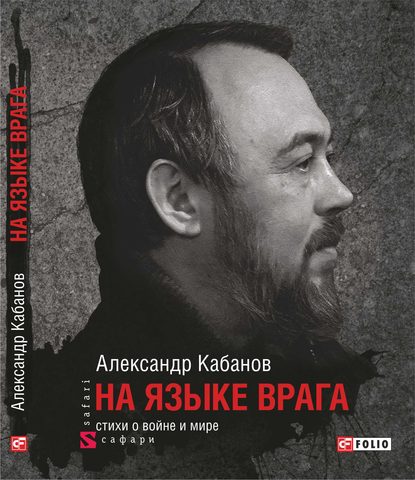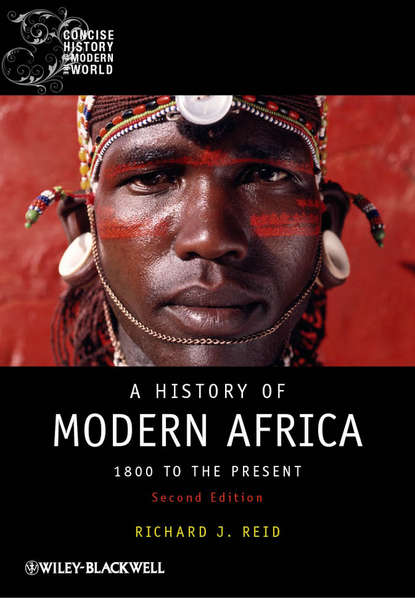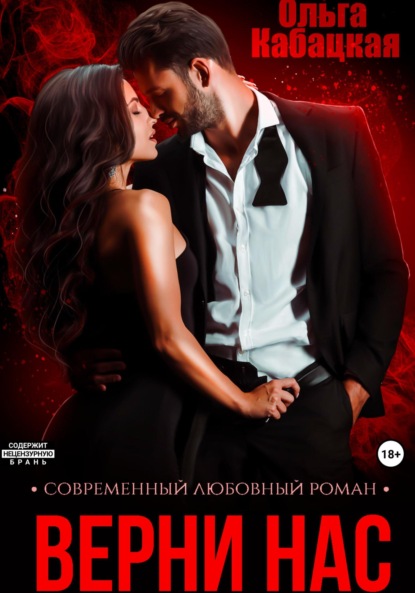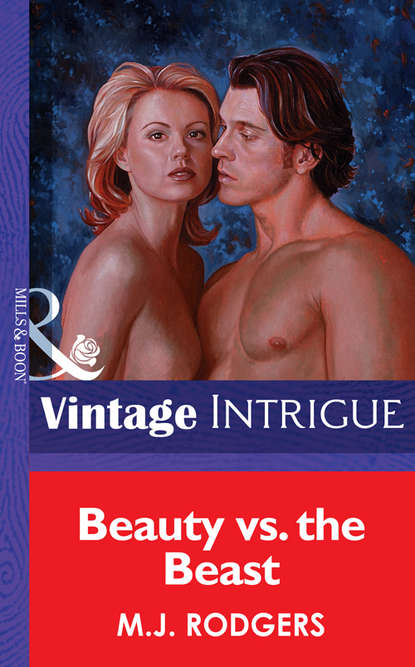- -
- 100%
- +
Moskau hatte zwar einiges versprochen, aber den Worten bislang nur wenig Taten folgen lassen. Nicht nur der erste Mann der DDR wusste, was das in der Systemauseinandersetzung und unter den Bedingungen der offenen Grenze bedeutete. »Damit bleiben wir 1961 weit unter dem zur Zeit in Westdeutschland erreichten Tempo der Produktionssteigerung. Der Abstand zum Lebensstandard Westdeutschlands wird weiterhin groß sein. Das heißt, dass wir die ökonomische Hauptaufgabe nicht lösen. Dabei müssen wir der Tatsache Rechnung tragen, dass das Schwierigkeiten im Innern schafft. Westdeutschland erhöhte die Löhne im Jahre 1960 um ca. 9 Prozent und führt die 5-Tage- bzw. 40-Stunden-Woche ein. Wir haben keine Voraussetzungen für Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen.« 4
Das hieß: Noch mehr Wirtschaftsflüchtlinge, die das Land Richtung Westen verlassen würden.
Das aktuelle Außenhandelsdefizit der DDR betrug 1,35 Milliarden Valuta-Mark. Angesichts heutiger Verbindlichkeiten ein geradezu lächerlicher Betrag. Für die DDR anno 1961 war er von existenzieller Bedeutung. Von diesen Verbindlichkeiten entfielen etwa 500 Millionen auf den Westen, rund 800 Millionen auf die UdSSR. Ulbricht wollte, dass die letztere Summe in einen brüderlichen Kredit umgewandelt würde, der erst ab 1966 getilgt werden sollte.
»Wir haben im Politbüro außerordentlich ernsthaft und gründlich nochmals alle Ausgangsbedingungen und Zusammenhänge geprüft. Wenn es nicht möglich ist, uns eine solche Kredithilfe zu geben, so werden wir das Lebensniveau der Bevölkerung des Jahres 1960 nicht halten können. Es würde in der Versorgung und in der Produktion eine so ernste Lage eintreten, dass wir vor ernsten Krisenerscheinungen stehen würden, denn dann müssten wir Importe von Stahl, Buntmetallen, Textilrohstoffen und Lebensmitteln senken und Waren, die für die Versorgung der Bevölkerung und für die Durchführung wichtiger Investitionen unbedingt benötigt werden, zusätzlich importieren.« 5
Ulbricht nannte im Weiteren die Ursachen für die wirtschaftliche Lage. Sie offenbaren die ganze Verlogenheit, die bis heute üblich ist, wenn man sich über die Mangelwirtschaft in der DDR und die Unzulänglichkeit des sozialistischen Wirtschaftssystems mokiert.
»Unsere wirtschaftliche Basis war von Anfang an sehr viel schwächer als die Westdeutschlands. In den ersten zehn Nachkriegsjahren leisteten wir Wiedergutmachung für ganz Deutschland durch Entnahme aus den bestehenden Anlagen und aus der laufenden Produktion. Westdeutschland hingegen leistete keine Wiedergutmachung aus der laufenden Produktion, sondern erhielt in der gleichen Zeit größere Kredite. Während wir in den ersten zehn Jahren nach Ende des Krieges Reparationen durch Entnahmen aus Produktionsanlagen und der laufenden Produktion aufbrachten und große Mittel aufwendeten, um die Produktion der Wismut 6 in Gang zu setzen und zu unterhalten, erhielt Westdeutschland schon wenige Jahre nach Kriegsschluss finanzielle Zuschüsse der USA in Höhe von vielen Milliarden DM. Wir haben aber alle Leistungen der Wiedergutmachung durch die DDR für politisch richtig und notwendig gehalten, um die durch den faschistischen Aggressionskrieg der Sowjetunion zugefügten Schäden mindern zu helfen und damit die Sowjetunion als das Zentrum des sozialistischen Lagers zu stärken.« 7
Ulbrichts Aussage macht den dialektischen Kontext sichtbar, in dem die deutschen Kommunisten der Nachkriegszeit aus Überzeugung agierten. Auf der einen Seite erwiesen sie sich als deutsche Patrioten – sie hatten nicht Hitlers Krieg inszeniert, sie hatten ihn nachweisbar entschieden bekämpft. Insofern konnten sie auch nicht für die von Hitlerdeutschland verursachten Kriegsschäden haftbar gemacht werden. Gleichwohl handelten sie in Verantwortung für die gesamte deutsche Nation. Sie nahmen die Konsequenzen an, die aus deutscher Schuld resultierten.
Zum anderen handelten diese deutschen Kommunisten auch als Internationalisten. Sie glaubten, die Sowjetunion wirtschaftlich und politisch als »Zentrum des sozialistischen Lagers« stärken zu müssen, weil alle Verbündeten und letztlich die Welt davon profitieren würden.
Das taten sie auch, obgleich sie sich der Folgen für die DDR durchaus bewusst waren, wie Ulbricht ausführte. »Die Entnahme aus unserer Produktionskapazität, aus der laufenden Produktion musste aber zu einer Schwächung unserer wirtschaftlichen Kraft führen, die lange Zeit unsere Lage gegenüber Westdeutschland erschwert und unsere ökonomische Entwicklung außerordentlich stark beeinträchtigt.
Westdeutschland konnte aber aufgrund der geleisteten Hilfe zu einem sehr frühen Zeitpunkt bereits große Investitionen durchführen und eine außerordentliche Modernisierung des Produktionsapparates erreichen. Bis zum Erlass der Reparationen 1954 waren die Investitionen in Westdeutschland pro Kopf der Bevölkerung doppelt so hoch wie bei uns. In den Jahren 1950–1959 zusammengenommen wurden pro Kopf der Bevölkerung Investitionen in Westdeutschland für 7400DM durchgeführt, während die ökonomische Kraft der DDR nur Investitionen pro Kopf der Bevölkerung in Höhe von 4650DM ermöglichte. Dabei setzte bei uns eine starke Investitionstätigkeit erst vom Jahre 1956 ein, d.h., dass wir einen wesentlich späteren Starttermin für die Modernisierung unserer Produktionskapazitäten hatten als Westdeutschland. Entsprechend unserer Bevölkerungszahl hätten wir im Vergleich zu Westdeutschland für fünfzig Milliarden Mark mehr investieren müssen.
Das ist der Hauptgrund dafür, dass wir in der Arbeitsproduktivität und im Lebensstandard so weit hinter Westdeutschland zurückgeblieben sind. Dadurch konnte ein ständiger politischer Druck auf uns von Westdeutschland ausgeübt werden.
Die Entwicklung in Westdeutschland, die für jeden Einwohner der DDR sichtbar war, ist der Hauptgrund, dass im Verlaufe von zehn Jahren rund zwei Millionen Menschen unsere Republik verlassen haben.« 8
Alexander Schalck-Golodkowski bezifferte 1970 in seiner Dissertation die Reparationslasten Ostdeutschlands auf etwa 4,3 Milliarden Dollar, während Westdeutschland lediglich auf etwa eine halbe Milliarde kam.
Je besser es den »Brüdern und Schwestern« im Westen ging, desto verlockender schien eine persönliche Perspektive dort. Allein 1960 hatten etwa 200000 DDR-Bürger die DDR verlassen, drei Viertel davon gingen über Westberlin. Die sogenannte Abstimmung mit Füßen war insofern kein politisches Votum, als in den meisten Fällen der Abgang eine Entscheidung für ein vermeintlich besseres Leben in Wohlstand und Zufriedenheit darstellte. (Bis heute sind seit dem Ende der DDR 1990 drei Millionen Ostdeutsche aus dem gleichen Grunde weggegangen. Lag das auch am System?)
Die Konsequenz dieser Republikflucht für die DDR sprach Walter Ulbricht ungeschminkt aus: »In dieser Lage waren und sind wir gezwungen, um den beträchtlichen Abstand im Lebensniveau wenigstens schrittweise zu mildern, ständig mehr für den individuellen Konsum zu verbrauchen, als unsere eigene Wirtschaft hergab und z. Zt. hergibt. Das ging ständig zu Lasten der Erneuerung unseres Produktionsapparates. Das kann man auf die Dauer nicht fortsetzen.«9 Um den Import von Lebensmitteln und von Rohstoffen bezahlen zu können, exportierte die DDR zwangsweise auch Ausrüstungen, die sie selber dringend benötigte. »Um unsere Volkswirtschaft in Gang zu halten, mussten wir 1960 den Import aus kapitalistischen Ländern um fast 30 Prozent steigern. Diese Importe reichten noch nicht aus und führten zu ernsten Schwierigkeiten in der Versorgung der Industrie mit Rohstoffen im Jahre 1960.« 10
Der Import aus der UdSSR hingegen war gerade mal um zwei Prozent gewachsen. Aber nicht, weil die DDR nicht mehr gewollt, sondern weil die Sowjetunion nicht mehr gekonnt hatte.
Ohne Hilfe der Sowjetunion würde die DDR das Jahr 1961 nicht überleben. Also musste eindringlich mit der sowjetischen Führung gesprochen werden. »Wie bereits vereinbart, wird Genosse Leuschner in diesen Tagen in Moskau zu Beratungen sein. Damit wir den Volkswirtschaftsplan endgültig im ZK beschließen können, bitten wir, dass in diesen Beratungen mit Genossen Leuschner die notwendigen Fragen für 1961 geklärt werden, damit es zu keinen Stockungen in der Produktion und in der Versorgung in unserer Republik kommt.«
So weit Walter Ulbricht am 18. Januar 1961 im Politbüro. Das ging, wie schon festgestellt, auch an die sowjetische Führung.
Bruno Leuschner, der Chef der Staatlichen Plankommission, reiste dem Hilferuf an Chruschtschow hinterher und meldete sich am 27. Januar erstmals mit Kurierpost bei Ulbricht. Er berichtete vertraulich über sein Gespräch am 24. Januar mit Anastas Mikojan, dem sowjetischen Vizepremier.
Der Armenier habe ihm erklärt, dass die zwischenzeitliche Wiederherstellung des Handels mit Westdeutschland nichts an der prinzipiellen Erklärung des Genossen Chruschtschow ändere, »dass die Unabhängigkeit der DDR von imperialistischen Störmanövern hergestellt werden muss«.
Doch außer der Forderung, dass die DDR ihr Produktionsprogramm so ändern müsse, dass sie »mehr Waren für den Bedarf der UdSSR« produzieren könne, äußerte Mikojan sich in der Sache kaum. »Das Defizit der Zahlungsbilanz bezeichnete er als eine betrübliche Erscheinung, aber offensichtlich ein Faktum. In diesem Jahr wird die UdSSR entgegenkommen. Wie und in welcher Höhe, das muss noch eingehend geprüft werden. Aber in Zukunft ginge das nicht so«, notierte erkennbar verärgert der Planungschef aus Berlin. »Daraufhin erläuterte ich, dass wir schon bei der Beratung des Siebenjahrplanes in Moskau 1958 das Defizit in der Außenhandelsbilanz vorgelegt hatten und dass ein Defizit auch in den Jahren 1962 bis 1964 vorhanden ist. Er erwiderte, das sei sehr betrüblich, aber man muss die Frage gründlich studieren und entscheiden, wie man sie lösen kann.« 11
Am Nachmittag war Leuschner bei Patolitschew, dem Außenhandelsminister. »Dort war folgende Linie: So viel Metall und andere Rohstoffe in Westdeutschland kaufen wie nur möglich und die Sowjetunion entlasten. Unsere Schulden (im Westen – d. Verf.) nicht vermindern, sondern gleichlassen bzw. erhöhen.«
Das stand klar im Widerspruch zu Mikojan, der gefordert hatte, die DDR solle sich »von imperialistischen Störmanövern« unabhängig machen, aber die Antwort schuldig blieb, wie das geschehen sollte.
Am 30. Januar schrieb Bruno Leuschner auf vier Seiten an Walter Ulbricht über den Stand seiner Sondierungen: »Praktisch ist es so, dass der Abschluss von Verträgen über einen großen Teil der im November zugesagten Materialien, insbesondere solcher Materialien, die die Sowjetunion für uns in kapitalistischen Ländern kaufen wollte, ruht.« 12 Der stellvertretende Vorsitzende des Ministerrates und Vorsitzende der Staatlichen Plankommission Bruno Leuschner trat merklich auf der Stelle, obgleich er fortgesetzt zwischen Berlin und Moskau pendelte. »Ich mache mir Gedanken darüber, wie es nun mit der praktischen Arbeit weitergehen soll«, schrieb er besorgt am 20. März an Ulbricht, die Hauptaufgaben seien nicht gelöst, »die sowjetischen Genossen wollen sehr viel Unterlagen und Berechnungen sehen«, aber nichts sei wirklich geklärt.13
Am 22. April 1961 war Bruno Leuschner wieder in Moskau, um sich mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Sassjadko zu treffen. Das elfseitige Papier, das er anschließend füllte, trägt den Stempel: »Geheim.« Leuschner versuchte dem russischen Amtskollegen, der ebenfalls von Produktionsumstellung und dergleichen redete, den dramatischen Ernst der Lage zu schildern, wenn die versprochenen Lieferungen aus der UdSSR ausblieben. »Wir müssen immer davon ausgehen, das verlangt das Politbüro von uns, dass wir unter den Bedingungen der DDR bei offenen Grenzen keinerlei Experimente machen können. Die Republikflucht ist in diesem Jahr wieder angestiegen. Es ist für uns völlig untragbar, dass diese Entwicklung dadurch noch forciert wird, dass die Betriebe nicht ordentlich arbeiten können und keine stabile Perspektive sehen.« 14
In dem ebenfalls als »Geheim« klassifizierten Bericht, den Leuschner über sein anschließendes Gespräch mit dem 1. Stellvertretenden Vorsitzenden des Staatlichen Ökonomischen Rates der Sowjetunion, Tichomirow, notierte, wurde erkennbar, dass Moskau den Spieß umzudrehen versuchte. Man forderte offen Strukturänderungen im Maschinenbau der DDR. »Es bestehe die Gefahr, dass die Bedürfnisse der UdSSR ungenügend berücksichtigt werden und dadurch große Schwierigkeiten entstünden«, orakelte Tichomirow sibyllinisch, um dann Leuschner zu erpressen: »Wenn die DDR nicht die von der UdSSR benötigten Maschinen liefert, dann könne man auch nicht die Zusage über die Lieferungen von Metallen aufrecht erhalten.« 15
Die Spannungen zwischen Berlin und Moskau wurden im Frühjahr 1961 selbst in vergleichsweise kleinen Begebenheiten sichtbar. Am 5. Mai 1960 verletzte eine westliche Militärmaschine bei Boizenburg den Luftraum der DDR. Generaloberst Iwan I. Jakubowski, Oberkommandierender der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD), protestierte bei den Westmächten.
Aber wie!
Peter Florin (Leiter der Abteilung für Internationale Beziehungen des ZK der SED) machte Ulbricht in einer Hausmitteilung darauf aufmerksam, dass die sowjetische Note »Formulierungen enthält, die meiner Meinung nach nicht mit der Souveränität der DDR übereinstimmen und vermieden werden sollten. Im ganzen Dokument wird nicht ein einziges Mal davon gesprochen, dass alles in Übereinstimmung oder gar auf Veranlassung der DDR geschieht.« 16
Das machte klar, wer in diesem Land das tatsächliche Sagen hatte.
Ganz in diesem Geiste war auch ein Brief Jakubowskis an Ulbricht formuliert, den der Militär am 15. Juli 1961 im Zentralkomitee der SED abliefern ließ. Der Oberkommandierende mahnte den Staatsratsvorsitzenden: »Für Bau- und Reparaturarbeiten in einigen Garnisonen, in denen Truppenteile der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland stationiert sind, hatten wir gebeten, für 1961 Kabellieferungen im Wert von 1,098 Millionen DM einzuplanen. Die Staatliche Plankommission der DDR hat Kabel nur im Wert von 849000DM bereitgestellt, d.h. für 249000 weniger als geplant. […] Ich sehe mich genötigt, mich an Sie um Hilfe zu wenden und Sie zu bitten, die Staatliche Plankommission anzuweisen, Möglichkeiten für die Bereitstellung folgender benötigter Kabel zu finden.«
Nach einer präzisen Auflistung schloss Jakubowski mit der ultimativen Aufforderung, die wie ein Befehl klang: »Ich bitte, mir Ihre Entscheidung mitzuteilen.« 17
Ulbricht vermerkte handschriftlich: »Gen. Apel und Neumann zur Stellungnahme und Maßnahmen W.U.«
Forderungen sowjetischer Militärs waren durchaus üblich. Zwei Monate später verlangte Marschall Konew, der seit Anfang August neben Jakubowski die sowjetischen Interessen in der DDR wahrnahm, von Walter Ulbricht gleichfalls Unterstützung. Zwischenzeitlich war die Grenze geschlossen worden, worauf Konew am 18. September schrieb: »Zur Durchführung der Maßnahmen, die der Erhöhung der Gefechtsbereitschaft der GSSD im Interesse der Verteidigungsfähigkeit der DDR dienen, werden kurzfristig über den Plan hinaus bestimmte Materialien und Einrichtungsgegenstände für Kasernen benötigt. Ich bitte zu veranlassen, dass die GSSD im IV. Quartal 1961 von der Industrie der DDR zusätzlich mit folgenden Materialien beliefert wird.«
Dann folgte eine Liste mit 18 Positionen.18
Die zähen Wirtschaftsgespräche in Moskau zogen sich über das ganze Frühjahr 1961 hin. Am 3. Mai trafen sich in Berlin Walter Ulbricht, Bruno Leuschner und Günter Mittag. Das Papier, in welchem die Runde dokumentiert ist, trägt den Stempel »Streng vertraulich!«. Die drei kamen überein, dass »ungefähr im Juli« eine offizielle Delegation nach Moskau reisen solle, um die Sache zum Abschluss zu bringen. Ulbricht, ganz Internationalist und Stratege, wollte einerseits nicht, dass die Sowjetunion bloßgestellt und verärgert werden könnte, und dass andererseits die Lage der DDR im Westen offenbar wurde. Deshalb wies er an: »Das Material über die Verhandlungen in Moskau ist so zu behandeln, dass dem Gegner der Inhalt nicht zugänglich ist. Die verantwortlichen Leiter erhalten nur das Material (Auszüge), was sie unmittelbar für ihre Arbeit benötigen. Es muss verhindert werden, dass eine Vielzahl von leitenden Funktionären einen zusammenhängenden Überblick über die gesamte Lage erhält.«
Und deshalb schlug er auch schon den nichtssagenden Text vor, der als Kommuniqué veröffentlicht werden sollte: »Im Ergebnis der Beratungen wurde die beschleunigte Entwicklung bestimmter Zweige der chemischen Industrie, der Energiewirtschaft und der Metallurgie vereinbart. Die Verhandlungen verliefen im Sinne einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit und es wurde vereinbart …« 19
Wenige Tage zuvor, am 28./29. März 1961, hatte in Moskau der Politisch Beratende Ausschuss der Warschauer Vertrags-Staaten getagt. Aus der DDR nahmen an der Sitzung Walter Ulbricht, Außenminister Lothar Bolz, ZK-Sekretär Erich Honecker und Verteidigungsminister Heinz Hoffmann teil. Thema war das bevorstehende Gipfeltreffen in Wien. Am 3./4. Juni wollten erstmals der sowjetische Ministerpräsident Nikita S. Chruschtschow und US-Präsident John F. Kennedy zusammentreffen. Drei Themen standen auf der Agenda: Einstellung der Kernwaffenversuche, Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland und die Regelung der Westberlin-Frage.
Moskau regte bereits im Vorfeld in einem Memorandum über die deutsche Frage die West-Alliierten an, die vier Großmächte sollten in voller Anerkennung des Selbstbestimmungsrechtes des deutschen Volkes gemeinsam an die beiden deutschen Staaten appellieren, »sich in jeder für sie annehmbaren Form über die Fragen zu einigen, die eine Friedensregelung mit Deutschland und die Wiedervereinigung betreffen. Die vier Mächte werden von vornherein erklären, dass sie jede Vereinbarung anerkennen, die von den Deutschen getroffen wird.« 20
Ulbricht hoffte auf einen Erfolg in Wien und einen Friedensvertrag, in dessen Folge die volle völkerrechtliche Anerkennung der DDR stünde mit allen Konsequenzen. Auf diese Weise hätte sich beispielsweise der Alleinvertretungsanspruch erledigt, durch den überall in der Welt jeder DDR-Wirtschaftsflüchtling erfolgreich um Aufnahme in die Bundesrepublik nachsuchen konnte.
In diesem Sinne erklärte Walter Ulbricht am 29. März 1961 in Moskau, nachdem die internationale Lage erörtert worden war: »Angesichts dessen ist uns klar, dass die Sicherung des Friedens in Deutschland und in Europa den baldigen Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland erfordert, der auch die friedliche Lösung des Westberlin-Problems einschließt.« Und um diesen Kontext zu erläutern, führte er weiter aus: »In diesem ökonomischen und politischen Kampf gegen unsere Republik spielt Westberlin die Rolle eines Kanals, mit dessen Hilfe dieser Menschenhandel praktiziert wird, durch den aber auch Lebensmittel und andere Materialien aus unserer Republik abfließen. Westberlin stellt also ein großes Loch inmitten unserer Republik dar, das uns jährlich mehr als eine Milliarde Mark kostet. Diese Kräfte und Mittel, die aus unserer Republik abgezogen werden, kommen, wie das anders gar nicht sein kann, auch der forcierten westdeutschen Aufrüstung zugute.« 21
Nicht unmittelbar, aber mindestens mittelbar. Und Ulbricht verwies zugleich auf das legitime Recht der Bundesrepublik wie der DDR auf vernünftige Außenbeziehungen. »Jeder Staat hat nach einem Krieg das Recht auf einen Friedensvertrag, und selbstverständlich sahen die Vereinbarungen, die nach der Kapitulation Hitlerdeutschlands zwischen den vier Hauptmächten der Antihitlerkoalition getroffen wurden, den Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland vor. Diesen Viermächtevereinbarungen entspricht es, zum Zwecke der Beseitigung des Militarismus und Faschismus […] und zur Schaffung eines friedlichen Deutschland einen Friedensvertrag mit beiden deutschen Staaten abzuschließen. Das muss jetzt, sechzehn Jahre nach Kriegsende, endlich geschehen!« 22 Ulbrichts Forderung ging sowohl an die Adresse der Westmächte als auch an Moskau.
Walter Ulbricht sprach im nationalen deutschen Interesse und nicht nur für die DDR, als er erklärte: »Mit der Vorbereitung eines Friedensvertrages ist die Beseitigung der Anomalität der Lage in Westberlin unmittelbar verbunden. Dabei gehen wir aus von der Souveränität der DDR, deren Hauptstadt das demokratische Berlin ist. Der Abschluss eines Friedensvertrages mit der DDR setzt auch das von den Westmächten über Westberlin verhängte Besatzungsstatut außer Kraft.« 23
Der Westteil Berlins sollte, zumindest in einer Übergangsphase, eine entmilitarisierte freie Stadt werden. Und um den Ängsten im Westen zu begegnen, die seit Monaten propagandistisch geschürt wurden, erklärte Ulbricht ausdrücklich: »Uns schwebt also keine schroffe Änderung aller Verhältnisse, sondern ein Übergangsstadium vor, das für alle Beteiligten tragbare und zumutbare Lösungen bringt, die im Interesse der Sicherung des Friedens und der Verwirklichung der Prinzipien der friedlichen Koexistenz auch in Deutschland, auch in den Beziehungen zwischen der DDR und Westberlin liegen. […] Wir erstreben eine friedliche Lösung durch Abschluss eines Friedensvertrages und Herbeiführung der allgemeinen und vollständigen Abrüstung in Deutschland.
Die militärische Neutralisierung Deutschlands entspricht den nationalen Interessen des deutschen Volkes und den friedlichen Interessen der Völker Europas.« 24
Bundeskanzler Konrad Adenauer dagegen lehnte die Erörterung eines Friedensvertrages mit den beiden deutschen Staaten strikt ab. Zur Begründung sagte er, dass dies die völkerrechtliche Anerkennung der Teilung Deutschlands bedeuten würde.
Dass Wiener Gipfeltreffen Anfang Juni brachte nicht den in Berlin erhofften Durchbruch.
Neutrale Beobachter meinten, dass daran auch Nikita Chruschtschow und seine nur schwach ausgeprägten diplomatischen Fähigkeiten nicht ganz unschuldig gewesen seien. Er sei zu selbstbewusst aufgetreten mit dem Faktum des ersten Weltraumfluges eines Menschen im Gepäck (Gagarin hatte am 12. April 1961 mit Wostok 1 die Erde umrundet), mit der Tatsache, dass im gleichen Monat eine Invasion von Exilkubanern und ihrer Helfershelfer aus den USA in der Schweinebucht auf Kuba erfolgreich abgewehrt worden war, dass die Sowjetunion am 1. Mai 1960 ein US-Spionageflugzeug in 21000 Metern Höhe mit einer Rakete vom Himmel geholt hatte25, und wegen des Umstandes, dass die sowjetischen Nuklearforscher den bis dahin größten Atombombentest vorbereiteten.26
Ulbricht informierte am 14. Juni im Plenarsaal des ZK das Politbüro, den Staats- und den Ministerrat sowie das Präsidium des Nationalrates der Nationalen Front über das Resultat des Gipfeltreffens. Auch wenn er es zu Recht als Fortschritt herausstellte, dass beide Seiten konstatiert hätten, es sei die Zeit gekommen, »alle Meinungsverschiedenheiten und Streitfragen auf dem Wege von Verhandlungen« zu lösen27, war man in der Deutschland- und Berlin-Frage nicht weiter.
Ulbricht erläuterte die eigene Position und mögliche eigene Schritte: »Was die Frage der Verbindungswege betrifft, so habe ich bereits in anderen Erklärungen gesagt, dass wir nicht die Absicht haben, Westberlin zu blockieren, dass die Verbindungswege offen bleiben und dass die DDR wie es bereits in 95 Prozent der Verbindungen geschieht die Kontrolle ausübt. Nachher wird sie in 100 Prozent der Fälle die Kontrolle ausüben.« 28
Im Klartext: Ulbricht wollte mit Chruschtschows Hilfe die vier Mächte dazu bewegen, dass der Luftverkehr von und nach Berlin ausschließlich über Berlin-Schönefeld abgewickelt würde. Der Hebel dazu war ein Friedensvertrag mit Deutschland oder eben mit der DDR. Dadurch würden sich alle Besatzungsrechte für Westberlin erledigen.
Ulbricht unterstrich erneut: »Der kürzeste Weg zur Wiedervereinigung ist der Abschluss eines Friedensvertrages mit beiden deutschen Staaten, die Herbeiführung der friedlichen Koexistenz, der Weg der Konföderation.« 29
Am 25. Juli 1961 entgegnete BRD-Verteidigungsminister Franz Josef Strauß demonstrativ in Washington auf diese Entspannungs-Bemühungen: »Der Zweite Weltkrieg ist noch nicht zu Ende.« Und er forderte, nicht zum ersten Male, die Bundeswehreinheiten unmittelbar an der Grenze mit taktischen Atomwaffen auszurüsten. Wer das ablehne, gehe den ersten Schritt zur Neutralität.
In jener Zeit schickte Walter Ulbricht ein Schreiben an Chruschtschow mit der Rede, die er auf dem Treffen der Ersten Sekretäre in Moskau Anfang August halten wollte. Zu diesem Spitzentreffen der östlichen Staaten gab es eine Anregung Ulbrichts. Thema: »Erörterung der mit der friedlichen Regelung des Deutschlandproblems zusammenhängenden Fragen.« Den Vorschlag dazu hatte Ulbricht bereits im Juni nach Moskau geliefert. Er fragte Chruschtschow mit Verweis auf die Grenzgänger: »Erstens: welche ökonomischen Maßnahmen sind die zweckmäßigsten? Und zweitens: Welches ist der günstigste Zeitpunkt?« 30 Abschließend hieß es in Ulbrichts Begleitschreiben zum Redenentwurf: »Ich bitte Sie vor der Beratung um eine Besprechung über die taktischen Hauptfragen und Ihre Änderungsvorschläge zu meiner Rede.« 31