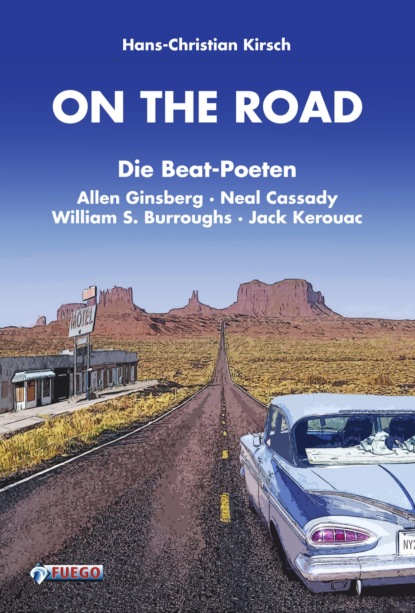- -
- 100%
- +
Allen wird sechzehn. Er beobachtet Sterne. Er polemisiert gegen die Anhänger der Isolationspolitik. Er hört Musik: Gershwin und Aaron Copland. Sein Bruder Eugene, der von der Lehrerausbildung zum Jurastudium gewechselt hat, wird zur Armee einberufen. Allen betätigt sich bei der Zivilverteidigung. Er arbeitet als Laufbursche in der Öffentlichen Bibliothek und verdient dreizehn Cent in der Stunde. Einmal schleicht er sich heimlich in das Büro der Bibliothekarin, entnimmt aus dem Giftschrank den Krafft-Ebing und schlägt darin das Stichwort ›Homosexualität‹ nach.
Er will herausfinden, ob er schwul ist. Wenn er sich verliebt, sind es immer Jungen. Einer, für den er besonders schwärmt, heißt Paul Roth. Er ist ein halbes Jahr älter als Allen und geht mit einem Stipendium an die Columbia University in New York.
Allen will seinem Idol dorthin folgen und bewirbt sich ebenfalls an dieser Universität. Er bekommt ein Stipendium.
An dem Tag, an dem er mit der Fähre von Hoboken nach Manhattan übersetzt, legt er vor sich selbst den Schwur ab, sein Leben dem Dienst an der Arbeiterklasse zu widmen.
Er besteht die Aufnahmeprüfung. Aber dem Jungen, in den er verliebt ist, begegnet er an der Universität selten. Er hört Jura. Er ist entschlossen, Anwalt für Arbeitsrecht zu werden.
In Columbia sind die Kriegsmarinekadetten eingezogen. Die zivilen Studenten hat man ausgelagert.
Allen wird in einem großen Apartmenthaus des Union-Theological-Seminars, einen halben Block vom Campus entfernt, untergebracht.
Einige Tage vor Weihnachten 1943 hört er aus einer der Studentenbuden auf seinem Flur ein Musikstück, das ihn interessiert. Er klopft. Es öffnet ihm ein engelsgesichtiger junger Mann mit blondem Haar und hohlen Wangen. Man könnte meinen, er trinke nichts anderes als Wind und statt Fleisch esse er einen Haufen Schatten, geht es Allen durch den Kopf.
›Was spielst du denn da?‹ fragt er.
›Gefällt es dir?‹
›Ich würde sagen, es ist das Klarinettenquintett von Brahms.‹
›Richtig. dass es jemanden gibt, der so etwas zu schätzen weiß‹, wundert sich der andere und bittet ihn zu sich herein. Der Kommilitone stellt sich vor. Luden Carr. In den Bücherregalen sieht Allen französische Bücher. Flaubert, Rimbaud. Carr stellt zwei Gläser auf den Tisch und schenkt Rotwein ein. Die beiden werden Freunde. Sie treffen sich immer öfter zu langen Gesprächen. Carr stammt aus einer wohlhabenden Familie aus St. Louis, wo sein Großvater mütterlicherseits mit Jute und Hanffasern handelte. Als Lucien noch ein Kind war, hatte der Vater die Familie verlassen.
Lucien ist zwei Jahre älter als Allen. Er hat eine Schule für verhaltensgestörte Kinder besucht, hat später an der renommierten Universität von Chicago sein Studium begonnen und ist im Herbst nach Columbia gekommen.
Für Allen wird Rimbaud, mit dessen Gedichten ihn Carr bekannt macht, zur großen Entdeckung, zum Tor in die europäische Moderne. Bei ihm stößt er auf Sätze, auf die sich später die Literaten der Beat Generation berufen werden. Sein Tagebuch verzeichnet, was ihm nun als Aufgabe und Eigenart des Dichters erscheint:
›Der Dichter wird ein Seher durch ein langes dérangement aller Sinne. Alle Formen der Liebe, des Leidens, des Wahnsinns hat er durchlaufen. Er sucht sich selbst, gibt sich allen Giften in sich hin, behält aber nur die Quintessenz. Unbeschreibliche Qual, zu der er all seinen Glauben braucht, all seine übermenschliche Kraft, da er unter den Menschen zum großen Patienten wird, zum großen Kriminellen, zum großen Verfluchten - und zum überragenden Gelehrten. Denn wonach es ihn verlangt, ist das Unbekannte.‹8
Es wird zugleich sein Lebensprogramm für die nächsten Jahre. Noch zögert Allen, ob er sich auf ein solches Boheme-Leben, wie es Lucien predigt, einlassen soll. Hat er sich nicht vorgenommen, ein Anwalt und Verteidiger des Proletariats zu werden?
Langsam verflüchtigen sich Allens idealistische Träume. Er sieht, dass sich die Literatur der europäischen Moderne mit Themen beschäftigt, die auch ihn persönlich beunruhigen: Wahnsinn, Außenseitertum, das, was der Spießer abartig zu nennen pflegt.
Ja doch, auch er ist ein Abartiger, ein Außenseiter. Er will es nur immer noch nicht wahrhaben.
Daheim hat sich auch einiges geändert. Nachdem beide Söhne aus dem Haus sind, nachdem Louis zweiundzwanzig Jahre an der Seite von Naomi vor allem aus Verantwortungsbewusstsein und Pflichtgefühl ausgehalten hat, sie seine Liebe längst nicht mehr erwidert, ihn ständig mit Anschuldigungen und Verdächtigungen überhäuft, ist er am Ende seiner psychischen Kraft. Mehrmals hat Naomi nach solchen Anfällen von Misstrauen die gemeinsame Wohnung verlassen. Jetzt zieht sie endgültig aus, kriecht bei ihrer Schwester Eleanor in der Bronx unter. Ihren Lebensunterhalt verdient sie mit Adressenschreiben. Auf Außenstehende wirkt sie normal, voller Selbstvertrauen, geradezu fröhlich. Aber immer wieder hat sie Anfälle, bei denen sie dann Stimmen hört und die alten Ängste sie wieder überwältigen. Sie wird schließlich die Geliebte eines Vertrauensarztes der Marinegewerkschaft, bei dem sie als Sprechstundenhilfe arbeitet.
Dass es irgendwann zwischen den Eltern zum Bruch kommen würde, war vorauszusehen gewesen. Insofern geht Allen die Trennung der Eltern jetzt auch nicht übermäßig nahe. Er besucht hin und wieder sowohl den Vater in Paterson als auch die Mutter bei ihrem neuen Freund. Mehr und mehr nehmen ihn die Gespräche und die Lebensart seiner neuen Bekannten an der Universität gefangen.
Mit Lucien Carr besucht er zum ersten Mal das New Yorker Künstlerviertel Greenwich Village, dem damals noch ein Hauch Verworfenheit anhaftete.
Durch Lucien lernt Allen einen hochaufgeschossenen, rotbärtigen Mann kennen, der David Kammerer heißt: eine tragische Gestalt.
Kammerer hatte sich in Lucien Carr verliebt, als er diesen als Kind auf einem Spielplatz sah. Seither ist er ihm überallhin gefolgt. Hier in New York schlägt er sich mit Gelegenheitsarbeiten durch. Er ist zu jedem Opfer bereit, wenn er nur in Luciens Nähe sein kann. Das Verhältnis der beiden ist spannungsreich, weil es kaum ein Mädchen gibt, auf das der schöne Lucien mit seinen grünen Katzenaugen keinen Eindruck machen würde.
Bei Allen löst das Verhältnis der beiden Männer zwiespältige Empfindungen aus. Einerseits kommt es ihm geradezu wie eine Offenbarung vor, dass sich jemand ganz offen zu seiner von der Gesellschaft tabuisierten Neigung bekennt. Andererseits hat die Besessenheit Kammerers und die Distanzierung, mit der Carr darauf reagiert, für ihn etwas Erschreckendes. Angesichts dieses Verhältnisses wird ihm klar, in welche Enttäuschungen und Leiden seine Veranlagung auch ihn stürzen wird.
Als sie Kammerer aufsuchen, hat der einen Freund aus St. Louis zu Besuch: einen großen, dünnen Mann mit aschgrauer Haut, sandfarbenem Haar und zusammengekniffenen Lippen, die ab und zu nervös zucken. Allen, der zu diesem Zeitpunkt siebzehn ist, kommt der Besucher uralt vor. In Wirklichkeit ist der Gast, der gleich um die Ecke wohnt, damals dreißig Jahre.
Die Rede kommt auf eine Schlägerei zwischen Kammerer und einem betrunkenen Maler, bei der dessen Atelier völlig verwüstet worden ist. Lucien hat dabei dem Maler ein Stück vom Ohrläppchen abgebissen und darauf seine Zähne auch noch in Kammerers Schulter gegraben.
›Mit den Worten des unsterblichen Barden‹, zitiert der Gast, der sich als William Seward Burroughs vorgestellt hat, ›ein Gegenstand, zu ausgehungert für mein Schwert.‹9
Dass jemand offenbar für alle Gelegenheiten ein passendes Shakespearezitat aus dem Ärmel schütteln kann, beeindruckt Allen ungemein. So beginnt seine Freundschaft mit William Burroughs.
3
Ein Sohn aus gutem Hause
(1914-1944) William Burroughs
Once started out
to walk around the world
but ended in Brooklyn.
That Bridge was too much for me
I have engaged in silence
exile and cunning.
Lawrence Ferlinghetti1
... geboren am 5. Februar 1914 in St. Louis. In der Reihe seiner Vorfahren treten uns zwei bekannte Typen der amerikanischen Bevölkerung des 19. Jahrhunderts entgegen: der Yankee-Erfinder und der Prediger aus dem Süden.
Der Großvater väterlicherseits war Mechaniker gewesen. Er hatte Patente auf Eisenbahnweichen und auf ein Papiermesser angemeldet, ohne Geld damit zu verdienen. Häufig war er arbeitslos. Sein Sohn William wurde mit achtzehn nach der High-School Bankangestellter. Als solcher war er Tag für Tag acht Stunden damit beschäftigt, Zahlenkolonnen abzuschreiben und zu addieren. Tausender, die zu Millionen kommen, von denen Hunderter abgezogen und erneut Tausender dazugezählt werden.
Eine langweilige, monotone Arbeit. Sieben Jahre blieb William bei der Bank. Dann war seine Gesundheit ruiniert. Tuberkulose. So schwer, dass er seinen Beruf aufgeben musste.
Er erinnerte sich an die Erfindertradition in der Familie.
Es war die Zeit, in der man mit einem neuen Produkt, das sich in Massenproduktion herstellen ließ, von heute auf morgen reich werden konnte.
Die erste Schreibmaschine 1868.
Das erste Telefon 1876.
Die Registrierkasse 1879.
Der Füllfederhalter 1884.
William Seward Burroughs erfand eine Rechenmaschine, die mit der Drehbewegung einer Kurbel eine Reihe von Zahlen addieren konnte und die Rechenoperation sofort ausdruckte. Später kam ein breiter Wagen dazu, der das Buchhaltungsjournal beförderte.
Von dem bis heute üblichen Papierstreifen ließen sich alle Geschäftsvorgänge eines Tages ablesen.
Zusammen mit einem anderen Erfinder,. dem Kanadier Joseph Boyer, gründete er mit einem Startkapital von 100.000 Dollar die American Arithmeter Company. Später würde das Kapital nach dem Willen der Aktienbesitzer auf 200.000 Dollar erhöht.
William Seward Burroughs I. hatte inzwischen geheiratet. Die Krankheit hatte ihn nicht daran gehindert, Kinder in die Welt zu setzen, vier an der Zahl, die Söhne Mortimer und Horace und zwei Töchter.
Die Wundermaschine hatte einen Konstruktionsfehler. Je nachdem, wie heftig man die Kurbel bewegte, wurden verschiedenartige Summen ausgedruckt.
Eines Tages betrat Burroughs leicht alkoholisiert das Lager der Firma und warf alle noch nicht verkauften und zurückgesandten Maschinen aus dem Fenster hinunter auf den Hof.
Er fing noch einmal an zu probieren und zu zeichnen.
Elin Metallzylinder mit einem Kolben wurde eingefügt, in dem zwei kleine Löcher den Ölfluss regulieren. Damit war sichergestellt, dass der Schaftmechanismus sich immer gleichmäßig bewegte, gleichgültig welche Kraft auf die Kurbel einwirkte.
Die verbesserte Maschine, die 1891 für 425 Dollar angeboten wurde, war nun wirklich der Traum eines jeden Buchhalters.
Während Burroughs’ Vermögen wuchs, ging es mit seiner Gesundheit immer mehr bergab. Er zog mit der Familie nach Citronelle in Alabama, ein Ort, von großen Pinienwäldern umgeben. Frische Luft war immer noch das einzige Heilmittel gegen Tuberkulose, das man zu jener Zeit kannte. Aber Ruhe und gute Luft konnten seine zerstörten Lungen auch nicht mehr retten. William Burroughs I. starb mit einundvierzig Jahren im September 1898.
Inzwischen hatte sich die Firma unter Boyers Leitung gut entwickelt. Sie war nach Detroit umgezogen, beschäftigte 1904 465 Angestellte und verkaufte in diesem Jahr 7800 Additionsmaschinen. Das Vermögen der Gesellschaft, die sich inzwischen Burroughs Adding Machine Company nannte, wuchs bis zum Jahr 1920 auf 430 Millionen Dollar an. Aber davon profitierten Burroughs’ Nachkommen kaum noch. William Seward I. hatte beim Umzug in den Süden einen guten Teil seiner Kapitalanteile abgestoßen und den verbleibenden Rest in eine Treuhandgesellschaft eingebracht.
Die Manager der weiter aufstrebenden Gesellschaft überredeten die Kinder der Erfinder, ihre Anteile zu verkaufen. Sie bekamen dabei für die Wertpapiere, die bald eine Million und noch später ein vielfaches dieser Summe gebracht hätten, ganze 100.000 Dollar.
William Burroughs II. hat später einmal ausgerechnet, dass das Aktienpaket seines Vaters in den dreißiger und vierziger Jahren um die 20 Millionen Dollar wert gewesen wäre. Dass er in seinen Geschichten das kapitalistische Zeitalter als von Gangstern beherrscht darstellen wird, scheint angesichts solcher Erfahrungen in der eigenen Familie begreiflich.
Die Mutter Burroughs’ II., Laura, stammte aus einer Familie von Pachtbauern und Predigern aus dem amerikanischen Süden. Ihr Vater, James Wideman Lee, wurde methodistischer Pfarrer in St. Louis in einem Viertel der reichen Leute, seine Frau Eufala leitete die Women’s Temperance Union. Man sagte von ihr, sie hätte einen ihrer Söhne lieber tot als betrunken heimkommen sehen.
Ein Wahlspruch der Predigersippe Lee lautete: ›Wenn du das Spiel des Lebens gewinnen und den Gott ehren willst, der dich geschaffen hat, musst du hart und zielstrebig arbeiten.‹2
Wer solche Sonntagsschulweisheit im Sinn einer neuen Zeit zu interpretieren verstand, war Ivy Ledbetter Lee, der Bruder der Mutter. Von ihm erzählt man, er habe noch den skrupellosesten Kapitalisten in einen nur auf Wohltätigkeit sinnenden Philanthropen umzudichten vermocht. Seine dreist-schamlosen Lügen trugen ihm den Spitznamen ›Poison Ivy‹ ein.
Wenn William Burroughs’ Großvater der Erfinder der Addiermaschine ist, so ist Ivy der Schöpfer der modernen Public Relations.
Ein paar Jahre arbeitete er als Zeitungsschreiber in New York, tatsächlich aber als Presseagent des großen Geldes.
Im Oktober 1913 kam es in den USA bei einem Streik der Bergleute in Colorado zum sogenannten Ludlow-Massaker, bei dem durch Polizei und Staatsmiliz zwei Frauen und elf Kinder getötet wurden. Die Mehrheitseigentümer der Kohlegruben waren die Rockefellers. Im ganzen Land hatten sie eine schlechte Presse, worauf der bis dahin eher menschenscheue und in splendid isolation lebende John D. Rockefeller jr. plötzlich Volksnähe demonstrierte. Er besuchte die Bergarbeiter, tanzte mit deren Frauen, hielt Reden, die vor Verständnis für die soziale Not seiner Arbeiter und Angestellten nur so trieften.
1915 wurde Ivy Lee endgültig Rockefellers Public-Relations-Chef. Die Fähigkeit, Kapitalisten, die über Leichen gingen, in den Augen der Öffentlichkeit als Altruisten dastehen zu lassen, war die Ware, mit der Ivy Lee handelte.
Doch auch dem Erfinder der Public Relations unterliefen in seinen öffentlichen Beziehungen Fehler.
1933 kamen in Deutschland die Nationalsozialisten an die Macht.
Für ein Jahresgehalt von 33.000 Dollar ließ sich Lee von der IG Farben anwerben, um Adolf Hitler, den Führer eines neuen Deutschland, in den USA populär zu machen. Lee reiste nach Europa, wurde Hitler und Goebbels vorgestellt. Er riet den Nazigrößen im Grund zu nichts anderem, als was er auch schon Rockefeller geraten hatte: In der Öffentlichkeit darf nicht der Eindruck entstehen, dass man es mit Unmenschen zu tun hat.
Dem Außenminister Ribbentrop empfiehlt er, die deutschen Wiederaufrüstungspläne einfach abzustreiten. Und Hitler solle erklären, die SS sei nun einfach nötig, um die Kommunisten in Schach zu halten.
Gegen ein Deutschland, das berechenbar war, würde niemand in Europa oder Amerika etwas einzuwenden haben.
Allmählich aber entpuppten sich die Nazis keineswegs als jene netten Burschen, als die Lee sie der amerikanischen Öffentlichkeit hatte verkaufen wollen. Er wurde als Presseagent der IG Farben enttarnt. Sein Ruf war endgültig dahin, als er 1934 vor dem Ausschuss für Unamerikanische Aktivitäten zugeben musste, beträchtliche Summen aus Deutschland bekommen zu haben, um Hitler mit seinen Werbetricks in ein günstiges Licht zu. rücken. Um den süßen Geschmack des Erfolgs gebracht und nun gar als Staatsfeind gebrandmarkt, starb er verbittert im Oktober 1934 mit erst 57 Jahren an einer Gehirnblutung.
Laura Lee und Mortimer Burroughs heirateten 1910. Der junge Ehemann arbeitete noch für kurze Zeit als Vertreter für die Burroughs Company. Nach dem Verkauf seiner Firmenanteile eröffnete er ein Geschäft für Glasscheiben. Das Ehepaar hatte zwei Söhne, Mortimer jr., der 1911 geboren wurde, und William Seward II., der drei Jahre später zur Welt kam. Man lebte in einem Viertel der High-Society, ohne selbst recht dazuzugehören. Die Ehe der Eltern scheint glücklich gewesen zu sein, aber es ist eine Familie, in der man Gefühle nicht zeigt. Mort, der Ältere, schlägt nach dem Vater, ist von gedrungener Statur, wirkt gesund. Billy ist dünn, bleich, sieht eher der Mutter ähnlich und wird rasch zum schwarzen Schaf der Familie.
Billys Entwicklung verläuft von Anfang an kompliziert. Schon sehr früh scheint es Eindrücke und Einflüsse gegeben zu haben, die ihn in die Rolle des Außenseiters und Rebellen drängten.
Gefährlich wird sich in dieser Familie, in der zwischen den Eltern nie ein lautes Wort fällt, aber ein eher frostig-formelles Klima herrscht, der Einfluss von zwei Frauengestalten ausgewirkt haben, denen etwas Unheimliches anhaftet, die aber im Halbdunkel frühester Erinnerungen bleiben.
Da ist eine alte irische Köchin, die Burroughs retrospektiv mit einer der Hexen aus Macbeth vergleichen wird. Von ihr lernt er Praktiken des Magisch-Unheimlichen, beispielsweise einen Ruf, um Kröten anzulocken, oder einen Zauber, um jemandem das Augenlicht zu nehmen.
Schädigender und das kindliche Bewusstsein nachhaltiger beeindruckend sind die sexuellen Stimulationen, mit denen die Kinderfrau Mary Evans den Jungen an sich zu binden versucht.
Offenbar gibt es da eine verschüttete Schlüsselszene, einen Vorfall, der sich bei Billy im Alter von vier Jahren abgespielt haben könnte, obgleich Burroughs ihn sich auch in späteren Jahren bei psychoanalytischen Behandlungen nie mehr klar und deutlich ins Bewusstsein zu rufen vermocht hat. So bleibt es eine Mutmaßung, dass Mary Evans das Kind veranlasst hat, mit ihrem Freund stellvertretend für sie sexuell zu verkehren. Die Eltern merken offenbar nicht, dass diese Mary Evans trotz ihrer untadeligen Referenzen eine Person mit perversen Neigungen ist. Bill hingegen leidet unter dem Mangel an Kontakt mit seinen Eltern. Er hat manchmal das Empfinden, überhaupt keine Eltern zu haben.
Billy mag unter anderem auch die unsichere soziale Position seiner Familie gespürt haben.
Die Türsteher in den Häusern seiner Spielgefährten aus reichen Familien wollen ihn nicht hereinlassen. Wenn er in einem Geschäft einkauft, wird ihm das Wechselgeld wortlos, ohne Höflichkeitsbezeugungen zugeschoben.
Von der siebten bis zur zehnten Klasse besucht Billy eine Privatschule in St. Louis. Auch hier bleibt er isoliert, zumal er sich nicht für Sport interessiert. Der Lateinunterricht ist ihm verhasst. Die Hausaufgaben erledigt er widerwillig. Er sitzt in der Klasse ganz hinten und zielt in den Schulstunden mit einem Bleistift auf seine Mitschülerinnen und Mitschüler.
1927, Billy ist nun dreizehn, wird St. Louis von einem Tornado heimgesucht. Der Sturm bringt ganze Häuserblocks zum Einsturz. Dreihundert Menschen kommen ums Leben. Auf die öffentliche Katastrophe folgt eine persönliche.
Mit vierzehn experimentiert Billy im Keller mit Chemikalien. Es kommt zu einer Explosion. Der Vater, der sich im Nebenraum aufhält, fährt den verletzten Jungen sofort ins Krankenhaus. Die Operation unter Morphium dauert zwei Stunden. Sechs Wochen muss Billy im Krankenhaus bleiben.
Seine Vorliebe für Sprengstoff und Waffen scheint danach eher noch zugenommen zu haben. Er bastelt eine Bombe und legt sie seinem Klassenlehrer vor das Fenster. Der Sprengkörper wird entdeckt, ehe er Schaden anrichtet. Die Frau des Lehrers verständigt Billys Mutter, und er muss sich entschuldigen gehen.
1929, nachdem der Vater seine Firmenanteile zu Geld gemacht hat, reisen die Burroughs nach Frankreich. Billy geht mit seinem Vater und seinem Bruder auf die Entenjagd. Gewehre, überhaupt jede Art von Waffen, imponieren dem Jungen schon damals ungemein. Aus Europa bringt er einen Stockdegen mit heim.
Wieder in St. Louis, verliebt er sich in einen hübschen, braunäugigen Lockenkopf, Keils Elvins. Der Vater ist ein ehemaliger Kongressabgeordneter, Rechtsanwalt und rabiater Antisemit.
Billy scheint sich zu diesem Zeitpunkt darüber klargewesen zu sein, dass er homosexuell veranlagt ist. Er lehnt später alle psychologischen Erklärungen ab und ist davon überzeugt, er sei so geboren worden.
Der bewunderte Keils ist alles das, was er nicht ist, aber zu sein wünscht: sportlich, populär, ein großer Frauenheld.
Jemand, der Genugtuung dabei empfindet, Frauen zu verführen, ohne sie eigentlich zu mögen, dem es große Lust bereitet, sie zu demütigen.
Ein Lehrer, der das Verhältnis der beiden zueinander beobachtet, sagte zu Billy: ›Du bist ja sein Sklave.‹3
Es wird eine lebenslange Freundschaft.
Immer wieder werden sich ihre Wege kreuzen.
Ohne Zweifel findet Billy das Leben in St. Louis langweilig und die Atmosphäre in seinem Elternhaus wenig herzlich.
Mit dreizehn Jahren entdeckt er ein Buch, das seine Lebensentwürfe und seine Wünsche nachhaltig beeinflusst. Es stimuliert sein langanhaltendes Interesse am kriminellen Milieu und am Verbrechen. Der Autor nennt sich Jack Black, der Titel lautet: You can’t win. Es handelt sich um die Memoiren eines berufsmäßigen Diebes und Rauschgiftsüchtigen. Einer von Burroughs’ Biographen, Ted Morgan, beschreibt den Inhalt und seine Wirkung auf Burroughs wie folgt: ›Jack Black verlässt die Schule mit vierzehn. Er arbeitet in einem Zigarrengeschäft, in dessen Hinterzimmer Poker gespielt und gewürfelt wird. Er dient den Halunken als Laufbursche, und ihm gefällt deren farbige Ausdrucksweise: »Wenn es immer Suppe regnet, hat es keinen Zweck, dass ich mir einen Zinnlöffel kaufe« oder »Ich habe eine Reihe Schulden, länger als die Wäscheleine einer Witwe«. Jack wird ein Einbrecher und macht die Bekanntschaft von Salt Chunk Mary, einer Hehlerin, die alles Diebesgut aufkauft und verkauft, aber »ehrlicher ist als eine goldene Guinee«.‹4
Salt Chunk Mary gehört zur Johnson-Familie, einer Gruppe von Gaunern mit einem eigenen Verhaltenskodex. Die Johnsons verlassen sich nur auf Angehörige des eigenen Klans. Sie sind gegenüber ihrer Sippschaft loyal und ehrlich und helfen sich, wenn einer von ihnen in Schwierigkeiten gerät. Sie mögen Outlaws und Diebe sein, aber gemäß den Gesetzen, die sie sich selbst gegeben haben, sind sie rechtschaffen, und auf ihr Wort ist Verlass. Die Johnsons wurden für Billy zum Vorbild für seine individuelle Moral. Vor allem imponierte ihm der Kontrast zu der Heuchelei, der Geschäftigkeit und der doppelten Moral der guten Bürger in St. Louis.
Natürlich romantisiert der Heranwachsende das kriminelle Milieu. Um es in der Realität kennenzulernen, wird er sich in den nächsten Jahrzehnten seines Lebens immer wieder in Abenteuer einlassen, deren Gefährlichkeit er mit seinem scharfen analytischen Verstand zweifellos abzuschätzen vermag. Warum - so: liegt es nahe zu fragen - lässt er sich dennoch darauf ein?
Er vermeint zu spüren, dass dieser Jack Black und diese Salt Chunk Mary, Gold Tooth und Foot und Half George und all die anderen Leute seines Schlages sind. Er ist nicht mehr allein. Die Johnsons werden zu einem Teil seiner persönlichen Mythologie. Um diese Zeit beginnt Billy selbst zu schreiben.
›Sein erster literarischer-Versuch nannte sich »Die Autobiographie eines Wolfes«. Mari lachte ihn aus und sagte: »Du meinst wohl die Biographie eines Wolfes.« Aber nein, ihm ging es um eine autobiographische Erzählung, in der er ein junger Wolf ist und mit seinem rothaarigen Wolfsgespielen Jerry in einer kühlen Kalksteinhöhle haust, wo sie sich gegenseitig das Blut ablecken, sie sind damit verschmiert von Kopf bis Fuß, denn sie haben in der Nacht ausgiebig Schafe gerissen und sich prächtig amüsiert. Sie lachen über die dummen Rancher, die nicht ahnen, dass sie ihnen die vergifteten Fleischstücke oft meilenweit wegschleppen und am Farmhaus über den Zaun schleudern, wo dann alsbald die Hofhunde daran verrecken. Als die Sonne aufgeht, kuscheln sie sich aneinander und sinken zufrieden rülpsend in den Schlaf.
Doch das Idyll nimmt ein jähes Ende; Jerry wird von einem Jäger erledigt, der Wölfe gegen Prämien abschießt. Audrey, traurig über den Verlust seines Gespielen und überdies von Staupe befallen und entsprechend geschwächt, wird von einem Grizzly erwischt und gefressen.‹5