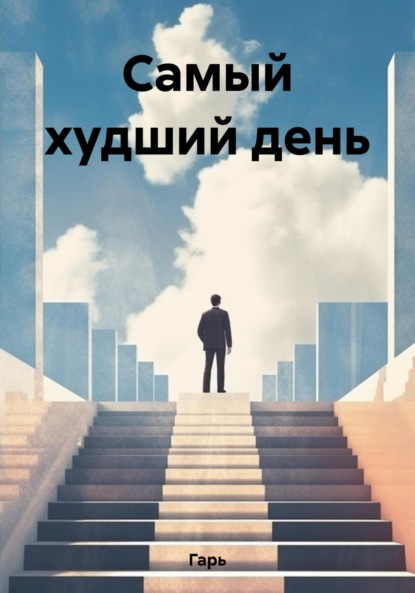- -
- 100%
- +
Die Arbeiter waren damit beschäftigt, die frühen Sorten zu pflücken und in Kisten zu packen. Ein paar hatten ihn gesehen und stießen ihre Kollegen an, um sie auf ihn aufmerksam zu machen. Er fühlte die Blicke auf sich, aber sie waren freundlich. Einige hübsche Frauen winkten ihm zu und er lächelte.
»Wenn wir so groß wären wie du, bräuchten wir die Leitern nicht«, rief jemand.
»Wenn ich so klein wäre wie ihr, würde ich Rüben anbauen«, rief er zurück. Doch auf einmal zerriss ein Schrei die friedliche Atmosphäre, und ehe er es sich versah, stürzte sich jemand auf ihn – ein schwarzhaariger Mann, den Keta nie zuvor gesehen hatte, der ihn jedoch sofort an jemand erinnerte. Der Fremde heulte und fluchte, während er den Riesen mit seinen Fäusten bearbeitete, und Keta, der sich bald von seiner Überraschung erholt hatte, ließ es eine Weile geschehen und versuchte zu begreifen, was ihm da alles an den Kopf geworfen wurde.
»Du warst es! Ich erkenne dich! Du hast sie umgebracht! Du bist schuld! Du hast ihr das angetan!«
Dies war Blitz’ Bruder, das war für Keta unschwer zu erkennen – und aus seinen Schreien sprach ein Schmerz, gefüllt mit dem Dunkel vieler langer Jahre, ein Hass, geboren aus Trauer und ohnmächtiger Wut. Er, der Heiler, fühlte, das hier etwas Altes hervorbrach, das lange Zeit verdrängt gewesen war, ein Geheimnis, das El Jati in sich vergraben hatte und das nun mit der Macht eines Vulkans aus ihm herausquoll.
»Ruhig!«, befahl er mit der Stimme eines Mannes, der einem von Panik erfüllten Tier gut zuspricht. »Ruhig, ganz ruhig.« Er hielt die Handgelenke des Angreifers mit eisernem Griff fest. Dann blickte er auf und sah eine Frau auf sich zustürmen, mit wehendem schwarzen Haar, in der Hand einen Stecken, wie sie von den Pflückern zum Schütteln der oberen Äste verwendet wurden. Sie hielt ihn wie eine Lanze.
»Lass meinen Mann los!«, rief sie zornig.
Keta hatte nicht vor, auf dieser Insel ein Blutbad anzurichten. Bevor die Kriegerin ihn erreichte, stieß er den jungen Mann von sich fort, so dass er rücklings ins Gras stürzte.
»Was ist hier eigentlich los?«, fragte er.
El Jati rappelte sich auf. Er wollte wieder auf Keta losgehen, den Kopf gesenkt wie ein wildgewordener Stier, aber Alika hielt ihn fest.
»Hör auf! Jati, lass es, hör auf!«
Schwer atmend blieb Jati stehen, Tränen liefen ihm über die Wangen. »Du warst es«, wiederholte er anklagend.
»Sage mir, was du mir zur Last legst«, befahl Keta, zugleich sanft und zwingend.
»Du hast meine Mutter umgebracht!«
»Er?«, fragte Alika und Entsetzen und Staunen trat in ihr Gesicht. »Das ist der Riese? Bist du dir sicher, Jati?«
»Und ob ich mir sicher bin! Er hat sie umgebracht. Er hat ihr Gewalt angetan und sie hat es nie verwunden.«
»Mit Sicherheit nicht«, behauptete Keta. »Aber …«
»Nicht hier«, sagte Alika schnell. »Komm mit. Kommt beide mit. Nicht hier vor all diesen Leuten. Komm, dort hinten hinter dem Hügel steht unser Haus. Komm.«
»Du lädtst dieses Ungeheuer in unser Haus?«, fragte Jati entgeistert.
»Ich muss dir etwas sagen«, verkündete Alika. »Was ich schon längst hätte tun sollen. Komm mit.« Ihre Stimme duldete keinen Widerspruch. Sie nahm El Jati bei der Hand und führte ihn nach Hause, und Keta ging ihnen nach, erschrocken und verwundert.
Vor der Haustür versuchte Jati zu verhindern, dass der Riese ihnen folgte, aber Alika befahl ihm zu schweigen und forderte Keta auf, ihr Haus durch die niedrige Tür zu betreten.
»Jati, hör mir zu! Es ist nicht, wie du glaubst. Es war nie, wie du glaubtest. Deine Mutter hat es mir selbst gebeichtet, kurz vor ihrem Tod. Sie hat diesen Mann geliebt, mehr, als sie es jemals hätte tun dürfen. Mehr als deinen nichtsnutzigen Vater. Sie hat …«
»Ähm«, unterbrach Keta. »Ich …«
»Still!«, fuhr sie ihn an. »Jetzt rede ich gerade. Jati, deine Mutter hat mir gesagt, dass du sie einmal überrascht hast. Aber du warst ein Kind. Du glaubtest, der Fremde, den du sahst, würde ihr wehtun, aber so war es ganz und gar nicht. Sie hat ihn wirklich geliebt und sich nur deinetwegen und für Blitz von ihm getrennt. Sie wollte eine heile Familie, falls euer Vater doch zurückkehrte.«
Jati ließ sich auf einen Stuhl sinken. »Das glaube ich nicht«, flüsterte er.
»Und doch war es so. Sie hatte solche Angst, dass du es Jakebeny verraten könntest, wenn er wiederkommt. Deshalb ließ sie dich in dem Glauben, dass der Riese ein Einbrecher war. Sie sagte mir, sie hätte zuerst sogar versucht, es dir zu erklären, aber du hättest nichts davon hören wollen.«
»Das stimmt.« Jati schüttelte den Kopf. »Ich wollte es nicht glauben. Ich dachte, sie wollte mich nur beruhigen.«
»Sie wollte ihr Geheimnis nicht mit ins Grab nehmen. Damals, als wir uns hier das Haus gebaut hatten und als sie dann krank wurde, hat sie es mir gesagt. Sie sagte mir, dass sie niemals jemanden so sehr geliebt hatte wie diesen Riesen. Wie dich«, sagte Alika, an Keta gewandt.
»Nicht ich.« Keta hatte gezwungenermaßen alles mitangehört, aber jetzt musste er sagen, wer es war. »Es kann nur mein Zwillingsbruder sein, von dem ihr sprecht.« Er konnte kaum glauben, dass es hier um Zukata ging. Sein wilder, grausamer Bruder hatte ein Verhältnis mit Blitz’ Mutter gehabt? Eine absurde Hoffnung glomm in ihm auf. »Blitz ist nicht zufällig sein Sohn?«
Das hätte sein Problem auf einen Schlag gelöst, denn sobald Zukata erfuhr, dass Blitz sein Sohn war, würde er ihn bestimmt nicht mehr töten wollen.
»Sie hatte kein Kind von ihm«, sagte Alika und musterte Keta misstrauisch, als könne sie nicht recht glauben, dass es noch einen von seiner Sorte gab.
»Doch«, widersprach Jati.
»Was?«
»Sie hat ein Kind bekommen«, wiederholte er und senkte den Kopf. »Und sie wollte, dass niemand davon erfahren sollte.«
»Sie hat es umgebracht?«, fragte Alika entsetzt. Unwillkürlich legte sie die Hand auf ihren Bauch, und Keta bemerkte, dass sich eine kleine Rundung dort abzeichnete.
»Nein! Oh nein, Alika, das nicht. Ich – ich habe es weggebracht. Zu den Nonnen. Es war ein Mädchen und ich habe es zu den Nonnen gebracht.«
»Deshalb warst du in Salien!« Alika starrte ihren Mann an, als würde sie ihn nicht kennen. »Du hast mir erzählt, du hättest als Jugendlicher eine Pilgerreise gemacht – und dabei hast du deine eigene Schwester weggebracht?«
»Ja.« Jati schaute sie nicht an. Er blickte in Ketas Gesicht und zwang sich dazu, nicht wegzusehen. »Meine Mutter wollte es so. Falls mein Vater wiederkäme; er ist ein strenger, eifersüchtiger Mensch. Und mir tat es auch nicht leid, damals. Es war das Kind eines Ungeheuers, dachte ich. Und wie hätten wir irgendjemandem ein Riesenkind erklären können?«
»Du hast mir das nie gesagt!«, klagte Alika ihn an. »Du hast eine Schwester und sagst mir das nicht? Sie hätte doch hier bei uns aufwachsen können, mit Blitz zusammen!«
»Und warum hast du mir nie erzählt, was meine Mutter dir anvertraut hat? Sobald ich gewusst hätte, dass sie diesen Mann geliebt hat, hätte ich das Kind doch aus dem Kloster geholt!«
Keta hörte zu, wie sie sich stritten, aber in ihm überschlugen sich die Gedanken. Zukata hatte eine Tochter. Wenn er das gewusst hätte, als er nach Manina gesucht hatte! Sie hätten das eine Mädchen gegen das andere eintauschen können!
»Weiß er das?«, fragte er. »Weiß mein Bruder, dass eure Mutter sein Kind geboren hat?«
El Jati schüttelte den Kopf. »Nein. Ich glaube nicht, muss ich wohl sagen, denn langsam glaube ich, ich weiß überhaupt nichts mehr. Er wäre ja nicht der Erste, der sich aus dem Staub macht, wenn eine Liebelei Folgen hat … Nein, ich weiß es wirklich nicht.«
»Wie alt ist sie jetzt wohl?«, fragte Alika.
»Siebzehn«, meinte El Jati. »Und sie war blond, hellblond, mit solchen blauen Augen, wie er sie hat.« Er zeigte auf Keta. »Was habe ich diese blauen Augen gehasst!«
»Wir müssen nach Salien! Wir müssen sie herholen!«
»Jetzt?« Er wies auf ihren Bauch.
Alika lächelte Keta an. »Wir bekommen auch ein Kind, Herr … Wie soll ich dich anreden?«
»Remanaine«, sagte er. »Und ich habe einen Brief für euch.«
»Einen Brief? Von – von deinem Bruder?«, fragte El Jati.
»Nein, keineswegs. Von deinem Bruder.«
Er überreichte endlich die Botschaft, die Blitz ihm mitgegeben hatte.
»Du kennst Blitz?«, rief Alika aus. »Ich habe mich schon gewundert, warum du ihn erwähnt hast … Wo ist er? Geht es ihm gut?«
Jati hatte begonnen zu lesen. Jetzt hob er den Blick und schaute seine Frau mit leuchtenden Augen an. »Blitz ist in Kirifas, beim Kaiser.«
»In Kirifas? Was tut er denn da?«
»Er – lese ich richtig? – er kümmert sich dort um die kleine Tochter des Kaisers? Wie bitte? Wie kommt er denn dazu?«
Keta lächelte. »Habt ihr vielleicht in letzter Zeit Neuigkeiten aus dem Kaiserreich erfahren? Schon mal was gehört vom Helden aus Arima?«
»Der Held aus Arima?«, wiederholte Alika. »Ja, natürlich, der die Prinzessin dem Kaiser wiedergebracht hat …« Ihre Augen wurden groß. »Nein.«
»Doch.«
»Unser Blitz? Unser kleiner Blitz, dieser Taugenichts?«
Jati reichte ihr den Brief. Auf seinem Gesicht lag ein Glanz. »Was für ein Tag«, sagte er. »Schatten aus der Vergangenheit treten zu uns ins Zimmer und dann wieder ist mir, als würde ich der Sonne beim Aufgehen zusehen … Mein Bruder ist am Hof des Kaisers! Und doch wünschte ich, er wäre selbst gekommen, um uns davon zu berichten.«
»Er schreibt, er hat noch eine Überraschung für uns«, sagte Alika erfreut. »Er wird sie uns zeigen, wenn er uns besuchen kommt. Aber er sagt nicht, wann. Weißt du es, Remanaine? Vielleicht besteht die Überraschung darin, dass er draußen vor der Tür steht?«
»Leider nein«, sagte Keta. »Er wird im Schloss bleiben, bis die Prinzessin sich gut eingelebt hat. Dann wird er euch auf alle Fälle besuchen kommen.«
»Und die Überraschung? Was könnte das nur sein?«
Jati lachte. »Zeig unserem Gast nicht so deutlich, wie neugierig du bist, Liebes.«
»Unser Gast, ja!«, rief Alika. »Ist durch das halbe Kaiserreich hergekommen und ich lasse ihn hungrig an unserem Tisch sitzen! Verzeih mir, Remanaine. Jati, gib ihm etwas zu trinken. Ich werde sofort für uns kochen. Du siehst aus wie ein Mann mit gutem Appetit, aber wir kriegen dich schon satt, keine Bange.«
Keta ließ sich Wein einschenken und prostete ihnen zu. Aber über seiner Stirn lag eine Wolke.
Ein Mädchen aus einem Kloster in Salien. Sie war blond und ihre Augen waren blau wie seine …
Will ich es denn wissen?, fragte er sich. Will ich es wirklich fragen? Und wenn ich gefragt habe, was würde ich tun? Was könnte ich tun?
Frag, wie sie heißt, befahl er sich selbst. Es gibt viele Klöster in Salien, viele hellhaarige Mädchen, viele Kinder, die von ihren Familien weggegeben wurden. Zukatas Kind müsste eine Riesin sein … Aber Prinzessin Manina war auch ein Mensch.
Eure Schwester, die Frage lag ihm auf der Zunge, wie heißt sie? Gewiss nicht Ilinias? Es ist doch bestimmt nicht Ilinias, die Frau, die Blitz in einem Kloster in Salien gefunden hat?
Er sah in Jatis lachende Augen.
Was würde ich tun, wenn ich es wüsste? Es ihnen sagen? Ihre Freude zerstören? Heute wurden genug Geheimnisse aufgedeckt, genug für ein ganzes Leben …
Er wünschte sich, er wäre nie hergekommen, auf diese verfluchte Insel, die Minos Unglück bedeutete und Blitz’ Verdammnis.
Er trank den Wein und sah zu, wie Alika kochte, und wünschte sich weit fort in die Wälder.
3. Keine Wahl
» M I RI S TS C H L E C H T . «Erion war grün im Gesicht, aber er beharrte darauf, dass es ihm gut ging. Er hatte kein einziges Mal protestiert, als Zukata ihn aus dem Haus seiner Eltern herausgeführt hatte. Hinter sich hatte er das Schluchzen seiner Mutter gehört und aus irgendeinem Grund wurde er den fassungslosen Blick seines Vaters nicht los. Es war nicht leicht, Wikant von Neiara aus der Fassung zu bringen.
Erion hatte sich nicht umgedreht, als er über das zersplitterte Tor stieg und mit dem Riesen und seinen angetrunkenen Piraten zu den Schiffen ging. Sie lagen dort vor Anker, alle vier, größer und schöner als jedes Boot, das er je hier in Neiara gesehen hatte, und Stolz erfüllte ihn, weil er mit ihnen abreisen würde. Erion mochte keine Schiffe, auch wenn er immer gerne Geschichten gehört hatte, in denen es um Seeleute oder gar Piraten ging. Aber ihm selbst behagten nicht einmal die kleinen Ruderboote, mit denen sich die anderen Kinder so gerne in der Nähe des Hafens herumtrieben. Ein einziges Mal hatten sie ihn mitgenommen. Er wusste, dass er nicht beliebt war, denn als Sohn des Weinfürsten war er etwas Besonderes. Natürlich spüren Kinder so etwas, auch Fischerkinder oder die Sprösslinge der Arbeiter. Schon immer war er anders gewesen als sie. Und dass sie ihm die Bootsfahrt angeboten hatten, war sicherlich nicht aus einem neuerwachten Gefühl der Freundschaft geschehen, sondern nur, um zu erleben, wie ihm schlecht wurde und er sich ganz unstandesgemäß übergab. Damals hatte er sich geschworen, nie wieder den Fuß auf ein Boot zu setzen. Aber natürlich sagte er kein Wort, als der Riese ihm seine Schiffe zeigte.
»Die Perlentaucher. Die Windgesang. Die Goldkiste und die Großer Fang. Auf welches möchtest du?«
Jetzt kam es darauf an, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich werde König sein, dachte Erion. Ich werde der Freund des Kaisers sein. Vielleicht sogar sein bester Freund. Er hat schließlich gesagt, dass der Kaiser immer einen Freund von den Glücklichen Inseln hat, deshalb hat er mich ausgesucht.
»Auf welchem Schiff seid Ihr?«, fragte er hoffnungsvoll.
Der Riese runzelte die Stirn. »Das sind alles meine Schiffe«, sagte er. »Und alles meine Männer. Dort – ja, nimm das.«
Erion bemühte sich, seine Enttäuschung nicht zu zeigen. Es war weder die Goldkiste noch die Großer Fang. Auch nicht die Perlentaucher. Es war kein Name, der irgendetwas mit Reichtum und Erfolg zu tun hatte.
»Die – die Windgesang?« Weder mit dem Wind noch mit irgendeiner Art von Gesang hatte Erion viel am Hut. Das war kein Name für ein Piratenschiff oder für das Schiff eines zukünftigen Kaisers. Es klang nach gar nichts. Aber der Junge nickte und stieg auf das wackelige Brett, das vom Landesteg nach oben führte. Er wollte kühn und aufrecht hinüberschreiten, aber stattdessen konnte er nicht anders, als sich zu bücken und sich festzuhalten. Auf allen Vieren kroch er in die Höhe. Hinter sich hörte er den Prinzen lachen. Vor ihm tauchte ein Mann auf, der ihn in Empfang nahm. Er machte ein etwas verwundertes Gesicht, aber er stellte keine Fragen.
»Na, dann komm mal rauf, du Landratte«, sagte er.
Dies war nicht das Schiff des Riesen. Erion fühlte sich nicht nur enttäuscht, sondern betrogen, als er beobachtete, wie Zukata an Bord der Perlentaucher ging. Er wollte ihn nicht in seiner Nähe haben. Obwohl er es doch versprochen hatte! Erion sah über die kleine Stadt hinweg und heftete seinen Blick auf das Gutshaus oben am Hang. Vielleicht standen seine Eltern dort am Fenster und sahen zu, wie er abfuhr.
»Brauchst nicht zu heulen«, sagte der Pirat neben ihm. »Das Leben an Land ist eh kein Leben.«
»Ich bin Erion«, stellte Erion sich vor, »der Sohn des Fürsten von Neiara.« Fast hätte er gesagt: des Königs. Wenn er zurückkam, würde sein Vater König sein und seine Mutter eine Königin. Und er ein Prinz. Fast war er es jetzt schon. Wenn er zurückkam. Sein Herz rutschte ihm in die Hose, als ihm aufging, dass er keine Ahnung hatte, wann das sein würde. Als er mit Zukata mitgegangen war, hatte es sich angefühlt wie ein spannender Ausflug. Aber nun, auf diesem Schiff, neben einem Seemann, der nichts fürs Landleben übrig hatte, begann er zu befürchten, dass er recht lange fort sein würde.
»Wohin werden wir fahren?«, fragte er.
»Wohin auch immer es den Hauptmann zieht«, sagte der Pirat. Hauptmann sagte er, nicht Prinz, und diese Anrede kam so selbstverständlich aus seinem Mund, dass Erion erschrak. Ein Prinz. Ein Pirat. Ein zukünftiger Kaiser. Und er war nichts als ein Junge, der Neiara noch nie verlassen hatte. Was um alles in der Welt tat er hier auf diesem Schiff?
Er blickte hinunter in das trübe Wasser, das beständig gegen den Schiffsrumpf schlug. Noch waren sie im Hafen. Er konnte nicht schwimmen, aber wenn er sich irgendwo zwischen den anderen Schiffen versteckte …
Eine Hand legte sich auf seine Schulter. Es war nicht Zukatas schwere Hand, aber auch diese war kräftig und das Zupacken gewöhnt.
»Denk nicht einmal daran«, sagte der Pirat. Mehr brauchte er nicht zu sagen. Erion nickte. Er rührte sich nicht von der Stelle, als der Rest der Mannschaft zurück an Bord kam, als der Befehl zum Ankerlichten erteilt wurde. Denk nicht einmal daran. Nein, er sprang nicht. Er sah nur hinunter ins Wasser. Auf die anderen Schiffe. Und auf die Insel, die, während sie kleiner und kleiner wurde, immer grüner zu werden schien, bis sie schließlich verblasste und nichts war als ein Schatten, der im Meer versank.
»Nie«, flüsterte Tinek, »nie wieder lasse ich mich so demütigen.«
Sie beugte sich aus dem Wagenfenster und sah zu dem Schloss zurück, das sich klein und verspielt in die grüne flache Landschaft des Königreichs Drian schmiegte.
Wikant machte sein allerdüsterstes Gesicht.
»Nun, eigentlich haben wir damit gerechnet, oder nicht?«
»Du wusstest, dass sie uns kein Geld geben würden?« Tinek funkelte ihren Mann zornig an. »Ach ja? Deine Hoffnung war mindestens so groß wie meine.«
»Es gab nichts, was wir ihnen anbieten konnten. Wir haben keine Sicherheiten, nichts.«
»Bei Rinland, wir sind verwandt! Reicht das denn nicht!«
Ein gemeinsamer Urgroßonkel reichte nicht, um Geld geliehen zu bekommen. Natürlich hatten sie es beide gewusst. Und doch hatten sie es wenigstens versuchen müssen, das waren sie sich und Erion schuldig.
»Wir könnten dem Kaiser eine Nachricht senden. Das habe ich ja gleich als Erstes vorgeschlagen.«
Tinek schüttelte den Kopf. »Zukata wird der Kaiser sein.«
»Aber noch nicht! Noch ist er es nicht! Wenn wir uns an Kanuna El Schattik wenden? Wenn wir ihn bitten, uns zu helfen? Der Prinz hat selbst gesagt, dass der Kaiser auf der Seite der Glücklichen Inseln steht.«
Tinek rutschte unruhig auf dem Sitz der Kutsche herum. Seit ihr Sohn mit dem Riesen gegangen war, schien auch mit ihren Füßen etwas geschehen zu sein. Sie konnte nicht mehr still sitzen. Unaufhörlich zappelte sie herum. Es machte Wikant halb wahnsinnig, ihr zuzusehen.
»Wie stellst du dir das vor? Wir sagen dem Kaiser, dass sein Sohn unseren Jungen entführt hat. Und dann? Was glaubst du, was Zukata mit Erion machen wird, wenn er Wind davon bekommt, dass wir uns beschwert haben?«
»Er könnte uns helfen«, beharrte Wikant unglücklich.
»Niemand kann uns helfen«, sagte Tinek. »Niemand. Weder hier noch im Kaiserreich. Weder der Kaiser selbst noch sonstwer. Wir müssen ein Schloss bauen. Woher haben die anderen Könige Geld dafür gehabt?«
»Ihre Königreiche sind auch nicht ganz so winzig wie unsere Insel.« Wikant seufzte. »Hast du dich je gefragt, ob Zukata es wirklich ernst meint? Glaubst du, er wird tatsächlich Kaiser? Denn wenn nicht, dann nützen ihm alle seine Drohungen nichts.«
»Und Erion?«
Erion. Die Reden des Riesenprinzen konnten sie als wilde Phantastereien abtun, aber ihr Sohn blieb verschwunden. Wikant überlegte, ob er Tinek darauf hinweisen sollte, dass es keine Garantie gab, dass sie ihren Jungen zurückbekommen würden. Dazu war dieser Handel zu verrückt. Warum sollte jemand von ihnen verlangen, ein Schloss zu bauen? Es ergab keinen Sinn, und wenn ihr Sohn in der Hand eines Wahnsinnigen war, welche Hoffnung gab es dann noch?
Er sah Tinek nicht an, während die Kutsche über die sanften grünen Hügel rollte. Dies war Land. Land. Und was hatten sie, außer einem Weinberg und einem Gut?
Tinek grollte immer noch.
»Sie hätten es wenigstens höflich sagen können.«
»Sie haben es höflich gesagt.«
»Ach was! Sie haben nur so getan!«
Ein Wald tat sich vor ihnen auf, hell und freundlich. Wikant starrte düster aus dem Fenster. Ihm fiel nicht einmal auf, dass die Kutsche plötzlich anhielt. Erst als jemand von außen die Tür aufriss, merkte er, dass etwas nicht stimmte. Denn es war nicht der Kutscher. Es war ein junger, bärtiger Mann mit einem stark ausländischen Akzent.
»Raus hier! Und Geld, aber schnell!«
Wikant stieg aus der Kutsche und half Tinek die Trittstufe hinunter. Es waren fünf. Fünf bewaffnete Kerle. Und sie waren bloß zu zweit; den Kutscher sahen sie nur noch von hinten.
»Da rennt er hin«, murmelte Wikant trübsinnig.
»Los!«, sagte der erste Räuber. »Schöne Leute aus Schloss, Geld, gib her!«
»Er meint«, mischte sich ein zweiter Halunke mit einer vornehmeren Sprechweise ein, »dass ihr uns bitte eure Geldbörsen aushändigen sollt.« Er deutete sogar eine kleine Verbeugung an, aber da er am Oberkörper nichts als eine Weste trug, wurde die Wirkung deutlich geschmälert.
Tinek explodierte. »Was für Geld?«, schrie sie. »Wir haben überhaupt kein Geld! Glaubt ihr, nur weil wir vom Schloss kommen, sind wir edle, reiche Leute! Ja, Geld hätten wir auch gerne, aber sie haben uns dort nur ausgelacht, ihre armen Verwandten, ja, so was von freundlich, wir würden euch ja gerne helfen, aber wir müssen auch unsere Ausgaben berücksichtigen, und – ooooaaah!« Ihre Rede endete in einem lauten, wütenden Schrei.
Die Räuber tauschten verwunderte Blicke.
»Äh?«, fragte der erste Bandit.
»Habt ihr es nicht verstanden?«, fragte Wikant höflich. »Wir haben kein Geld. Das hier ist nicht einmal unsere Kutsche. Wir haben sie nur gemietet, um Eindruck zu schinden, aber es hat reichlich wenig genützt. Von euch einmal abgesehen. Die Reichen fallen auf so etwas nicht herein.«
Tinek zeigte in die Richtung, aus der sie gekommen waren. »Warum überfallt ihr nicht gleich die da? Ich meine, die im Schloss? Da gibt es massig zu holen. Arme Reisende ausrauben, dass ich nicht lache! Da ist das Geld! Das große Geld! Genug für alle!« Unvermittelt begann sie zu weinen, was die Räuber in noch größere Verwirrung stürzte.
»Gebt uns einfach, was ihr habt«, schlug einer freundlich vor. »Ich sehe, du hast da eine Kette um den Hals …«
»Niemals!«, kreischte Tinek auf. »Niemals bekommt ihr diese Kette! Das war ein Geschenk meiner Mutter zur Hochzeit, und ich werde mich nie, nie davon trennen, außer wenn ich sie in Zahlung gebe, um ein paar Steine für das verdammte Schloss zu kaufen, das wir bauen sollen, und dann ist Zukata hoffentlich zufrieden und gibt uns unseren Sohn zurück, und das ist mein letztes Wort!«
Von dem ganzen Redeschwall hatte der Räuber nur ein Wort verstanden. »Zukata?«
»Hat unseren Sohn.« Wikant hatte nicht vor, diese Tatsache überall herumzuerzählen. Im Schloss hatten sie kein Sterbenswörtchen davon erwähnt, dass ihr Sohn entführt worden war. Er macht eine Reise. Darauf hatten sie sich geeinigt. Eine Reise, um die Welt kennenzulernen, und ist das nicht gut für einen jungen Menschen?
»Was habt ihr mit Zukata zu tun?«
Tinek sah das Zeichen auf seinem Arm. Die Krone und das Z darüber, und sie erinnerte sich an Gerüchte aus dem Kaiserreich vor ein, zwei Jahren …
»Ihr seid Zukatas Leute«, sagte sie langsam. »Und wir auch. Nein, nicht so wie ihr. Unser Sohn ist mit ihm auf das Schiff gegangen. Und wir – nun, wir haben den Auftrag, ein Schloss zu bauen …«
»Ein Schloss für Zukata?« Der Räuber schüttelte ungeduldig den Kopf. »Du lügst. Zukata braucht kein Schloss. Kirifas wird ihm bald gehören.«
»Hör mir doch erst zu«, befahl Tinek streng. »Es ist kein Schloss für ihn selbst, sondern das Symbol seiner Herrschaft auf den Glücklichen Inseln. Ist das zu hoch für euch? Dafür brauchen wir das Geld, das diese reichen Schnösel uns verweigert haben. Für Zukatas Sache.«
Wikant hörte ihr mit offenem Mund zu, als sie sich zu dem Riesen stellte, der sie überfallen und ihren Sohn geraubt hatte.
Sie musterte die fünf bärtigen Gesellen. »So geht das nicht. Wenn ihr dort im Schloss etwas für unsere und für Zukatas Sache unternehmen wollt, müsst ihr anders aussehen. Wie – wie Gärtnerburschen vielleicht?« Sie griff mit beiden Händen an ihren Hals und nahm die goldene Kette ab, die sie eben noch mit ihrem Leben hatte verteidigen wollen. »Nehmt das. Besorgt euch andere Kleidung. Lasst euch die Bärte abrasieren. Lasst euch eine Anstellung im Schloss geben.«