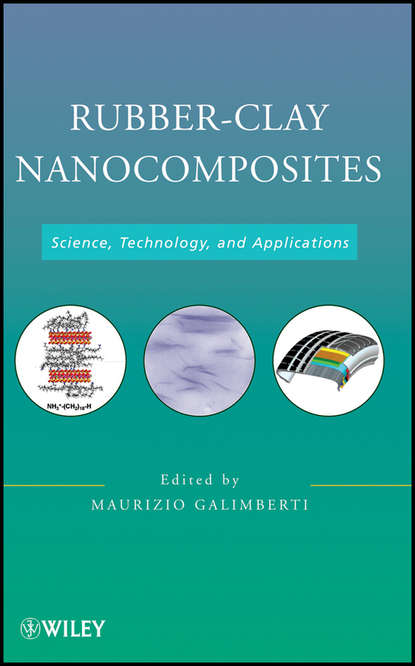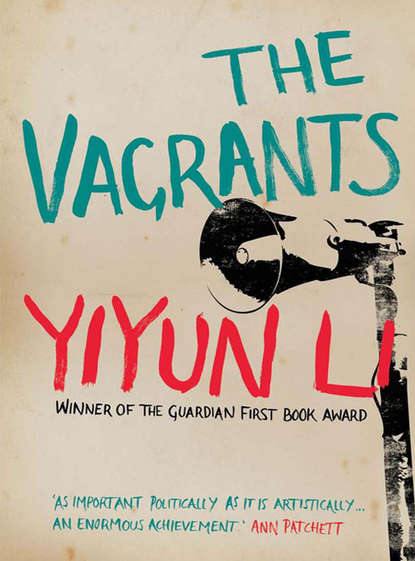- -
- 100%
- +
»Willst du nicht zu deiner Sippe?«
»Fragt der Kerl mich doch glatt, ob ich zu meiner Familie will! Du bist ein wahrer Familienmensch, wie?« Der Zinta funkelte ihn an. Er warf seine Last mühsam ab und bohrte dem großen, starken Neuen den Zeigefinger in die Brust. »Ich werde dir sagen, was du bist. Du bist ein Idiot. Du bist der dümmste Mensch, der mir je begegnet ist. Und jetzt tu deine Arbeit und lass mich in Ruhe.«
Sorayn hatte gedacht, dass der Schmerz ihn verlassen hatte, doch er war da, ein Schmerz, der immer zu ihm gehören würde. Du Idiot … Seht her, den Idioten, was für ein Schauspiel!
Warum hatte er nicht jemand anders in die Gefangenschaft gehen lassen? Einen dieser heißblütigen Burschen, die für Stolz und Ehre lebten? Sie hätten, sobald sie durchschaut hatten, wie es hier zuging, die gleiche Wahl getroffen wie sein Mitgefangener. Man ließ andere nicht für sich sterben. Selbst wenn man in den Staub gedrückt wurde, konnte man den Kopf hoch erhoben tragen, solange man sich nur als Beschützer der Schwachen verstand. Aber er konnte nicht bleiben. Und es stimmte, er konnte alle diese Menschen nicht mitnehmen. Trotzdem musste er es wenigstens versuchen. Er konnte doch nicht zulassen, dass sie hier lebten und unter der Last ihrer Arbeit wankten, er konnte doch nicht …
Sorayn schuftete wie ein Tier. Er schleppte die Säcke so eilig, dass die Frauen kaum hinterherkamen damit, sie zu füllen. Der Deich wuchs in die Höhe und in die Länge wie eine mächtige Schlange, die sich neben den Fluss legte. Manchmal sah er hinaus auf das Wasser und sehnte sich danach, den Schmerz zu kühlen, so wie früher. Sich den Staub abzuwaschen von der Haut, den Sand aus den Augen zu reiben, und darauf zu warten, dass alles, was ihn quälte, weggespült wurde.
Oft sah er den Frachtkähnen zu, die an ihm vorbeizogen, flussabwärts zum Meer, zur Laringer Bucht, flussaufwärts nach Torn und Aifa. Vielleicht war das eine Möglichkeit. Alle Gefangenen auf ein solches Schiff zu bringen und aus der Reichweite der Soldaten zu entkommen. Aber die meisten konnten nicht schwimmen. Sie konnten gar nichts – nicht reiten und nicht schwimmen und sich nicht wehren. Niemand gab dem lächerlichen kleinen Aufseher Widerworte, und Sorayn, der ein einziges Mal seine Zunge nicht im Zaum halten konnte, war mit einem Hungertag für sie alle bestraft worden, genau wie der Zinta gesagt hatte. Das Kind, ein Mädchen von acht oder neun Jahren, hatte sich weinend an seine Großmutter gekuschelt, und er hatte sich geschämt.
»Auf die Knie!« Ein paar Soldaten preschten auf ihren Pferden am Flussufer entlang und trieben die erschrockenen Arbeiter zusammen. »Der Fürst kommt, um den Deich zu besichtigen.«
Pidor, ein schon älterer Mann mit grauem Haar, kam sehr langsam und sehr hochnäsig angeritten, ohne die Gefangenen überhaupt zu beachten. Seine Aufmerksamkeit galt dem Rianang.
»Schon fast fertig!«, rief er erfreut aus, während er den Deich in Augenschein nahm. »Dann können die Stürme kommen, wir fürchten sie nicht.«
»Es ehrt uns, dass alles zu Eurer Zufriedenheit ist«, sagte einer seiner Begleiter.
Der Adlige musterte die Gefangenen. Sorayn hätte sich dazu zwingen müssen, demütig den Kopf zu senken, aber er konnte nicht, und so trafen sich ihre Blicke, und Fürst Pidor zuckte zurück.
»Ein Neuer?«, bemerkte er leichthin.
»Und der Grund, warum wir so schnell fertig wurden.« Der hagere Aufseher drängte sich nach vorne, um auch etwas vom Lob abzubekommen. »Der arbeitet für drei, aber es ist hartes Brot, ihn zu beaufsichtigen.«
»Dann achtet gut auf ihn, dass er nicht abhanden kommt. Den will ich für meine Mühle. Und wenn er einen Fluchtversuch macht, sterben drei. Hört ihr? Zwei von dem Lumpenpack und einer von euch Soldaten. Also bewacht ihn gut.«
»Ja, Herr.«
Der junge Riese merkte, wie die Wachen näher an ihn heranrückten.
»Drei«, wiederholte der Fürst mit leisem Lachen, und der Schmerz in Sorayns Brust schien förmlich zu explodieren.
Er stand auf. »Weiß der Kaiser eigentlich, was hier läuft?«
»Wie?« Pidor hob pikiert die Brauen und wandte sich an den Mann mit der Gerte. »Wissen deine Leute nicht, dass sie mich nicht anzusprechen haben?«
»Runter!«, bellte dieser und versetzte dem aufsässigen Neuen einen Schlag auf den Rücken, der jeden Menschen in den Staub gezwungen hätte.
»Was würde Zukata sagen, wenn er wüsste, was hier geschieht?«, fragte Sorayn, ohne auf die Prügel zu achten. »Und er wird es erfahren, dafür werde ich sorgen.«
Der Fürst beugte den Oberkörper zurück, als der unverschämte Gefangene die Zügel seines Pferdes ergriff. »Wachen!«, kreischte er.
Sorayn griff hinter sich und entriss dem Aufseher die Peitsche. Er zog sie dem Fürsten übers Gesicht, während die Soldaten schon heranstürmten.
»Die Fürsten unterstehen den Königen«, sagte er. »Und die Könige dem Kaiser. Wie kannst du dir erlauben, deine Untertanen so zu behandeln?« Doch schon richtete sich ein Dickicht von Schwertern und Speeren auf ihn und grobe Hände fassten nach ihm.
»Bringt ihn nicht um!«, rief Pidor und befühlte seine Wange, auf der ein roter Streifen aufbrannte. »Den will ich lebend. Den brauche ich für die Mühle.« Er schnaufte. »Habe ich nicht gesagt, ihr sollt auf ihn aufpassen? Bringt ihn in die Mühle. Schmiedet ihn ans Rad. – Du dachtest wohl, du könntest deinem Schicksal entgehen? Dachtest, ich würde es gleich hier und jetzt beenden, wenn du mich reizt? Das haben schon andere versucht. Du wirst nicht sterben. Du wirst so lange leben, wie ich dich leben lasse.« Er blickte über die übrigen Arbeiter hin, die sich ängstlich wimmernd vor ihm beugten. »Ihr wollt euch beim König beschweren? Vielleicht gar beim Kaiser? Ha! Versucht das doch! Ich bin der Herr dieses Landes. Und wie überall in ganz Deret-Aif werden hier die Gesetze des Kaisers aufs Sorgfältigste befolgt.«
»Das kann nicht sein.« Der Riesenprinz hatte das Gesicht des Fürsten die ganze Zeit über beobachtet. Er wollte die Zeichen von Angst und Unsicherheit nicht verpassen, wenn er den Tyrannen daran erinnerte, dass der Kaiser Rechenschaft von ihm fordern könnte. Doch entgegen seiner Erwartung bekam er weder ein Erbleichen zu sehen noch hörte er das geringste Zittern in der Stimme des grausamen Fürsten. Dieser war sich einfach zu sicher, dass weder König noch Kaiser ihn bestrafen würden. »Das darf Zukata nicht zulassen!«
Sorayn fühlte kaum die scharfen Spitzen der Schwerter, die sich ihm durch seine schäbige Kleidung hindurch in die Haut bohrten. Das Beben, das ihn durchfuhr, das ihm den Schmerz zurückbrachte, fühlte sich an, als würde es ihn auseinanderreißen. Er war kurz davor, sich auf seinen Gegner zu stürzen und die Hände um seinen Hals zu legen – und ihm zu zeigen, was es hieß, in einer Welt des Schmerzes zu leben.
Aber seine Wut galt nicht nur Pidor. Zukata war es, der den kleinen Fürsten solche Macht gegeben hatte, der Schrecken und Leid über die einfachen Menschen gebracht hatte. Zukata hatte dies zu verantworten. Zukata – und Sorayn selber. Wie hatte er einem Räuber und Entführer nur den Thron überlassen können, ihm gestatten, ungehindert nach Kirifas zu ziehen! Gerecht und weise wie Kanuna – hatte er wirklich geglaubt, der böse Riese könnte diesen Anspruch erfüllen?
Er musste nach Kirifas. Sofort. So konnte es nicht weitergehen. Er hatte vermeiden wollen, dass einer seiner Mitgefangenen getötet wurde, und war deshalb zu lange geblieben. Nun waren es schon drei, die für ihn sterben würden. Aber hatte er eine Wahl? Wenn er Zukata nicht aufhielt, würden noch viel mehr Menschen sterben.
»Sehe ich Mord in deinen Augen?«, fragte Pidor munter. »Der Kaiser darf tun, was ihm beliebt. Und wenn er der Ansicht ist, dass ihr dreckigen Zintas die Flöhe im Pelz seiner Untertanen seid, dann gebe ich ihm recht. Genau das seid ihr. Und jetzt schafft ihn fort.«
Vierzig Soldaten. Der Prinz hatte in den vergangenen Tagen darüber nachgedacht, sie alle zu töten. Vierzig Mann. Dann konnten die Arbeiter fliehen, ohne verfolgt zu werden, jedenfalls eine Zeitlang, bevor König Settan von Laring davon erfuhr und seine eigenen Truppen schickte. Aber die Flüchtlinge konnten nur sicher sein, solange Sorayn bei ihnen war. Und wie hätte er sie mitnehmen können, auf dem Weg, den er gehen würde, rasch, mit den ausgreifenden Schritten eines Riesen?
Vierzig Mann. War es nicht entsetzlich, alle umzubringen? Nicht nur vierzig Mann, sondern vierzig Männer, vierzig Menschen … Er mochte gar nicht daran denken, dass er im Krieg über seine Feinde geweint hatte, über jeden, der starb. Vielleicht war er gar nicht in der Lage dazu, mit irgendjemandem zu kämpfen. Hatte der Segen ihn in einen Schwächling verwandelt? Ein wenig fürchtete er sich davor, zu erfahren, ob er tun konnte, was getan werden musste, oder nicht.
Vierzig Mann. Er hatte gehofft, dass es einen anderen Weg gab, dass ihm eine andere Möglichkeit einfiel, nicht nur selbst zu fliehen, sondern den Tod der Zurückbleibenden zu verhindern. Er wollte gar nicht feststellen müssen, ob er zu einem solchen Gemetzel fähig war. Vierzig Mann! Gegen drei.
Sorayn senkte den Kopf.
Drei. Drei werden sterben. Nur drei, wenn du ruhig bist, wenn du dich zusammenreißt. Du kannst es. Du kannst dich beherrschen …
Sie führten ihn ab. Er ging in ihrer Mitte, gebeugt, wie einer, der besiegt war, und besiegte doch nur sich selbst. Drei. Es werden nur drei sein …
Die Blicke der anderen waren feindselig. Er hatte damit gerechnet. Auch damit, dass es kaum zu ertragen sein würde, ihren Schmerz und ihren Zorn zu fühlen und zu wissen, dass er ihn verdiente.
»Musstest du das Maul so aufreißen?«, hielt ihm eine der Frauen entgegen. »Und was hast du nun davon?«
Hunger. Ständig. In den vergangenen Tagen hatte Sorayn erlebt, was es bedeutete, nie richtig satt zu sein und dabei noch hart arbeiten zu müssen. Doch die anderen litten darunter noch weit mehr als er. Dass es jetzt zur Strafe gar nichts gab, tat ihm für seine Mitgefangenen leid. Für sich selbst hatte er längst mit allem hier abgeschlossen.
»Na, siehst du.« Der Zinta setzte sich neben ihn ins Stroh. »Genau das habe ich gemeint.«
Das Kind weinte. Diesen Laut zu hören, dieses untröstliche Jammern und Schluchzen, war schlimmer als alles andere.
»Ich werde gehen«, sagte der Riesenprinz laut.
Ein paar lachten ungläubig. Er war gefesselt; die Soldaten hatten ihm, damit er auf gar keinen Fall entkam, Arme und Beine mit einer Eisenkette gefesselt und diese um einen der dicken Balken der Scheune geschlungen.
»Du wirst nirgendwohin gehen.« Bis jetzt hatte keiner mit ihm reden wollen, doch der heutige Tag hatte sie alle so aufgewühlt, dass sie ihre Vorsicht vergaßen. Die Wut auf ihn funkelte in ihren Augen. »Morgen bringen sie dich in die Mühle.«
»Und wir dachten«, sagte die alte Frau, »wir dachten, dass Rin dich geschickt hat, um einen Teil der Last von uns zu nehmen.«
Sorayn bewegte vorsichtig die Handgelenke und horchte auf das Klirren der metallenen Fesseln.
»Ihr dachtet, Rin schickt euch jemanden, der eure Gefangenschaft teilt? Glaubt ihr wirklich, dass er so handeln würde? Würde er euch nicht vielmehr jemanden schicken, der euch befreit?«
Er zog etwas stärker an der Kette und durch das hohe Gewölbe der Scheune lief ein Seufzen.
Fingerdickes Eisen. Es ließ ihn an den goldenen Halsschmuck vornehmer Damen denken, so zart und fein. Das war nichts gegen die riesigen Schlingen der Ankerkette, an der er seine wahre Kraft erprobt hatte. Das knirschende Geräusch von Metall auf Metall klang wie Musik in seinen Ohren.
»Ich habe dir gesagt, dass wir nicht fliehen können«, sagte der Zinta.
»Und du, Großer«, höhnte ein anderer, »wirst auch nirgendwohin gehen.« Warum klangen ihre Stimmen so hasserfüllt? War es die Angst um ihr eigenes Leben oder der Neid auf einen, der es wagte, den Kopf zu heben und dem Fürsten ins Gesicht zu schlagen?
»Kommt mit mir«, forderte er sie auf. Die Balken stöhnten auf, als er die Eisenkette prüfend straffte. Trauriger und bedrängter schienen sie zu sein als die Menschen.
Sorayn fühlte die ganze Last des Mitleids mit ihnen und ihrer Schwäche und ihrer Verzweiflung. Wie viele würden sterben, wenn er floh? Und trotzdem konnte er nicht bleiben. Er konnte sich nicht selbst zum Gefangenen machen. Wie hätte er sein eigenes Leben dafür opfern können – für Menschen, die weiterhin in Knechtschaft lebten? Leiden, damit sie weiterhin leiden konnten? Er horchte in sich hinein, ob der Segen, der ihm schon einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, ihm befahl, alles aufzugeben und hier zu bleiben, aber er fühlte nur das unwiderstehliche Bedürfnis in sich, aufzustehen und in der Dunkelheit zu verschwinden. All das und alle diese Menschen hinter sich zu lassen.
Er konnte sich nicht für sie opfern.
»Ich nehme jeden von euch mit, der mich darum bittet«, zwang er sich zu sagen, obwohl er davon träumte, allein zu gehen, obwohl er mit raschen Schritten Toris und seiner Sippe nacheilen wollte. Aber wenigstens das konnte er noch für diese Arbeiter tun. Vielleicht hatte ja tatsächlich Rin ihn zu ihnen geführt, um ihnen den Weg in die Freiheit zu bahnen. »Auch wenn ich befürchte, dass die meisten von euch zu feige sind, um die Gelegenheit zu nutzen, wenn sie sich bietet.«
»Nicht alle sind so stark wie du«, flüsterte der Zinta.
»Wie stellst du dir das vor?«, rief einer, und zwei Frauen schrien erschrocken auf, als auf einmal Staub und Spinnweben von der Decke auf sie herabregneten.
»Er darf nicht fliehen! Wachen!« Sie drängten sich doch tatsächlich an den Ausgang und riefen verzweifelt. »Wachen!«
Als Sorayn aufstand und die Arme auseinanderriss, fiel die Kette rasselnd von ihm ab. Im nächsten Moment schon öffneten einige Soldaten die Tür, um zu sehen, was der Lärm sollte.
Merkwürdigerweise spürte er keinen Zorn in sich, als er auf sie zutrat, die Kette schwingend, als er sie auseinandertrieb und durch sie hindurchschritt, nach draußen. Er fühlte sich dabei nicht froh. Kummer hing an ihm wie ein weinendes Kind, das sich an seinen Rücken klammerte.
Das Mädchen! Er wandte sich noch einmal um. »Gib mir deine Enkelin«, sagte er zu der Alten, die mit den anderen an die Rückseite der Scheune gewichen war und mit schreckensgeweiteten Augen seinen Ausbruch beobachtete. »Man soll mir nicht nachsagen, ich ließe Kinder für mich sterben.«
»Geh«, flüsterte die alte Frau.
»Nein!« Ein paar hysterische Arbeiterinnen hielten die Kleine fest. »Nein! Wenn sie geht, muss noch jemand sterben! Dann bringen sie noch einen um!«
Sorayn schüttelte den Kopf. Die Traurigkeit kroch ihm in den Nacken und krümmte ihn, schwerer als jeder Sandsack, den er geschleppt hatte. Mit einigen raschen Schritten war er bei den Gefangenen, die sich an das Mädchen klammerten, die Hände in seine Arme krallten, in sein Haar, als wollten sie es nie wieder loslassen. Musste er jetzt schon gegen Frauen kämpfen, gegen hungrige, geschwächte, versklavte Frauen, um ein Kind zu retten? Seine Wut verlieh ihm sonst eine rauschhafte Sicherheit im Kampf, doch jetzt, während er nichts als diese dumpfe Bedrücktheit fühlte, kam ihm jede seiner Bewegungen ungelenk vor. »Gebt sie mir«, befahl er.
»Nein!« Ihre Augen weit aufgerissen, hasserfüllt, fast wahnsinnig vor Angst und Verzweiflung. Hatte Fria, die Riesin, ihm nicht beigebracht, eine Frau zu schlagen? Und doch fiel es ihm schwer, er zögerte, er wünschte sich, sie würden ihm einfach gehorchen, so wie sie dem Aufseher gehorchten und den Wünschen des Fürsten Folge leisteten.
Er verlor zu viel Zeit. Die Soldaten, die er in die Flucht geschlagen hatte, würden in Kürze mit Verstärkung wiederkommen. Wenn er nicht wollte, dass alle vierzig für ihn starben, musste er jetzt verschwinden.
Die Augen des Kindes. Ohne Hass. Erschrocken, ja, aber ohne jene panische Angst, welche die anderen dazu gebracht hatte, sich auf es zu stürzen.
Er wandte sich um. Hinter ihm rief die Großmutter: »Bitte, bitte, nimm sie mit!«
»Soldaten!«, schrie jemand. »Wo bleiben die Soldaten?«
Sorayn trat vor den Balken, der die Scheune trug, umarmte ihn wie einen langvermissten Freund, wie einen zweiten Riesen. Nein, Maja würde er so nicht umarmen, mit einer Kraft, die ihr die Rippen gebrochen hätte. Staub und Heu rieselten von oben herab, ein Ächzen und Wimmern tönte aus allen Winkeln, das Holz kreischte auf …
Die Frauen ließen das Mädchen endlich los und rannten um ihr Leben. Sämtliche Gefangenen strebten kreischend zum Ausgang. Nur die Alte und ihre Enkelin blieben in der hintersten Ecke, als hätte er ihnen befohlen, dort zu warten.
Die hohen Holzwände wankten und wackelten … Er gab dem Balken einen letzten Stoß, lief zu den beiden, die auf ihn warteten – hatte er dieses Vertrauen verdient, dass sie dazu brachte, nicht mit den anderen zu fliehen? –, und warf sich gegen die Bretter. Er zog seine Schützlinge durch die entstandene Öffnung, bevor die ganze Scheune mit einem tiefen Seufzer zusammenfiel.
»Geh mit ihm, Kind«, sagte die Alte. »Ich würde euch nur aufhalten. Kümmert euch nicht um mich! Flieht!«
»Großmutter! Nein!«
Er wartete nicht länger, hob das Mädchen hoch und verschwand in die Nacht hinein.
Er war es nicht gewohnt, Rücksicht zu nehmen. Sie kamen viel zu langsam vorwärts und die Kleine weinte viel. Sorayn war gezwungen, ständig darauf zu achten, dass er sie nicht irgendwo hinter sich verlor. Sie rief nicht, wenn er aus ihrem Blickfeld verschwand, und einmal musste er sie suchen, nachdem er sich länger nicht nach ihr umgedreht hatte.
»So geht das nicht«, sagte der Riesenprinz. »Du musst etwas sagen, wenn du nicht so schnell kannst. Bei Rin, kannst du nicht sprechen?«
Sie sah ihn nur an und Tränen quollen aus ihren Augen.
»Soll ich dich tragen?«
Aber als er die Hände nach ihr ausstreckte, wich sie vor Schreck wimmernd zurück. Auf keinen Fall wollte sie getragen werden.
Es dauerte mehrere Tage, bis er aus ihr herausbekam, wie sie hieß.
»Ori.«
»Was? O-ri?« Er fragte mehrmals nach, denn dieser Name kam ihm merkwürdig vor, aber er war, wie sie ihm versicherte, durchaus üblich.
»Zwei meiner Freundinnen heißen auch so«, sagte sie und dachte dabei vielleicht an die Zeit, in der sie in einem Dorf gelebt hatte, ohne irgendetwas von Fürst Pidor zu wissen, eine Zeit, bevor sie mit ihrer Großmutter in der Knechtschaft gelandet war, denn sie versank wieder in ihr Schweigen, aus dem er sie lange Zeit nicht befreien konnte.
Eine Weile gingen sie auf der Straße, denn Ori fiel es schwer, über Gestrüpp und Dornenranken zu steigen, doch immer wieder ritten Soldaten vorbei. Sorayn hoffte, einen Kampf vermeiden zu können. Er musste sich darauf konzentrieren, für die Verpflegung zu sorgen. Da ihre Verfolger immer noch in der Nähe waren, durfte er kein Feuer anzünden. Jetzt im Herbst bot der Wald Nahrung im Überfluss, Beeren, Pilze, Nüsse, Wurzeln. Sorayn brachte Ori Hände voll schwarzer, süßer Beeren, überreif und köstlich. Gemeinsam sammelten sie Bucheckern und knackten Nüsse. Obwohl die Nächte jetzt schon empfindlich kalt wurden, konnte er dem Mädchen nichts anderes anbieten als eine Kuhle im Waldboden, zugedeckt mit Blättern und Zweigen, und weiches Moos als Kopfkissen. Manchmal weinte sie stundenlang, bis sie vor Erschöpfung einschlief, und am Morgen waren ihre Augen tränennass. Der Prinz hatte nicht das Gefühl, sie gerettet zu haben. Sie schien von einer Gefangenschaft in die nächste geraten zu sein, ausgeliefert einem dunklen Schicksal, dem sie nicht entrinnen konnte, und mehr als alles andere wünschte er sich, endlich die bunten Wagen des Ziehenden Volks vor sich zu sehen, wo sie sich am Feuer aufwärmen konnten, wo Gesang und Gelächter hoffentlich selbst dieses verschlossene, traurige Kind davon überzeugen konnten, dass es in dieser Welt mehr gab als Hunger, Müdigkeit und Kälte. Mit Maja zusammen, so träumte er manchmal, wäre diese Reise herrlich gewesen. Ori dagegen war wie ein Sack Sand, wie etwas, das er Tag und Nacht schleppen musste, ohne je das Ziel zu erreichen.
Obwohl sie so langsam vorwärtskamen, zweifelte er nicht daran, dass er die Sippe einholen würde. Toris und seine Brüder und Schwestern waren spät dran; in den Süden würden sie es vor dem Winter sowieso nicht mehr schaffen. Bald würden sie für längere Zeit das Lager aufschlagen, und dann war es nicht schwer, sie zu finden.
»Halte durch«, sagte er zu Ori. »Bald sind wir da.«
Die Grenze von Pidors Herrschaftsbereich überquerten er und das Mädchen nicht auf der Straße – wo man sie zweifellos an einem Schlagbaum aufgehalten hätte –, sondern im Dickicht, wo keine Soldaten lauerten. Und erst jetzt atmete er wirklich auf. Das Fürstentum ihres Peinigers lag hinter ihnen, weiter durfte er seine Wachen nicht schicken. Sie hatten es tatsächlich geschafft, ohne aufgehalten und in weitere Kämpfe verwickelt zu werden.
Sorayn wagte es auch wieder, den befestigten Weg zu benutzen. Unverkennbare Anzeichen wiesen darauf hin, dass die Zintas hier durchgekommen waren. Wagenspuren, die Hinterlassenschaften von Pferden und Vieh, die Stellen, an denen sie angehalten hatten – all das hatte ihn auch schon beim ersten Mal, als er nach der Sippe gesucht hatte, geleitet.
»Riechst du es?«, fragte er und führte seine kleine Begleiterin von der Straße weg in einen lichten Wald. »Den Geruch von Feuer und Gebratenem? Kinder spielen dort, und hörst du die Hühner und die Ziegen?«
»Ja«, rief das Mädchen aufgeregt.
Da leuchteten schon die bunt angestrichenen Wagen zwischen den Stämmen hervor, ein paar Frauen rührten in den Töpfen über ihren Feuerstellen, lang vermisste Düfte lockten ihn aus dem Wald heraus.
War er jemals irgendwohin gekommen und zu Hause gewesen – außer damals, als er bei Liravah lebte? Doch jetzt fühlte es sich an wie eine Heimkehr, und mit einem Mal verstand er sehr viel besser, warum Keta die Gemeinschaft mit diesen Menschen dem Leben in einem Palast vorzog.
Die Kinder riefen seinen Namen, sobald sie ihn sahen, und wenig später kam ihm sein Schwiegervater entgegen. »Sorayn!« Die Erleichterung stand in sein Gesicht geschrieben. »Rin sei Dank, du bist ihnen entkommen!«
Toris drückte ihn fest. »Kommt alle her, er ist wieder da!«
Ori versteckte sich hinter seinem Rücken. »Später«, versprach der Prinz, wenn die Zintas nach ihr fragten. Viel erzählte er nicht. Wie hätte er davon sprechen können: dass nun, da er geflohen war, drei Menschen für ihn umgebracht wurden. Sogar für das Kind würde ein anderer sein Leben lassen müssen. So sehr hoffte Sorayn, dass die anderen Gefangenen die Gelegenheit genutzt und das Weite gesucht hatten, aber so mutlos, wie er sie erlebt hatte, bezweifelte er das.
»Seid ihr gut über die Grenze gekommen?« Es war ihm lieber, sich über die Erlebnisse der Sippe zu unterhalten.
Toris nickte. »Als du mit den Soldaten mitgegangen bist, gaben sie uns ein Siegel für freies Geleit. Das haben wir vorgezeigt und wurden ungehindert durchgelassen. – Danke, Sorayn.« Und dann sagte er auf einmal: »Maja ist auch in Laring. Gar nicht weit von hier.«
Sein Herz schlug hoch auf. »Tatsächlich? Sie ist hier?«
»Du bist ein guter Junge.« Im Blick des dunkelhaarigen Mannes lag sehr viel Wärme. »Du hast es verdient, dass sie dir noch eine Chance gibt. – Bei Rin, bis heute wusste ich nicht, dass ich es dir sagen würde. Aber ich will erleben, dass diese Geschichte ein gutes Ende nimmt. Geh zu ihr und bring es in Ordnung.«
Sorayn nickte. »Das werde ich tun.«
Am nächsten Morgen gackerten die Hühner besonders laut. Der Prinz, der Toris’ Angebot angenommen hatte, in seinem Wagen zu schlafen, schreckte hoch und blickte aus dem Fenster. »Das kann nicht wahr sein!«
»Was ist los?«, fragte sein Schwiegervater verschlafen.
Der junge Riese nahm sich nicht die Zeit zu antworten. Er stürmte nach draußen.
Schwer bewaffnete Soldaten hatten das Lager umstellt. Ihre Gesichter verrieten viel zu wenig, als warteten sie noch auf die Erlaubnis, sich ungeniert darüber zu freuen, dass sie die Zintas überrumpelt hatten.
»Was fordert der Herr des Landes von uns?«, fragte einer der älteren Brüder. Er trug den gleichen Ausdruck auf dem Gesicht wie Sorayns Mitgefangene, dieselbe resignierte Traurigkeit wie Ori.
»Oh nein«, murmelte Toris. »Nicht schon wieder! Wie sollen wir jemals in den Süden kommen, wenn sie ständig alle etwas von uns wollen?«