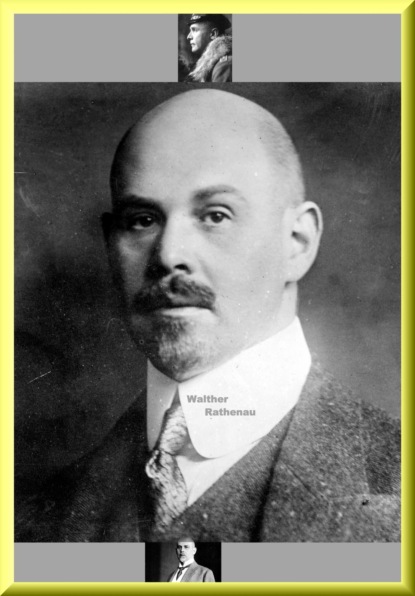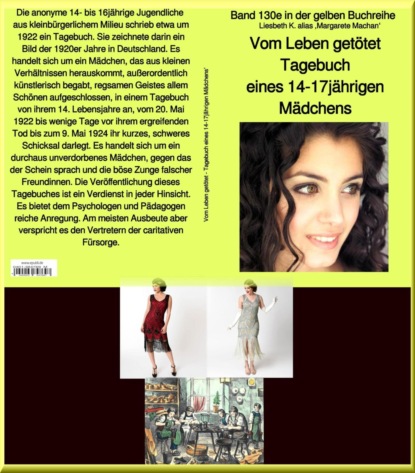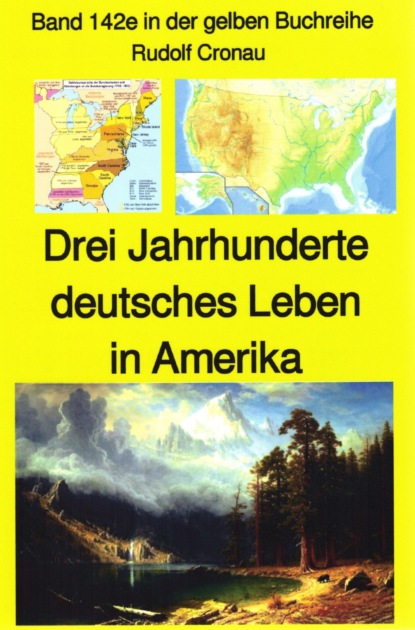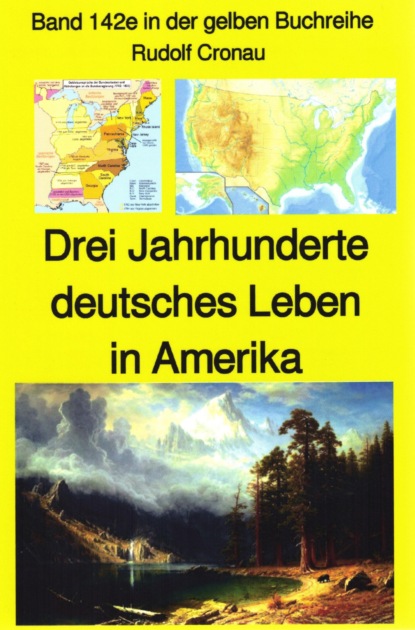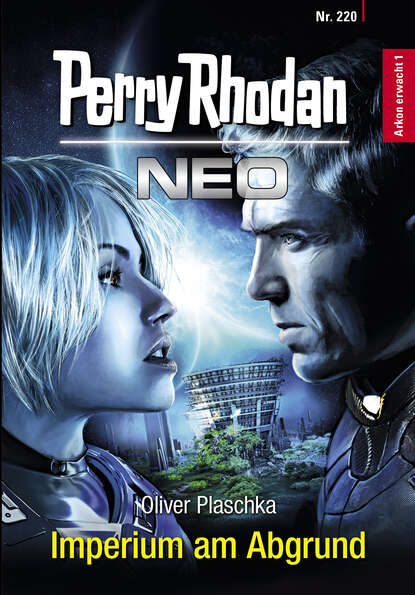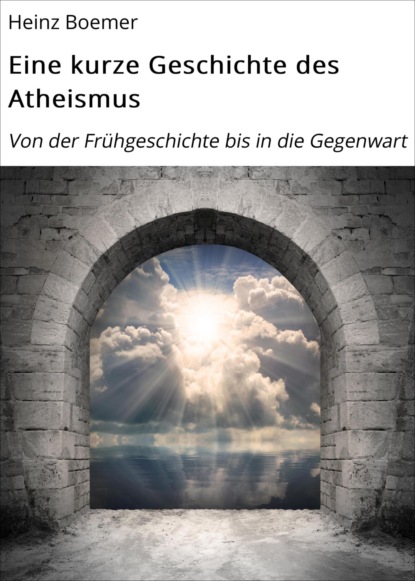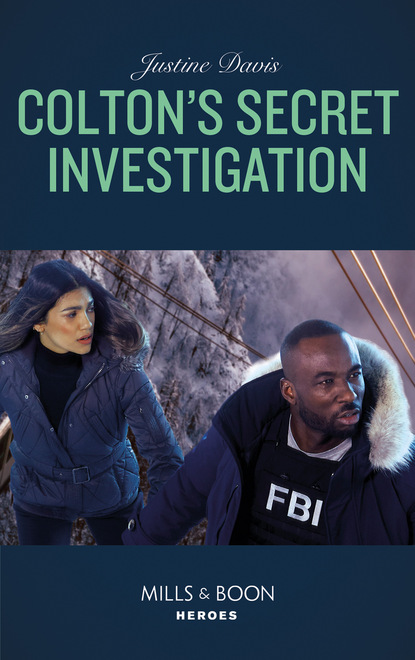Jochen Klepper: Der Vater Roman eines Königs
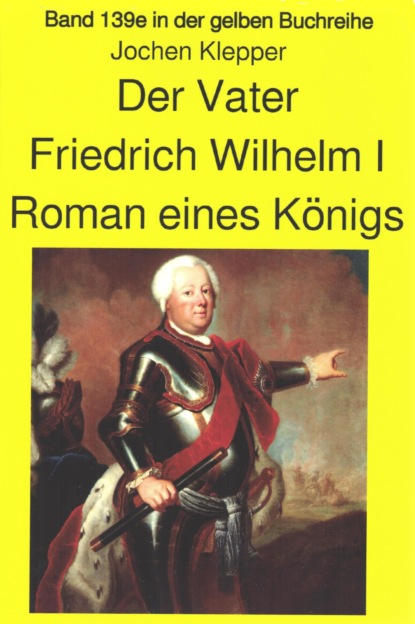
- -
- 100%
- +

Kronprinz Friedrich Wilhelm
Aber Kronprinz Friedrich Wilhelm hatte sogar den Rock abgeworfen; im Wams kniete er vor dem Ofen, so heiß war ihm bei seiner Arbeit geworden. Er besserte den Herd aus und hatte keinen Gehilfen. Die Höflinge gerieten in Verlegenheit. Wie sollten sie sich vor der Hoheit verneigen, wenn diese dem Herdwinkel zugewandt war? Und welche Stellung hatte man einzunehmen, wenn der Königssohn am Boden hockte? Friedrich Wilhelm endete ihre Not sehr rasch. Er stand auf und schritt mit flüchtiger Entschuldigung zu einem Schemel mit einem Becken, goss sich aus der Zinnkanne eisiges Wasser ein, wusch sich, immer wieder zu den Herren blickend, die Hände und trocknete sie an seiner Schürze ab.
„Nachricht über die Pest in Litauen?“
Seine raue Stimme klang in dem Gewölbe noch tonloser als sonst. Der Hofmarschall hielt ihm mit Anmut und Achtung den Brief des Königs entgegen, und der Kronprinz trat auf die Kavaliere zu, das Schreiben des königlichen Vaters aufzubrechen. Zornig fühlte er beim Lesen, dass wieder eine Blutwelle sein verdammt weißes Gesicht überlief. Er hasste seine schöne Haut, das Erbe einer zarten Mutter. Was hatte er nicht schon alles getan, um braun zu werden wie des Dessauers Grenadiere. Seit seiner Knabenzeit hatte er das Gesicht immer wieder mit Speckschwarte eingerieben und sich in die prallste Sonne gelegt; doch es wurde nicht besser.
Die Herren sahen die Röte des Unwillens; sie hörten die tiefe Verstimmung aus seinen Worten.
„Mein Vater überrascht mich damit, dass ich selbst den Taufspruch für meinen Sohn auswählen darf. Übermitteln Sie dem König meinen Dank und melden Sie, 1. Könige 10 Vers 21 schiene mir geeignet. Im Übrigen sehen Sie mich im Augenblick nicht in der Lage, eine Abordnung zu empfangen. Sie finden mich beschäftigt. Auch ist dies kein Ort für Sie.“
Der Hofmarschall versuchte sich in höflichen Einwänden.
„Wenn Königliche Hoheit die Stätte nicht für zu gering befinden –“
Der Kronprinz schüttelte lachend den Kopf, legte seine Hand auf den Arm des Hofmarschalls und führte ihn nicht unfreundschaftlich hinaus. Schließlich war der ja einer der ganz wenigen Männer hier, die er noch für ehrliche Leute ansehen konnte. An der Schwelle hielt er ihn noch einen Augenblick zurück und sagte, allerdings mehr zu den Kammerjunkern gewendet: „Wisst ihr, was in diesem Spruch steht? Aber die Bibel kennt ihr ja alle nicht, trotz eurer frömmlerischen Reden. So werde ich es euch sagen: 'Alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren golden, und alle Gefäße im Hause vom Wald Libanon waren auch lauter Gold; denn das Silber achtete man zu den Zeiten Salomos für nichts'.“
Von dem Schwarm der Höflinge war er nun befreit. Die Gegenäußerung mied jeder. Mit finsterer Miene warf Friedrich Wilhelm wieder Holzscheit um Holzscheit in die Feueröffnung des Herdes. Seltsames Tun für einen Königssohn! Und wunderliche Gedanken für ein der Krone bestimmtes Haupt!
Verstünde der Goldmacher den Spruch – er würde sich gar nicht erst hierher getrauen. –
Besser noch, der König selbst begriffe dieses Wort der Schrift. Gab es denn wirklich in ganz Brandenburg einen einzigen Menschen, der mit dem König an ein Heil vom Goldmacher her glaubte?
Die Antwort erteilte der Kronprinz sich selbst: Zum mindesten sind drei, die das ganze Volk an solchen Zauber glauben machen wollen. Drei sind es, immer wieder die drei, bei denen alle seine Gedanken münden: das dreifache „Weh“, die drei Minister Wittgenstein, Wartenberg und Wartensleben – des Königs Auge, des Königs Ohr, des Königs Mund!
Ach, wäre des Königs Sohn seine rechte Hand. – Das dachte der Kronprinz verbittert. Was galt des Königs einziger Sohn. – Verurteilt war er, das Haupt einer lächerlichen kleinen Garde im Kastell Wusterhausen zu sein, während in der ständigen und unmittelbaren Nähe des Herrschers diese drei Männer mit allen Vollmachten schalteten und walteten zum eigenen Nutzen, zum Leiden des Volkes und zur Verblendung des Königs, eines Königs in geliehenem Prunk und ohne Macht.

Alexander Hermann von Wartensleben
Nur Klagen und Wüten war dem Thronfolger vergönnt; Rechenschaft durfte er nicht fordern. Schuldlose Gegenstände mussten seinen Zorn ertragen. Aber der Arbeit seiner Hände kam es zugute. Er riss den alten Blasebalg herunter. Einen neuen wollte er anbringen für den Goldmacher seines Vaters, ihm einen guten Wind zu machen für seine Schaumschlägereien. Mit aller seiner Kraft hängte sich der junge Mann in die Lederfetzen und Balken; in einer einzigen gewaltigen Anstrengung zerrte er das Gebläse herab. Das Holz zersplitterte, das Leder ächzte, Staubwolken flogen auf, rostige Nägel klirrten auf den Steinboden.
Nun wird ja alles gut werden. Gold wird da sein in Hülle und Fülle, den Pestkranken Lazarette zu errichten, niedergebrannte Städte neu aufzubauen, die Kriegsschulden des Kaisers zu bezahlen dafür, dass man sich König nennen darf draußen vor den Grenzen des Reiches. Mein Sohn ist in herrliche Zeiten geboren! Mein Vater ist Midas, dem die Welt zu Golde wurde!
Das redete der Königssohn vor sich hin, und dabei geschah alles, eine Alchimistenküche herzurichten, der es an nichts mangelte.
Noch vor der Taufe des kleinen Prinzen sollte der Versuch des Goldmachers stattfinden, dass der Kronprinz selbst ihn vorbereiten und ihm vorstehen durfte, hing mit Geburt und Taufe des Stammhalters eng zusammen. Was war für König Friedrichs Freundlichkeit selbstverständlicher als die Gewährung einer, nein, jeder Bitte, die der junge Vater nach der Geburt des nächsten Thronfolgers an ihn richtete?
Friedrich I. hätte seinen Einzigen besser kennen müssen. Er glaubte, mit einer Verstärkung der kleinen Wusterhausener Kronprinzentruppe davonzukommen. Und vielleicht würde noch die Erhöhung seines militärischen Ranges von dem Sohn in Frage gezogen werden.
Aber nun hatte sich alles ganz anders entwickelt. Der Sohn hatte sich ausbedungen, den Grafen Gaëtano (Domenico Manuel Gaëtano – selbsternannter Graf von Ruggiero, Abenteurer, Hochstapler, Alchimist, angeblicher Goldmacher) überwachen zu dürfen. Welch peinliche Angelegenheit für den Herrscher! Wie überlegen hatte doch der Graf gelächelt, als der König ihn auf die Absonderlichkeiten seines misstrauischen Sohnes vorzubereiten suchte.
Gerade durch diesen Argwohn der Königlichen Hoheit, hatte der Graf ihm weltmännisch versichert, gerade durch die Überwachungsmaßregeln des Kronprinzen hoffe er seine Leistung in desto helleres Licht setzen zu können. Er selbst, fügte er mit allem Respekt hinzu, sei auch ein solcher Feuerkopf gewesen; nur jungen Feuerköpfen gelinge später Außergewöhnliches; kurzum, er hatte die Majestät die Peinlichkeit solcher Unterredung kaum spüren lassen. Das verpflichtete ihm den König sehr. Denn Friedrich I. Hasste nichts derart wie unangenehme Situationen. Die Vorgänge seines Tages waren nach einem feierlichen Zeremoniell festgelegt. Wo sollten da die Widrigkeiten des Lebens einen Raum behalten?
Jenes Zeremoniell half dem König aber gerade auch die unabweisbaren Schicksalsschläge ertragen. Er hatte zwei Gattinnen und einen Sohn verloren. Er verklärte ihren Tod. Mit seinem Volke feierte er an den fürstlichen Bahren Feste des Todes mit Fahnen von schwarzem Samt und Fackeln auf Leuchtern von Alabaster und Porphyr. Auch war er zum Sieger über die Vergänglichkeit geworden, begründete er doch eine gelehrte Akademie, um den Unsterblichen im Reiche des Geistes eine Heimstatt im neuen Lande Preußen zu schaffen.
Graf Gaëtano interessierte sich lebhaft für diese Königliche Akademie der Wissenschaften. Ob auch Naturgelehrte sich unter ihren Forschern und Weisen befänden, die man teilnehmen lassen könne an der Entdeckung des Steines der Weisen?
Den König schauerte es, wenn er an dieses zurückliegende Gespräch und das Ereignis, das bevorstand, dachte; Majestät hatten viel Zartes und Empfindsames an sich. Das und nichts Geringeres lag vor dem ersten „König in Preußen“: in seinem jungen Königreich würde für alle Welt, für alle Zeit der Stein der Weisen, das Geheimnis Gold zu machen, gefunden werden! Der ärmste und jüngste König Europas sollte ein Herrscher größer denn Salomo sein, zu dessen Zeiten man das Silber für nichts achtete. Er würde sein Volk beglücken, wie noch nie ein Volk beglückt worden war. Die Armut sollte in seinem Lande nur noch eine Drohung sein, ungeratene Kinder zu erschrecken und zu mahnen. Alles Böse würde allmählich erlöschen, denn wo des Goldes kein Maß und Ende mehr war, hatten Verbrechen und Hass den Sinn verloren. Das Gold war die Tugend. Wie hätte man auch sonst die Kunst, es zu schaffen, den Stein der Weisen nennen können? Der König empfand edel. Graf Gaëtano bestätigte es ihm ergriffen, und der König war entschlossen, ihn nun endgültig als Weisen in den Mächten der Materie und des Geistes zugleich in seine Akademie zu berufen. Da aber die Einführungsfeierlichkeiten für dieses Jahr bereits stattgefunden hatten und zur Zeit kein freier Platz verfügbar war, den der Graf nach den Gesetzen dieser erlauchten Gesellschaft hätte einnehmen können, ernannte die Majestät den Conte vorerst zum Generalmajor der Artillerie ohne Dienst. Nur dass der König bei solcher Erinnerung im Gedanken an seinen Sohn von einem unbehaglichen Gefühl nicht freikam.
* * *
Seit Friedrich Wilhelm zum Staatsrat zugelassen war, zeigte er manchmal eine geradezu verhängnisvolle Art, Zwischenfragen zu tun, die einen beinahe aus der Fassung bringen konnten. Sechs Jahre ging es nun schon so. Den Fünfzehnjährigen hatte der König in schöner Geste und Floskel zu den Beratungen der Minister hinzugezogen, und der junge Mensch machte sich seitdem einen Zwang daraus und versäumte keine Sitzung. Ja, mitunter nahm er bei aller Achtung vor dem König dem Vater das Wort aus dem Mund und gab, ohne dass die Majestät noch widersprechen konnte, der ganzen Verhandlung eine völlig andere Richtung als geplant war. Manchmal wusste man nicht, wer hier der Vater, wer der Sohn war. Fest stand nur, dass der Herrscher mitunter den Thronfolger, niemals aber der Kronprinz den König fürchte. Man bangte sich vor seiner misstrauischen Art, die man von Kindheit an bei ihm wahrnahm; man bangte sich auch namentlich vor seinem kriegerischen Geiste, der sich nun auch im Staatsrat offenbarte.

Kronprinz Friedrich Wilhelm als Kind
Der Unterricht in den Fächern der Kriegswissenschaft war darum immer weiter eingeschränkt worden; denn allein schon um dem Prinzen die lateinischen Konjugationen einprägen zu können, hatte sein Lehrer Rebeur sie ihm als Armeen aufmarschieren lassen müssen, weil er ja so sehr für den Krieg wäre. Jeder Modus war ein Regiment, jedes Tempus eine Kompanie; die Gerundive waren Marketender, die Infinitive und Futura waren Tamboure wegen des „rum“ und „rus“. Seinen Ephorus Cramer aber hatte bereits der Siebenjährige als Lehrer abgelehnt, einmal weil er einäugig, dann aber, weil er ihm zu „effeminiert“ war. Während Cramers Unterricht warf der Prinz sich auf ein Ruhebett, las oder schlief, da Cramer ihm zum Munde redete, im Übrigen aber über seine militärischen Interessen hinweg unterrichtete.
In den fremden Residenzen war schon dies und das über den jungen Wilden durchgesickert, und die verstorbene Mutter hatte sich einst alle Mühe gegeben, seine Härten zu mildern und ihn durch verzweifelte Dispute über Bücher für die Große Welt zu retten. Denn er lauschte von der frühesten Knabenzeit an den Pferdeknechten und Domestiken ihr grobes Deutsch ab, obwohl er das artigste Französisch sprach, das einer sich nur denken konnte.
Sonst ahmte er die gemeinen Soldaten nach, rauchte Tabak, fluchte, band sich einen Riesensäbel um und redete mit Vorliebe die niedrigsten Soldaten an, und zwar in ihrem Umgangston. Alle Frauen, auch die eigene Stiefschwester, nannte er Huren. Wenn er nicht fluchte, sprach er schnarrend, leise, kurz und abgerissen, sprach überhaupt ungern; fand er eine Antwort nicht, so runzelte er die Stirn; beim Sprechen nahm er stets, wie ein kleines, verängstetes Kind, den Daumen in die linke Hand; aber es kränkte ihn aufs tiefste, als sein großer Degen einmal durch einen passenderen, kleinen ersetzt wurde. Er ging einwärts, lief mit unsauberen Handschuhen und ungeputzten Zähnen umher; und immer hatte er Hunde um sich, gleichgültig, ob sie dem König Möbel und Gärten verdarben oder nicht. Im Zimmer ging er lieber durchs Fenster als durch die Tür, und in den Räumen des Vaters durfte er sich überhaupt nur aufhalten, wenn er das ausdrückliche Versprechen gab, nichts darin zu verderben.

Schloss Charlottenburg
Einen Entrüstungssturm rief es hervor, dass der Prinz im Schloss mit Reitstiefeln umherging, statt in leichten, eleganten Schuhen, wie die gesamte Hofgesellschaft es ausnahmslos tat. Auf die Schleppen der Damen hatte er es ebenso abgesehen wie auf die Schienbeine seiner markgräflichen Onkel. So hatte es seinen guten Grund, dass die Königin, weilte sie in Berlin, den Sohn täglich einmal sehen wollte; hielt sie sich aber auf ihrem geliebten Lietzenburger Schloss Charlottenburg auf, so musste er doch wenigstens einmal in der Woche zu ihr hinauskommen. Dafür hatte er einen eigenen kleinen Wagen, mit dem er auch wirklich regelmäßig zu antikischem Dialoge nach Lietzenburg und den er endlich auch in Trümmer fuhr. Ritt er aber, so umgab man ihn angstvoll mit vier Wächtern; denn der Knabe nannte sich selbst zwar dick und verschlafen, war aber in seiner, ihm selbst immer viel zu geringen Tollkühnheit so zart, dass er unter der geringsten Hitze sehr litt, zu jäh sein Gewicht verlor, rasch in hohes Fieber fiel und dauernd quälende Kopfschmerzen zu verschweigen hatte.

Königin Sophie Charlotte
Sorgfältig wählte Königin Sophie Charlotte alle Lektüre für ihn aus; immer wieder griff sie auf Fénelons „Telemach“, den schwärmerischen Fürstenspiegel, zurück. Friedrich Wilhelm wollte – abgesehen von der Selbstüberwindung, die er an ihm anerkannte – ganz und gar kein Telemach in Fénelons, der Königin und ihrer bewunderten Antike Sinne werden und wartete bei den wöchentlichen Dialogen mit seiner Mutter recht beharrlich mit demselben Satz aus Xenophons moralisch-politischen Schriften auf; was dort vom rastlos tätigen König Kyros ausgesprochen wurde, bedeutete ihm die höchste Weisheit aller Bücher: „Die sichersten Mittel, einem Volk, einem Land, einem Königreich eine dauerhafte Glückseligkeit zu verschaffen, sind ein Heer auserlesener Soldaten und eine gute Wirtschaft der Bürger.“ Allenfalls wollte er Titus sein: der küsste die Guten und bedachte die Bösen mit Nasenstübern. Die Guten aber waren dem Knaben die Fleißigen und Geringen, die Bösen die Vornehmen und Müßiggänger. Darauf gab man bei Hofe acht; ein Schneider hatte bei dem Thronfolger den Vortritt vor einem Baron.
Der Prinz verstand nur wenig von der Meinung seiner Eltern, dass Gold einen Besitz erst bedeute als Fest oder Kunstwerk oder geistige Schöpfung. Der Zehnjährige schon führte zum Entsetzen der hohen Familie und ihrer Höflinge ein Kontobuch, dem er die Aufschrift gab: „Rechnung über meine Dukaten.“ Er schien nur das Rechnen gelernt zu haben – und war doch immer ein ganz besonders schlechter Rechenschüler gewesen. Alles war in seinem Kassenbuche vermerkt: die Neujahrsgeschenke an die Dienerschaft genauso wie eine gelegentliche Anleihe von einem Taler bei dem Küchenmeister Jochen, der Preis für ein paar junge Füchse genauso wie Ausgaben für Blumen und Farben zum Malen. Damit trieb er es eigentlich recht arg.

Die Großmama in Hannover
Lediglich die Großmama in Hannover lachte darüber, und man wusste nicht gewiss, ob über den kleinen Geizhals oder die dauernde Wiederkehr eines Postens junger Füchse, Hasen und Farbentöpfe.
Sie, die schon den Neugeborenen, Starken, Gesunden gleich nach der Geburt nach Hannover zu entführen gedachte, schien ihn mit anderen Augen zu sehen als das hohe Haus und der Hof.
„Er weiß die Details von alles, er weiß wie ein Dreißigjähriger zu reden; jedwedem sagt er etwas Obligants“, so schrieb sie von dem dreizehnjährigen Gast auf ihrem Lieblingsschlosse Herrenhausen, „er sieht aus wie man die Engeltien malt, hatt ein Hauffen blundt her; wan die frisirt sein, sieht er aus wie man Cupido malt.“

Gottfried Wilhelm Leibniz – 1646 – 1716
Seltsamerweise hat auch Leibniz, der große philosophische Freund der Mutter, mit solcher Zartheit von ihm geurteilt – und musste doch eigentlich bangen für den weisen Erziehungsplan, den er für den jungen Wilden aufgestellt hatte!
Schließlich musste aber auch die Königin, die verschwenderischste, leichtsinnigste, schöngeistigste aller Mütter, den jungen Wilden über alles geliebt haben. Denn als der Siebzehnjährige seine Prinzenreise an die fremden Höfe antrat, die Fahrt nach Brüssel, Holland und Italien, stand in ihrem Tagebuche ein einziges trauriges „parti“. Doch schien ihr die Große Tour des jungen Herrn aus hohem Hause der letzte Versuch, seine Rauheit zu glätten.
Nach dieser Reise sollten Mutter und Sohn sich nicht wiedersehen. Die Königin starb nach ihrem großen Karneval, um dessen Freuden sie sich durch Krankheit nicht betrügen lassen wollte. Das Leben war ihr Traum und Feier und Gedanke gewesen. Lesend, musizierend, diskutierend, tanzend und für ungefährliche Liebschaften schwärmend, hatte sie es hingebracht. Nach dem Tode der Mutter wurde Friedrich Wilhelm sichtlich noch schroffer. Der König war seitdem um den Sohn sehr besorgt. Nur jetzt, in den Ereignissen um Gaëtano, hätte der König ihn mehr als nur „parti“ gewünscht, um bloß den Unannehmlichkeiten bei der Begegnung zwischen dem Kronprinzen und dem Conte enthoben zu sein.
* * *
Friedrich I. zog, als bedeute es Abwehr und Schutz, seinen Zobelmantel fest um die Schultern und Hüften, dass man die Seide knistern hörte, mit der er gefüttert war. Der Hofmarschall war froh, dass der König sich nach so langem Sinnen wieder regte. Solange die Majestät in düstere Gedanken versunken schien, wagte der Marschall nicht zu sprechen; und ihn beschwerten so dringliche Fragen. Endlich wandte ihm der Monarch sein lockenschweres Haupt wieder zu, und über seinen Zügen lag die alte Freundlichkeit. Der Herrscher sah es ein. Die Sorgen des Oberhofmeisters waren nicht leicht zu nehmen. Wie hatte man die Stätte des alchimistischen Laboratoriums, für die der Kronprinz nun einmal eigensinnig die alte Gesindeküche bestimmte, für den königlichen Zuschauer und seine Gäste herzurichten? Welche Treppen durften Majestät benützen, wenn sie zum Keller hinab schritten? Welcher Anzug war für solchen Anlass angebracht?
König Friedrich gab sich äußerst vertraulich. Er sei ebenfalls ratlos. Man möge sich mit der Prinzessin von Brandenburg-Ansbach, die als liebster Gast bei Hofe weilte, ins Benehmen setzen.
Die wisse in solch schwierigen Lagen stets einen Ausweg. Die habe, von der verstorbenen Königin selbst für das Hofleben erzogen, das feinste Gefühl für derartige Besonderheiten.
Die Ansbacherin half. Mit ihren großen, grauen Augen sah sie einen Augenblick den König schweigend an.

Prinzessin von Brandenburg-Ansbach Friederike Luise von Preußen
Dann war, wie immer bei ihr, die Lösung schon gefunden. Der Akt in der Gesindeküche sei eine Angelegenheit der Forschung und müsse in allem Ernste vor sich gehen.
Friedrich I. empfand beglückt, dass er sich immer und in allem auf das Geschick und die Klugheit jener jungen Kusine verlassen durfte. Er war entschlossen, sie mit einer kleinen Statue aus lauterem Golde zu überraschen. Das Kunstwerk sollte sie selbst als Pythia am Delphischen Orakel darstellen; es würde entzückend werden; er sah es vor sich. Immer war der Spruch der Ansbacherin unfehlbar, und vor noch schwereren Aufgaben hatte sich die Sicherheit ihrer Entschlüsse bewährt. Selbst Friedrich Wilhelm, ihn, der unbeeinflussbar schien, hatte sie allein zu lenken vermocht; und das in den schwersten Wirrnissen und Widerständen, denen des Herzens.
* * *
Es war schwierig gewesen mit dem Kronprinzen und den Frauen. Den Versuch der Mutter, ihn nach der von ihr heraufbeschworenen, schmerzvollen Knabentorheit ein zweites Mal durch anmutige Liebesgeschichten gefügiger zu machen, trat er mit offener Ablehnung und unverhohlenem Spott entgegen. Die Verführung durch das Fräulein von Pöllnitz, von der Königin veranlasst, reizte ihn zu maßlosem Zorn und stürzte ihn in tiefste Scham. Kam er von den Festen der Mutter aus ihrem neuen Schloss Charlottenburg, für die Königin und ihre Damen wie ein Kavalier gekleidet, warf er Brokatrock und Perücke zornig in einen Winkel und trat die weiße Lockenpracht mit Füßen. Die Diener berichteten es zuverlässig.
Verlangte es aber die höfische Sitte, dass jüngere Damen des Hofes der kronprinzlichen Hoheit die Hand küssten, so errötete der breitschultrige junge Mann über das ganze Gesicht.
Aber dann war des Vaters Ansbacher Kusine zum Berliner Karneval gekommen: liebenswürdig an allen Veranstaltungen des hohen Vetternpaares Anteil nehmend und doch ein wenig abwesend in ihren Gedanken; mit hellen, leuchtenden Augen und dennoch einem ernsten Schatten um die Lider; mit einem süßen und sehr weichen, jungen Mund, doch einer Stirn von männlicher Kühnheit. Und plötzlich errötete Kronprinz Friedrich Wilhelm nicht mehr vor den jungen Damen des Hofstaates, sondern nur, wenn die Ansbacher Brandenburgerin ihn ansah, flammte die jähe Röte über sein weißes Gesicht, dessen Zartheit er hasste.
„Sie sind mein Neffe, gewiss“, bemerkte lächelnd die Ansbacherin, „aber ich bin kaum fünf Jahre älter als Sie, und Sie tun mir fast ein wenig zu viel Ehre an.“
„Sie haben sehr groß gehandelt, Madame“, antwortete er, und seine Stimme war nicht rau und schnarrend wie sonst; die Röte war wieder verflogen.
Aber nun trieb es der Ansbacherin das Blut in die Wangen. Denn war sie auch die Ältere, so war sie doch sehr jung. Er sprach von der spanischen Affäre!
Friedrich Wilhelm fuhr ruhig fort: „Um des evangelischen Glaubens willen auf die Krone Spaniens, ja, die Hoffnung auf den Thron der deutschen Kaiserin, zu verzichten, dazu waren unter den Fürstentöchtern nur Sie fähig.“
Der Ansbacherin entging es nicht, dass das gewählte Französisch, das der preußische Thronfolger sprach, einen besonderen Klang hatte. Aber es war mehr der Ausdruck, den er seiner Rede gab, was sie so anzog. Der Kronprinz war so voller Widersprüche und in all den Gegensätzen seines Auftretens und Wesens so bezwingend, wenn man nur nicht sein Leben an den Unsteten zu heften brauchte; wenn man nur nicht seinen eigenen Willen unter seinen Starrsinn beugen musste; denn der Wille galt der jungen Fürstin viel.
Sie sah ihn lange an, und dabei gewann sie ihre Festigkeit und Kühle wieder. Er hatte die ernstesten und klügsten Augen, in die sie je blickte, und schmale, lange, feste, leicht gebräunte Hände, wie sie im Brandenburgischen Hause vor ihm noch keiner besaß.
Als ihr dann der Prinz von seiner Liebe zu sprechen begann, hatte die Ansbacherin von seinen Händen und Augen schon Abschied genommen.
Es war nicht nötig, dass der Generalmajor und Obermundschenk von Grumbkow ihr die Gründe der Staatsräson auseinandersetzte.

Generalmajor und Obermundschenk von Grumbkow
Niemals hatte er, der nur für die unentwirrbarsten Geschäfte bemüht wurde, es leichter gehabt. Die Ansbacherin nahm ihm die Worte von den Lippen, ehe er sie aussprechen konnte. Ihm blieb nur übrig, zu bewundern, anzuerkennen und im Namen Seiner Majestät zu danken.