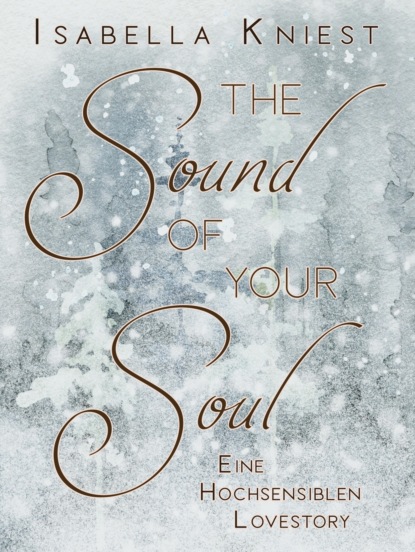- -
- 100%
- +
Anfangs hatte ich mich einsam und verloren gefühlt. Nun war dieses Einzelgängersyndrom zu einem selbstverständlichen Teil meines Lebens geworden.
Und ich wollte niemals mehr etwas daran ändern.
Kurze Bekanntschaften waren in Ordnung – doch richtige Freunde? Nein! Weder brauchte ich Menschen zur erheiternden Konversation noch zum Ideenaustausch. Lieber schwieg ich für den Rest meines Lebens und verkroch mich in meiner Wohnung. Wenn ich mich mit Leuten intensiv unterhielt, wurde ich meistens ohnehin verletzt, missbilligend angeblickt oder mit unnötigen neunmalklugen Sprüchen bombardiert.
Beispiele gefällig?
Du musst dich öffnen, dann kommen die Leute auf dich zu!
Du musst dich an die Gesellschaft anpassen, dann wirst du dir keine blöden Meldungen mehr anhören müssen!
Du musst deine Mitmenschen akzeptieren, wie sie sind! Du darfst keine Vorurteile hegen!
Insbesondere die Sache mit den Vorurteilen hatte mir eine regelrechte Ohrfeige verpasst. Stets war ich diejenige gewesen, die Menschen bedingungslos und mit all ihren Macken und Vorurteilen akzeptiert und niemanden in eine Schublade gesteckt hatte. Ich hatte lediglich ebenfalls akzeptiert werden wollen – ob Personen meine Geisteshaltung und Lebenseinstellung verstanden oder nicht, war mir gleichgültig. Hauptsache in einem normalen vernünftigen Maß als Mitmensch und Individuum angesehen zu werden. Doch nein, das Gegenteil traf ein: Man machte sich lustig über mich, man ignorierte mich oder man beleidigte mich. Darum hatte ich mich an die Gesellschaft angepasst, indem ich mich von dieser abgewandt hatte.
Eine jede Person war ein singulärer, in sich geschlossener Mikrokosmos, in welchem unbekannte Naturgesetze vorherrschten. Solange Menschen nicht reif oder weise genug waren, um diese Wahrheit zu begreifen oder zumindest zu akzeptieren, würde ich mich weiterhin von ihnen distanziert halten.
»Was die Schule anbelangt«, erwiderte Tom und beendete damit meine philosophischen Ergüsse. »Ja wahrscheinlich. Ansonsten jedoch –« Die Intensität seines mich aufwühlenden Seelenblicks verdreifachte sich. »Sind Sie … nun … arbeitslos?«
Noch nie hatte ein Mensch mich dermaßen interessiert gemustert. Keine Sekunde blickte er zur Seite – ausschließlich meine Augen hielt er anvisiert. Zu meiner eigenen Überraschung fühlte sich diese Seelenerkundung zu keiner Zeit unbehaglich oder aufdringlich an. Eher sogar angenehm, vertraut, verschmelzend.
Es war irrsinnig …
Diese ganze Situation war irrsinnig … und maßlos verwirrend.
»Nein, nein. Ich bin nicht arbeitslos«, erwiderte ich und zwang mich krampfhaft, mich nicht noch weiter von seinem hypnotisierenden Blick einlullen zu lassen. »Allerdings mag ich es nicht, Arbeit und Privates zu vermischen.«
Betrachtete er eine jede Person auf diese eindringliche Art? War dies eine natürliche Verhaltensweise seinerseits?
Ich dachte zurück an den kurzen Wortwechsel mit der Kellnerin – und meine Frage war beantwortet. Ja, auch sie hatte er auffallend angeblickt … Womit meine minimale Hoffnung auf eine ehrliche Sympathie Toms zu meiner Person hin augenblicklich verstarb.
Es lag ihm eben nichts an mir. Hier ging es, wie üblich, um Selbstsucht, sprich ein unbefangenes Gespräch, um die Zeit totzuschlagen, oder die Hoffnung auf einen One-Night-Stand.
Hilflosigkeit in Kombination mit vorgegaukelter Wertschätzung wirkte beim weiblichen Geschlecht wie ein Brandbeschleuniger. Waren Männer sich dieses Vorteils bewusst, nutzten sie diesen schamlos aus – was im Umkehrschluss bedeutete, dass die leidtragenden Frauen ausgenutzt und schlussendlich weggeworfen wurden.
»Oh.« Er hielt inne – schien angestrengt zu überlegen. »Ich verstehe.«
Wertete er mein Verhalten? Suchte er eine Bestätigung? Ein Zeichen, ob ich Interesse an ihm hegte? Ob ich willig war, ihm blind zu vertrauen … ?
Kälte kroch mir in die Glieder.
Wollte Tom mich rumkriegen und ausnutzen … wie mein fürchterlicher Ex-Freund?!
Eine heftige Gänsehaut raste mir stechend über den Körper.
Nein, nein! Von mir erhielt kein Mann mehr Bestätigung, Verständnis oder Mitgefühl! Diese Zeit war lange vorüber! Ich war nicht mehr das naive, blinde Schulmädchen!
Wahrscheinlich war es besser zu gehen, ehe ich mich noch gänzlich von diesem Mann einlullen ließ und mir gar eine Beziehung mit ihm zu wünschen begann.
Ich wollte mich erheben, da startete die zweite Hälfte des Auftritts – und wie das Schicksal es wollte, musste die afrikanische Frau einen meiner Lieblingssongs anstimmen: »Hallelujah« von Leonard Cohen.
Sie sang sämtliche Verse: die aus seiner ersten Version sowie die aus den späteren.
Ich liebte die Melodie und Cohens Stimmfarbe, viele Stellen des Textes jedoch waren blanker Hohn. Hohn gegenüber Frauen. Es war mir schleierhaft, weshalb gut aussehende Frauen von Männern im Allgemeinen stets manipulierend angesehen wurden. Ob im biblischen oder im alltäglichen Sinne, Frauen waren die Verführer: Eiskalt und berechnend … und sobald sie hatten, was sie wollten, schlugen sie erbarmungslos zu. Dabei waren es die Männer, welche Frauen die große Liebe vorgaukelten, einzig um sie kurz darauf stehenzulassen – nein, fallenzulassen, in einen dunklen Abgrund …
Männer betrogen ihre Ehefrauen, kümmerten sich nicht um ihre unehelichen Kinder oder schlugen gar ihre Familie. Aber es war ja bekanntlich leichter, eine hübsche Frau zum Sündenbock zu degradieren, anstatt seine eigene Schwäche einzugestehen und zu sagen: »Ja, ich fand sie schlicht und ergreifend attraktiv und deshalb habe ich meine Frau betrogen.«
Wie hieß es noch gleich?
Zu einem Betrug gehören immer noch zwei.
Selbst wenn eine wunderschöne Frau einen verheirateten Mann bezirzte, bedeutete dies noch lange nicht, seinen Trieben nachzugeben und mit ihr ein Techtelmechtel anzufangen. Falls einem Mann etwas an seiner Ehefrau lag, hinterging er diese nicht. Punkt. Alles andere waren billige Ausreden. Ebenso verhielt es sich vice versa. Entweder man war treu und liebte einander, oder man musste sich trennen.
Fatalerweise lief es heutzutage nicht mehr auf diese einfache, korrekte Weise. Vor allem, da Männer sich seit jeher in die Opferrolle hüllten – betrogen und ausgenutzt von Frauen, von der Arbeit, von Kollegen, von der Welt …
Und schließlich folgte das i-Tüpfelchen: die Mütter.
Hatte eine Frau mehrere Kinder und darunter befand sich ein Sohn, wurde dieser zumeist verhätschelt ohne Ende. Insbesondere, wenn dieser überdurchschnittlich schlecht in der Schule war und selbst rein gar nichts auf die Reihe brachte. Dann bekam dieser Geld zugesteckt, erbte später Haus und Hof … und allfällige Töchter? Die mussten schauen, wo sie blieben.
Ach ja, die armen Männer! Mein Mitleid hielt sich in Grenzen.
»Gefällt Ihnen das Lied?«
Ich drehte mich zu Tom.
Ich musste gestehen, kurzzeitig hatte ich ihn vergessen.
Meine gedanklichen Ausschweifungen wurden von Jahr zu Jahr schlimmer …
Toms durchdringender wie fragender Gesichtsausdruck brachte mich komplett in die Realität zurück.
Ich wollte mich doch längst auf dem Nachhauseweg befinden!
Verfluchte Musik!
Immer dasselbe! Vernahm ich ein schönes Lied, konnte ich mich nicht davon abhalten, es bis zum Schluss anzuhören.
Seufzend lehnte ich mich zurück.
»Sara?« Tom sah mich nach wie vor neugierig an. »Gefällt Ihnen dieses Lied?«
»Ja.«
Er lächelte vergnügt. »Dann erzählen Sie mir, weshalb.«
Langsam wurde mir dieser Typ zu aufdringlich – und in exakt diesem Augenblick endete der Song.
Wahrhaftig, Halleluja!
»Tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Morgen habe ich noch einige wichtige Dinge zu erledigen.«
Ein Schatten flog nahezu unmerklich über Toms Gesichtszüge, welcher durch ein einladendes, antrainiertes Lächeln restlos bekämpft wurde. »Kann ich Sie irgendwie überreden, noch etwas länger zu bleiben?«
Ernsthaft?
Allmählich musste er begreifen, dass ich kein Interesse an einem One-Night-Stand hegte und sein Hypnose-Seelenblick an mir längst abgeprallt war.
Stumm schüttelte ich den Kopf – und Tom wirkte sichtlich verzweifelt.
Ich verstand seine Reaktion nicht. Eigentlich verstand ich diesen Menschen per se nicht. Deshalb, und angesichts meiner Lebenserfahrung und das daraus erwachsene Misstrauen fremden Personen gegenüber, entschied ich mich, nach meiner Tasche zu fassen und aufzustehen.
»Kommen Sie bald wieder vorbei?« Die Traurigkeit in seiner Äußerung war trotz der Musik unüberhörbar.
Ein guter Schauspieler.
Wollte er mich warmhalten?
»Das weiß ich noch nicht. Wie gesagt: Ich gehe nicht gerne aus, da ich alleine nicht weiß, was ich machen soll.«
Ein kindliches Strahlen schenkte dem Musiker diese zuckersüße Niedlichkeit, gegen welche ein jedes Katzenbaby und erst recht jede Anime-Zeichnung alt aussah. »Nun … ab jetzt können Sie sich mit mir unterhalten! Wir können über die verschiedensten Themen plaudern. Sie werden nicht mehr allein dasitzen müssen. Ich leiste Ihnen gerne Gesellschaft.«
Für eine Sekunde schloss ich die Lider.
Gleichermaßen wie er mir auf die Nerven ging, berührte mich seine liebevolle Hartnäckigkeit.
»Wir werden sehen.«
»Nein, Sie müssen es mir versprechen.« Er erhob sich – langsam, elegant, selbstsicher. Da war keine Schüchternheit mehr. Von einer Sekunde auf die andere verhielt er sich wie jemand, dem die gesamte Welt gehörte.
Dies gab Raum für drei Vermutungen: Entweder litt Tom an Schizophrenie oder einer ähnlichen Geisteskrankheit, versuchte er durch seine Körpersprache seine große Unsicherheit zu überspielen oder aber, er mimte den schüchternen Jüngling.
Die dritte Theorie erschien am wahrscheinlichsten. Alsbald Tom bemerkt hatte, dass er mit seinem Shy-Guy-Verhalten bei mir nicht landen konnte, versuchte er eben eine andere Methode.
Es war logisch. Es war typisch. Es war die einzige vernünftige Erklärung.
Bestimmt dachte Tom, durch seine Attraktivität sowie dem Dackelblick mich im Handumdrehen einwickeln und eine kurze Nummer mit mir schieben zu können.
Mein Hass wuchs im Takt meines ankurbelnden Herzschlags, brannte in meinem Magen, krampfte in meinen Muskelsträngen.
Verdammte Menschen!
Verdammte Männer!
Verdammtes Leben!
»Auf Wiedersehen.«
Ohne mich noch einmal umzudrehen, ging ich zur Garderobe, langte nach meinem Mantel und trat hinaus in die eisige Nacht.

Alleinsein stellt das höchste Gut dar,
Einsamkeit den tiefsten Schmerz
Ich erwachte am frühen Morgen nach einer von Albträumen durchsetzten Nacht, in welcher ich eine ausgedehnte Tiefschlafphase herzlich vermisst hatte und ich mich nun ähnlich erschöpft fühlte wie vor dem Zubettgehen. Den Barbesuch hätte ich besser sein lassen sollen. Zu viele fremde Menschen auf einem Haufen und Lärm gepaart mit mir unmöglich einzuschätzenden Situationen brachten mir stets unruhige Nächte.
Ich streckte mich.
Tom.
Ein sachter Adrenalinausstoß jagte mir quer durch die Blutbahn.
Alsbald mein Gehirn diesen Namen hervorgebracht hatte, sah ich seine durchdringenden, mich liebevoll betrachtenden Augen vor mir.
Gerne hätte ich gewusst, welche Farbe sie trugen …
Wie sahen sie aus, wenn die Strahlen der Sonne sie beschienen?
Himmelherrgott!
Welche Dinge kamen mir da in den Sinn?! Es wurde stündlich schlimmer mit mir!
Behäbig stemmte ich mich hoch, schlurfte ins Bad und duschte mich. Nach einem ausgiebigen Frühstück, das aus einem Dinkeltoast mit Tomaten, Mozzarella, ein wenig Ketchup und einer heißen Tasse Kakao bestand, setzte ich zu meinem wöchentlichen Wohnungsputz an. Da ich wochentags arbeitete und Samstag meinen Erholungstag bildeten, hatte ich mich vor einigen Jahren dazu entschlossen, Putzarbeiten stets auf Sonntag zu verlegen. Erstens waren sämtliche Geschäfte geschlossen, womit ich nirgendwo großartig hingehen konnte, zweitens bereitete ich mich dadurch auf den Start in eine neue Woche vor.
Indessen ich das Bett überzog, musste ich neuerlich an Tom und unser Gespräch zurückdenken. Und dieses warme, verbindende Empfinden trat zurück in mein Herz – und verstärkte sich. Gleichzeitig schlug mir ein schmerzhafter Blitz in die Seele, ausgelöst durch die bittere Tatsache, für Tom bestenfalls eine Bettgeschichte darzustellen.
Ich atmete tief durch, versuchte, meine Enttäuschung zu verdrängen. Zu meinem Pech wollte es mir nicht gelingen.
Tom hatte etwas so Einzigartiges an sich besessen – eine ehrliche, liebevolle Ausstrahlung, respektvolle Selbstsicherheit … und diese seltsame Schüchternheit, welche dann und wann in den Vordergrund trat und ihn für wenige Sekunden schier gänzlich ausfüllte.
Sein delikates Aussehen, seine Aufmerksamkeit …
Weshalb war es mir nicht möglich, einen Mann kennenzulernen, bei dem ich mich wohlfühlte und welcher sich eine Beziehung mit mir vorstellen konnte … und wollte?
Selbstverständlich, wahre Liebe existierte nicht. Bedingungsloses Vertrauen existierte nicht. Doch zumindest einen halbwegs anständigen Partner an meiner Seite zu wissen, auf den ich mich verlassen konnte – war dies zu viel verlangt?
Ich warf das Bettzeugs in die Waschmaschine und fing mit dem Abstauben an. Kästen, Lichtschalter, Türen, Türgriffe, Fensterbänke und der Bürotisch. Danach reinigte ich Bad und WC.
Du bist eine Niete, hallte es just durch meine Gehirnwindungen. Zum Glück habe ich bloß drei Monate meines Lebens mit dir verschwendet.
Mein Ex-Freund hatte mir diese wundervollen Worte vor die Füße gespuckt. Genauer gesagt: erster und bisher letzter Freund.
Weshalb hatte ich mich auf ihn eingelassen? Wahrscheinlich, weil er mich mit dummen und verlogenen Komplimenten um den Finger gewickelt hatte. Ich war zu naiv gewesen, hatte angenommen, Menschen wären grundsätzlich nett und zuvorkommend. Dabei ging es ihnen seit jeher um Machtmissbrauch und Erfüllung ihrer egoistischen Ziele. Solange ich ihnen half und alles tat, was sie wollten, waren sie halbwegs freundlich zu mir. Alsbald jedoch ich etwas forderte oder wünschte, wurde ich ignoriert – oder, wie im Falle meines Ex-Freunds, fallengelassen.
Und andere Männer, welchen ich in den darauffolgenden Jahren begegnet war? Diese wollten allesamt kurze Affären oder einen Blowjob.
Nun, eigentlich waren es lediglich drei Dreckskerle gewesen, die mich angesprochen hatten. Und alle drei waren verheiratet. Die Blowjob-Nummer hingegen bot mir ein Alkoholiker in seinem Suff an. Seine verfaulten Zähne und der penetrante aus Talg und Schweiß zusammengesetzte Körpergeruch hatten mich mindestens genauso abgestoßen wie das verwahrloste Erscheinungsbild und die Frage an sich.
Ja, liebes Leben, du beschenkst mich andauernd mit Lorbeeren. Womit habe ich derart viel Glück verdient?
Frustriert und verzweifelt packte ich den Staubsauger und schaltete das Lärmmonster ein.
In meinen Kindheitstagen hatte ich das Geräusch eines Staubsaugers nicht eine Sekunde lang ertragen. Alsbald meine Mutter zu saugen begann, hatte ich mir entweder die Ohren zugehalten oder mich ins entlegenste Zimmer der Wohnung verkrochen. Glücklicherweise gewöhnte ich mich nach und nach daran – und heute gelang es mir problemlos, selbst zum Teleskopauszug zu greifen und lästigem Feinstaub den Garaus zu machen.
Nach getaner Arbeit trat ich ans Küchenfenster. Es gewährte mir den Ausblick auf den parkähnlich angelegten Hinterhof des dreistöckigen Mehrparteienhauses.
Im Sommer tummelten sich dort Kinder und Rentner. Im Winter traf man meistens niemanden an. Die Spielgeräte wurden stets abmontiert und im Keller untergebracht, um sie vor starker Witterungseinwirkung zu schützen. Ebenso vergeblich suchte man Bänke.
Ich war zufrieden damit. Das penetrante Kindergeschrei reichte mir die Sommermonate über.
Schleierhafte Winterwolken tauchten den Himmel in ein cremiges Eisblau. Helios selbst präsentierte sich in Form einer weißlich-gelben Kugel, welche ihr schwaches, kaltes Januarlicht teilnahmslos gen Erde sandte.
Ich dachte zurück an Tom, und mit welchen negativen Gefühlen ich das Lokal verlassen hatte.
Einst hatte ich nicht solcherweise überreagiert. Ich hatte keinerlei Vorurteile gehegt und jedem Menschen die Chance eingeräumt, sich mir vorzustellen. Ich war ausnahmslos objektiv und hatte Verständnis und Mitgefühl für jeden – selbst für charakterlose Dreckskerle. Stets dachte ich: Hinter einem jeden Menschen steckt ein Schicksal, eine Geschichte, ein einschneidendes Erlebnis. Niemand reagiert grundlos kalt, unfreundlich, verängstigt oder fröhlich.
Aufgrund meiner Naivität hatte ich allerdings Egoismus, Eigennutz, Gier, Dummheit und andere negative Persönlichkeitsmerkmale nicht miteinbezogen – da ich dachte, diese würden sich zumeist im Rahmen halten. Stattdessen suchte ich die Schuld bei mir selbst. Ich dachte, wenn Menschen unfreundlich auf mich reagierten, läge es ausnahmslos an mir.
Wie man in den Wald hineinruft, hallt es zurück. Dieses Sprichwort hatte ich gegen mich gewendet, hatte mich geändert, mich freundlicher und nochmals freundlicher verhalten – und ich wurde noch weniger akzeptiert, noch mehr belächelt, ignoriert, ausgenutzt.
Ja, meine Metamorphose hatte lange angedauert. Doch nun stand da eine andere Sara. Eine, die sich nicht mehr belügen ließ.
Es war ein schmerzhafter Prozess gewesen – und manchmal fühlte ich mich erst recht schuldig, nun wie all die anderen asozialen, verkommenen, emotionslosen, nutzlosen Menschen geworden zu sein. Nichtsdestoweniger hatte ich einen Erfolg vorzuweisen: Niemand mehr hatte mich verletzt.
Und daran würde sich auch in Zukunft nichts ändern! Selbst wenn ich für den Rest meines erbärmlichen Lebens alleine bleiben musste!
Ich strich mir das Haar zurück und wandte mich der Küchenanrichte zu. Aus dem oberen Schrank holte ich ein Dinkelweckerl hervor, brach es entzwei und legte es zum Austrocknen auf die Heizung. Anschließend kredenzte ich mir gebratene Hühnerfleischstreifen auf gemischtem Blattsalat verfeinert mit Tomaten und Radieschen.
Ich liebte es, frisch zu kochen. Das Empfinden etwas zu kreieren, ließ mich den Aufwand gerne vergessen – zumal Fertiggerichte mir nicht sonderlich schmeckten und ich davon Hautunreinheiten und Bauchkrämpfe bekam.
Besonders gerne mochte ich Hühnerfleisch in Kombination mit Brokkoli, Rosenkohl oder Blattspinat mit Zitronensaft. Teigwaren, Obst und Pilze sagten mir ebenfalls sehr zu. Und süße Nachspeisen sowieso. Was mir überhaupt nicht schmeckte, waren Innereien, Kren, Spargel, Schweinefleisch und Hülsenfrüchte. Ausnahmen bildeten Leberstreichwurst, Frankfurter Würstel und zartgeräucherter Schinken.
Nach Essen und Abwasch nahm ich mein neu gekauftes Taschenbuch – ein Spionagethriller – zur Hand und setzte mich auf meine zwar neuwertige nichtsdestotrotz ungemütliche hellgraue Couch. Sie war zwei Meter lang, hart wie Beton und obendrauf rau wie Schurwolle. Ursprünglich hatte ich sie entsorgen wollen. Leider Gottes kannte ich niemanden, der mir beim Hinuntertragen dieses sperrigen Dings vom zweiten Stock ins Erdgeschoss geholfen hätte. Ferner wollte ich kein Geld für eine andere Sitzgelegenheit ausgeben. So hatte ich mich erzwungenermaßen dazu entschlossen, sie zu behalten.
Solche Momente erinnerten mich daran, dass ich nicht alles alleine bewerkstelligen konnte – gleichgültig, wie sehr ich es wollte oder wie viele Belange des Lebens ich bislang erfolgreich selbst geregelt hatte.
Wie dem auch sei – jammern brachte mich nicht weiter. Ich musste froh sein, eine Couch zu besitzen. Andere Menschen hatten nicht einmal das!
Obwohl ich mir dieser Tatsache vollauf bewusst war, gelang es mir nicht, diesen bitteren Beigeschmack der Verleugnung loszuwerden.
War es in Ordnung, angesichts meiner Einsamkeit mir durchgehend Ausreden zu suchen, um Positivität und irgendeinen Sinn in mein Leben zu bringen?
Jahrelang hatte ich nicht einmal bemerkt, dies ständig zu tun. Ich hatte all meine Wünsche und Sehnsüchte verdrängt, mich ausnahmslos auf den Alltag konzentriert, gegen auftretende Panikattacken gekämpft und sämtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen versucht.
Stellte dies das Leben dar? Sich tagtäglich zu fürchten, zu bangen – und letztendlich Dankbarkeit zu empfinden, zumindest auf frisches warmes Wasser Zugriff zu haben und in einem kuscheligen Bett schlafen zu dürfen? Lebten sämtliche Menschen in diesem Land auf dieselbe Weise?
Aber … weswegen jammerten sie alle über jede unbedeutende Kleinigkeit: Das Wetter, den Ehepartner, die Kinder, die Arbeit, den Urlaub, das Auto, die Wohnung?
Falls sie ebenfalls dankbar und überdies gesundheitlich oder mental relativ stark waren … weshalb mussten diese Leute zetern?
Ich verdrängte die Gedanken und erfreute mich lieber an meiner Freiheit, tun und lassen zu können, was ich wollte.
Denn eines war klar: Solange ich allein lebte, brauchte ich keine Kompromisse einzugehen. Ich war frei, musste mich auf niemanden einstellen oder Rücksicht nehmen.
Lediglich dieses mich folternde Verlangen nach körperlicher wie gefühlsmäßiger Nähe, Geborgenheit, einem Zuhause … dies brachte mich allmählich um.
Wie üblich erwachte ich Montag morgen relativ ausgeruht und gestärkt. Diese Energie nutzte ich, um in der Arbeit sämtliche schwierigen Aufgaben zuerst abzuarbeiten. Zwar tauchten komplizierte oder anstrengende Tätigkeiten logischerweise ebenfalls an allen anderen Wochentagen auf, allerdings musste ich mich dann nicht unbedingt einen kompletten Vor- oder Nachmittag mit komplexen Themen herumquälen, sondern durfte mir mentale Pausen durch leichte Obliegenheiten zwischenschieben.
Als Webseitenbetreuer eines kleinen Online-Shops fielen großteils knifflige oder lästige Probleme an. Da ich überdies für den Kundensupport zuständig war, läutete meistens durchgehend das Telefon und wurde mein Mail-Account mit Dummies-Anfragen überschwemmt.
Der überwiegende Teil meiner Anfragen fiel in die Kategorien irrtümliche Bestellungen, Einloggschwierigkeiten aufgrund vergessener Passwörter sowie Unzufriedenheit mit der Paketzustellung.
Obwohl Telefonate und Kundenanfragen mich ziemlich nervten, mochte ich meine Arbeit. Ich hatte ein Büro für mich allein, durfte mir meinen Alltag zumeist frei einteilen und die Bezahlung war ebenfalls in Ordnung.
Meine halbstündige Mittagspause verbrachte ich gern in einem nahe gelegenen überschaubaren Park. Auf einer schmiedeeisernen Bank, welche das gesamte Jahr über unter einer zwanzig Meter hohen Linde stand, aß ich mein Pausenbrot und fütterte nebenbei die Tauben.
Ja, im Winter war es eisig kalt. Dennoch zwang ich mich hierher. Ein wenig Frischluft war wichtig und Abhärtung zugleich. Außerdem liebte ich es, die Vögel zu beobachten. Wie sie frech nach meinen getrockneten Brotkrumen pickten und geschäftig hin- und herstolzierten. Und das niedliche Gurren erst! Ein wenig erinnerte es mich an das Schnurren einer zufriedenen Katze.
Eben wollte ich mich von der Bank erheben, da bemerkte ich, wie ein schlanker Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite in eine schmale Gasse trat.
Tom, hallte es mir unwillkürlich durch meinen Geist. Und unmittelbar danach fragte ich mich, was mit meinem Verstand nicht stimmte.
Von dieser Distanz aus war es mir unmöglich zu sagen, wer dort herum irrte. Bedeutend lachhafter war es anzunehmen, es wäre Tom gewesen, wo ich nicht einmal seine Haarfarbe oder sein Alltagsoutfit kannte! Und überhaupt: Weshalb kam mir dieser Mann fortwährend in den Sinn?
Herrschaftszeiten!
Ich steckte die Hände in die Manteltaschen und eilte los.
Um halb fünf verließ ich das Büro und fuhr nach Hause. Erschöpft und ausgebrannt fühlte ich mich, weshalb ich mich sofort unter eine kochend heiße Dusche stellte. Danach schlüpfte ich in meinen übergroßen, schneeweißen Bademantel, belegte mir ein Brötchen mit Kantwurst, schlang dieses hinunter und kuschelte mich ins Bett.