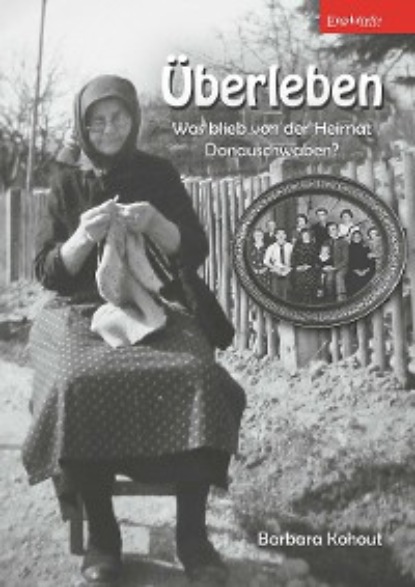- -
- 100%
- +
Von den Folgen dieser politischen Ereignisse war meine Familie unmittelbar betroffen. Plötzlich gab es eine Staatsgrenze zwischen Ungarn und Serbien. Stanischitsch, das bis dahin ein ungarisches Dorf mit deutschen und serbischen Bewohnern war, wurde nun zum serbischen Stanìsić. Nur 10 km nördlich verlief die Grenze zu Ungarn. Man errichtete einen Befestigungswall mit Bunkeranlagen und Grenzgarnison. Eine in 130 Jahren gewachsene und durch verwandtschaftliche Bande gefestigte Bindung zu den im Norden gelegenen deutschsprachigen Dörfern war brutal zerschnitten. Das sogenannte Bajaer Dreieck mit den Bezirken Baja und Almasch blieb bei Ungarn.
Zudem wurde Ungarn von einer Inflationswelle heimgesucht. Die Folgen des Krieges und die Entwicklungen in der weltweiten Wirtschaft lasteten auf der Region. Mein Großvater war gezwungen, zunächst die Filiale seines Geschäftes aufzugeben.
Anfang 1919, mitten in der Zeit des Umbruchs, beschlossen meine Großeltern zu heiraten. Sie feierten eine bescheidene Hochzeit im kleinen Kreis. Die Verwandten aus „Serbien“ wollten nicht ins Ausland reisen. Die Familie Horváth sah die Hochzeit ebenfalls kritisch. Vor allem konnte Roschi keine Mitgift erwarten. Aber die beiden waren entschlossen, ihren Weg zu gehen. Das Leben gab ihnen recht: Ihre Liebe hielt mehr als 50 Jahre. Doch sie wurde immer wieder auf eine harte Bewährungsprobe gestellt.
Die politische Veränderung wurde zu einem schier unüberwindlichen Hindernis. Meine Großeltern standen zwischen zwei Welten. Wenige Monate zuvor waren sie Angehörige eines Staates, und es spielte keine Rolle, dass sie verschiedener Nationalität waren. Plötzlich war alles anders.
Nationalismus wird zu Fanatismus
Der sogenannte „Rote Graf“ Mihaly Karolyi war gezwungen, sich mit den Auswirkungen der Herrschaft der Habsburger auseinanderzusetzen. Wie überall in Europa schlug der lange Zeit schwelende Nationalismus plötzlich in Fanatismus um. Für eine wirkliche Übereinkunft zwischen den verschiedenen Interessengruppen und Völkerschaften war es im Grunde zu spät. Bei vielen steigerte sich die Ablehnung der „Anderen“ in Hass. Dieser traf besonders die eingewanderten Deutschen. Man sah sie als Feinde an. Sie waren plötzlich unerwünscht.
Wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten eine hohe Arbeitslosigkeit zur Folge. Viele waren gezwungen, zu sparen. In Verbindung mit nationalistischen Vorurteilen hatte dies für meinen Großvater verheerende Folgen. Er bekam immer weniger Arbeit. Zum Theater hatte er keinen Zugang mehr. Private Kunden fürchteten die Meinung der Nachbarn. Bald wusste meine Großmutter, meine Ama, kaum noch, wie sie die Lebensmittel für die Familie beschaffen sollte.
Im Winter 1918/19 eskalierten die schwelenden Auseinandersetzungen weiter. Wirtschaftliche Probleme einerseits, wachsender Nationalismus im Land und der Machtpoker der Entente schufen in Ungarn eine explosive Situation. Der „Rote Graf“ sah sich gezwungen, die Regierung an das Proletariat zu übergeben. An der Spitze des Staates stand nun faktisch Belá Kun, der aus russischer Kriegsgefangenschaft mit dem Traum von einer kommunistischen, nicht national geprägten Räterepublik zurückgekehrt war. Als politischer Führer erwies er sich als Fehlbesetzung. Revolution und Gegenrevolution erschütterten das Land. Nach 133 wirren Tagen, am 1. August 1919, stürzte das Regime.
Mitten in dieser Zeit wurde meine Großmutter schwanger. Sie erwartete ihr erstes Kind – meine Mutter Katharina. Das war eine Sorge mehr für die junge Familie.
In Stanischitsch, das nur 28 km südlich von Baja lag, war die Situation völlig anders. Die serbische Regierung verordnete zunächst die Beschriftung aller öffentlichen Gebäude, Straßenschilder und Firmenschilder in serbokroatischer Sprache und kyrillischer Schrift. Deutsch und Ungarisch blieben jedoch als Zusatzsprache erlaubt. Auch in den Gemeindeverwaltungen änderte sich nur wenig. So funktionierte der Umbruch in Stanischitsch relativ reibungslos. Ausschreitungen und Willkür gegenüber einzelnen Bevölkerungsgruppen gab es nicht.
Stanischitsch hatte von jeher eine gemischte Bevölkerung. Vielleicht gewöhnte man sich deshalb schneller an die neue Situation? Doch der wirtschaftliche Einbruch war auch hier schmerzlich spürbar. Vor der Trennung wurden jährlich allein 100 bis 150 Waggons gemästete Schweine nach Zagreb, Wien und Prag verladen. Nun war der Weg nach Norden versperrt und die Handelsbeziehungen fast unmöglich. Die Einnahmen von Petervetter gingen schlagartig zurück. Wenn er überhaupt Abnehmer für die Tiere fand, deckte der Ertrag kaum die Ausgaben.
Ab Januar 1920 wurde ausschließlich der serbische Dinar als Währung anerkannt. Die ungarische Krone galt als Inflationsgeld. Man konnte sie zu einem Kurs von 4 Kronen zu 1 Dinar umtauschen. Zusätzlich wurde dabei eine Staatsanleihe von 20 % einbehalten.
Die turbulenten Ereignisse und die neu entstandenen Grenzen bewirkten, dass sich die Menschen diesseits und jenseits plötzlich als Feinde wahrnahmen. Es wurde wichtig, welcher Nationalität der Einzelne zugehörte.
Ich will die Geschichte meiner Familie erzählen, die von den Ereignissen geprägt ist, wie sie in unseren Wohnorten passierte. Das kann nicht als objektive Aussage über das Geschehen gewertet werden.
Bereits in einem Nachbarort, wie Gakowo, Siwatz, Sombor oder anderen, gab es zum Teil völlig andere Geschehnisse, teilweise geschahen schreckliche Gräueltaten. Es gab aber auch viele Zeugnisse menschlicher Güte und Hilfsbereitschaft – unabhängig von politischen, religiösen oder nationalen Zwängen.
Ein Poker um die richtige Staatsbürgerschaft, – der Not gehorchend Auswanderung
Mein Großvater war kein ungarischer Staatsbürger. Als „Serbe“ deutscher Abstammung sollte er sich innerhalb kürzester Zeit entscheiden, ob er die ungarische Staatsbürgerschaft annehmen wollte. Er litt aber unter der Ablehnung und den absichtlichen Kränkungen durch seine früheren ungarischen Freunde. Zudem war die finanzielle Absicherung der Familie mehr als ungewiss. Für ihn war es unter diesen Umständen undenkbar, die ungarische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Es stellte sich die Frage, ob die Familie nicht nach Stanischitsch übersiedeln sollte. Dort wären die Bedingungen für meinen Großvater besser. Aber meine Großmutter konnte kaum Deutsch. Das Wenige, das sie im deutschen Unterricht gelernt hatte, konnte die Umgangssprache Ungarisch nicht ersetzen. Wie sollte sie in Stanischitsch zurechtkommen?
In Serbien handhabte man die Frage der Staatsbürgerschaft großzügiger. Die Minderheitengruppen hatten eine mehrjährige Bedenkzeit, ob sie serbische Staatsbürger werden wollten. Einige wollten es, weil damit Privilegien verbunden waren. Auch stand ihnen der Staatsdienst offen. Doch viele wollten es nicht. Sie behielten ihre deutsche oder ungarische Staatsbürgerschaft bei.
Meine Großmutter war ein lebensfroher Mensch, der sich gern mit anderen unterhielt. Sie interessierte sich weniger für ihre rechtliche Situation in Serbien. Weit wichtiger war für sie die Möglichkeit, mit Menschen zu reden. Und sie hatte die offene Verachtung nicht vergessen, mit der die deutsche Verwandtschaft die Bekanntgabe ihrer Verlobung aufgenommen hatte. Sie wehrte sich zunächst verzweifelt gegen den Vorschlag ihres Mannes, nach Serbien auszuwandern. Sie war fest entschlossen, niemals ihre ungarische Staatsbürgerschaft aufzugeben.
1922 wurde meinen Großeltern ein zweites Mädchen geboren. Die wirtschaftliche Situation meiner Großeltern war weiterhin problematisch. Oft gab es nicht ausreichend Essen. Deshalb war Elisabeth zart und kränklich. Immer wieder stellte sich die Frage, wie es weitergehen sollte. Es musste eine Entscheidung getroffen werden. Schließlich stimmte meine Großmutter schweren Herzens und der Not gehorchend der Auswanderung zu. Sie erschien als das kleinere Übel. Meine Großeltern verkauften ihr Geschäft in Baja – unter diesen Umständen zu einem Schleuderpreis – und wanderten nach Stanischitsch aus. Vorübergehend konnten sie im Elternhaus meines Großvaters ein kleines Zimmer bewohnen. Das ungeschriebene Gesetz der Gastfreundschaft musste auch die Schwägerin Eva zähneknirschend einhalten.
Meine Großmutter war eine Kämpfernatur. Sie wollte sich nichts schenken lassen. So schnell wie möglich wollte sie wieder einen eigenen Hausstand haben. Der Schwägerin ging sie aus dem Weg so gut es ihr möglich war. Die verächtlichen Blicke und kritischen Bemerkungen zu ihrer fatalen Situation kränkten sie, was natürlich auch die Absicht der Schwägerin war. Nach dem Umtausch des Verkaufserlöses für ihren Besitz in Baja hatten meine Großeltern die Mittel, um ein kleines Grundstück in Stanischitsch in der Wassergasse zu kaufen. Gemessen an dem, was mein Großvater einmal besessen hatte, an seinen beruflichen Aussichten in der Zeit vor dem Krieg und den finanziellen Möglichkeiten der Verwandtschaft, war es ein winziger Besitz. Er lag neben einem Graben, der sich im Herbst und im Frühjahr mit Wasser füllte und einen Teich bildete. Im Sommer war der Graben zwar ausgetrocknet. Aber die feuchte, sumpfige Umgebung war Brutstatt für Millionen Mücken.
Doch mit viel Mut und Hoffnung starteten meine Großeltern ihr neues Leben. Das Haus errichteten sie überwiegend in Eigenleistung. Trotzig und unermüdlich arbeitete auch meine Großmutter jede freie Minute auf der Baustelle. Natürlich wurden sie von der Familie unterstützt. Dies galt als selbstverständlich. Die Verwandtschaft war jedoch nicht übereifrig. Das geplante Haus war, entsprechend der finanziellen Mittel, klein. Es wurde nach der Tradition der ersten Siedlerhäuser errichtet: Die Giebelseite des Hauses hatte jeweils ein Fenster, das „Gassenfenster“, und rechts daneben befand sich die Eingangstüre. Diese führte aber nicht direkt ins Haus, sondern zu einem Säulengang, von dem man in die einzelnen Zimmer gelangte. (Inzwischen sind alle Häuser, die ich während meiner Serbienreise besucht habe, erweitert worden, indem dieser Gang zugemauert wurde, wodurch sich die Räumlichkeiten um diesen Platz vergrößern. Das ist an den Fassaden sowie an der Dachstruktur noch deutlich zu erkennen.) Die erste Tür war der Eingang zur „Gassenstube“, dem Paradezimmer. Es wurde nur zu besonderen Anlässen genutzt. Daneben lag die Schlafkammer. Begrenzt wurde der Flur durch den Eingang zur Sommerküche. Sie war der Arbeits- und Wirtschaftsraum. Meine Großmutter pflanzte an jede der fünf Säulen einen Weinstock. Sie ließ ihn unverschnitten ranken. An heißen Sommertagen genossen wir den Schatten, zu Beginn des Herbstes die köstlichen, süßen Trauben. Der Zugang von der Straße zum Hof wurde durch ein großes hölzernes Tor versperrt.
Hinter jedem Siedlungshaus war der Wirtschaftshof mit den Schweine- und Hühnerställen und Geräteschuppen sowie der Lagerraum für Brennholz. Daran anschließend kam der Gemüse- und Nutzgarten. Ich erinnere mich vor allem an einen Quittenbaum in Großmutters Garten. Er war für unsere Familie geradezu legendär, weil er so reichliche Früchte trug. Nach relativ kurzer Bauzeit konnten sie ihr Haus beziehen, auch wenn es noch längst nicht fertig war. Was machte das schon? Sie waren wieder ihr eigener Herr im Haus.
Mein Großvater begann erneut als “Balbier“ zu arbeiten. Er fuhr mit dem Fahrrad auf die Dörfer und warb um Kundschaft. Er musste schon um vier Uhr morgens aus dem Haus, denn die Bauern waren sonst nicht mehr anzutreffen. Meist bekam er Naturalien als Lohn. Es gab durchaus feste Tarife. Die Zahlung bestand in einer bestimmten Menge Zucker, Mehl, Eiern oder anderen Erträgen aus der Landwirtschaft und was er der Jahreszeit entsprechend aushandeln konnte. Geld bekam er nur für das Schneiden der Haare. Auf diese Weise hatte die Familie wenigstens etwas zu essen. Wenn meine Großmutter Brot backen wollte, brauchte sie für 5 Para Hefe, die sie oft nicht hatte. 100 Para waren 1 Dinar. Das ist vergleichbar damit, dass eine Hausfrau heute keine 5 Eurocent besitzt, um etwas Hefe zu kaufen.
Meine Großeltern waren der Verwandtschaft als Ausgleich für die Hilfe selbstverständlich verpflichtet. Großmutter musste im Kolonialwarengeschäft ihres Schwagers einkaufen. Aber um Kredit oder Zahlungsaufschub zu bitten, verbot ihr der Stolz. Andererseits bedrängte sie Großvater mit Tränen oder Vorwürfen, weil sie Geldsorgen so unglücklich machten. Dies half beiden auch nicht weiter. Es war eine harte Zeit.
Von Großvater erwarteten seine Brüder, dass er zum Haareschneiden oder zum Rasieren ins Haus kam. “Der arme Michl bekam dann als besondere Gunsterweisung eine Tasse Kaffee“, lese ich auf einer hellblauen Serviette, die ich offensichtlich bei einem Familientreffen aus Mangel an Notizpapier beschrieben hatte. Das Motto meiner Vorfahren hieß: „Sich regen bringt Segen.“ Das zahlte sich auch bei meinen Großeltern aus und es wurde nach und nach leichter für sie. Meine Großmutter schaffte sich ein paar Hühner, Enten und Gänse an. Besonders die Enten und Gänse nutzten im Frühjahr den Teich vor dem Haus. Im Garten wuchsen Gemüse und Salat. Im zweiten Jahr wurde zum Winter bereits ein Schwein geschlachtet. Die Versorgung wurde zunehmend besser. Der Großvater war bald wieder bei seiner Kundschaft beliebt. Seine Frohnatur setzte sich durch, und er erzählte wieder leutselig als lebendes Tagblatt alles, was es an Tratsch und Neuigkeiten zu verbreiten gab. Aber es blieb schwierig. Vor allem belastete meine Großeltern die Hypothek, die auf dem Haus lag.
Als es im Herbst 1924 kühl wurde, wollte Ama für ihre beiden Mädchen Strümpfe stricken. Um Wolle zu kaufen, war kein Geld da. Also besorgte sie Zuckersäcke, die aus feinem, weißem Hanf gewebt waren. Diese Fäden wickelte sie auf Knäuel und strickte damit Strümpfe. Am Tag hatte sie dafür aber keine Zeit. Um Petroleum für die Lampe zu sparen, saß sie in mondhellen Nächten ohne Licht im Bett und strickte nach Gefühl. Dann schlief sie 3 – 4 Stunden bis Ata wieder aufstehen musste, um zur Arbeit zu fahren. In dieser Zeit war sie wieder schwanger. Im Dezember wurde dann meine Tante Susanna geboren, die Susitante, wie ich sie nach donauschwäbischem Brauch nenne. Ata nutzte die Gelegenheit zu einem kleinen Nebenerwerb und begann im Winter, in Gasthäusern zum Tanz aufzuspielen. Auch bei Hochzeiten ließ er sich engagieren.
Wegen des kalten Winters waren die Mädchen oft erkältet. Elisabeth war besonders anfällig. Doch es fehlte das Geld für ausreichend Medizin. Als es endlich Frühling wurde, war Elisabeth abgemagert, blass und hatte kaum Appetit. Ende Mai wurde sie wieder schwer krank. Sie bekam hohes Fieber. Die Familie und auch die Verwandten machten sich große Sorgen um sie.
Als Elis im Juni 1925 starb, fühlte sich meine Mutter entsetzlich schuldig. Sie dachte, Elis sei gestorben, weil sie sich das gewünscht hatte, um auch ein Stückchen von der Schokolade zu bekommen, die ihr die Tante Eva gebracht hatte. Wie grausam sind Zeiten, in denen Eltern so mit Sorgen beladen sind, dass sie die emotionalen Bedürfnisse und Nöte ihrer Kinder nicht mehr wahrnehmen. Solche Wunden heilen nie. Meine Mutter hat mir diese Geschichte erzählt, als sie bereits 80 Jahre alt war!
Das Haus meiner Großeltern war damals recht einsam am Dorfrand gelegen. Deshalb haben sie sich einen Bernhardiner Hund zugelegt. Im Juni hatte es sehr viel geregnet und der Teich vor dem Haus war vollgelaufen. Meine Mutter spielte dort in der Nähe unbeaufsichtigt, während die Familie in ihrer Trauer um den Tod des kleinen Mädchens im eigenen Kummer gefangen war. Das Ufer des Teiches war schlammig und glitschig. Plötzlich rutschte Katharina aus und fiel in den Teich. Der Hund hat das beobachtet und sprang ihr nach. Er packte sie bei ihrem Hemdchen und fing laut an zu winseln. Er konnte sie nicht mit eigener Kraft ans Ufer ziehen. Zum großen Glück hörte Ama schließlich sein Winseln und schaute nach. Wie froh war sie, dass es nicht noch eine Beerdigung geben musste.
1925 war für meine Großmutter ein unendlich schweres Jahr. Neben den Geldsorgen drückten die Sorgen um das kranke Kind und sein Tod. Sie wusste nicht, wie sie die tiefe Trauer darüber abschütteln sollte. Die kleine Susanne war bei Elises Tod erst 6 Monate alt und vielleicht war sie die Lebensretterin von Ama, denn das Baby brauchte seine Mutter. Doch nicht genug damit, litt Ama auch unter der Isolation. Einmal suchte sie Trost beim Pfarrer. Doch dieser konnte sie nur nach dem Weltbild der damaligen Zeit „trösten“. Unglück, das den Menschen widerfuhr, konnte nur eine Strafe Gottes für heimliche Sünden sein. Die sollte sie bekennen und bereuen, dann würde ihr Gott vergeben. Aber noch mehr Schuldgefühle konnte meine Großmutter nicht gebrauchen. Nach diesem Gespräch betrachtete sie Pfarrer als persönliche Unglücksboten. Wenn ihr einer begegnete, unternahm sie an dem Tag nichts mehr. Sie sagte, er sei so gefährlich wie eine schwarze Katze. Außerdem glaubte sie an den Spruch: „Wer einen Vetter im Himmel hat, kommt auch hinein.“
Langsam drohte sie in Schwermut zu versinken. Ata schimpfte sie aus. Sie sollte doch an ihr eigenes Zuhause denken, dann wüsste sie, wohin es führt, wenn sie sich nicht zusammenreißt. Ata erinnerte sie an die psychisch Kranken, die von seinem Schwiegervater zu Hause mit einer „Beschäftigungstherapie“ betreut wurden. Die Kranken mussten zum Beispiel Besteck polieren – den ganzen Tag. Wenn sie einmal damit fertig waren, mussten sie wieder von vorne anfangen. Da man mit dem medizinischen Wissen von damals Depression noch teilweise als Schwachsinn oder Geisteskrankheit oder Irrsinn bezeichnete, gab man sich zwar alle Mühe, die Betroffenen zu verwahren und vielleicht zu beschäftigen, aber verstanden hat man diese bedauernswerten Menschen gewiss nicht.
Ama wird Geschäftsfrau
So wollte Ama natürlich nicht enden. Sie war eine Kämpferin. Schließlich entdeckte sie ihre ganz persönliche Lösung: den Wochenmarkt in Stanischitsch. Er fand zweimal wöchentlich statt. Es gab dort alles zu kaufen, was man im täglichen Leben so brauchte: Stoffe, Wolle, Schuhe, Werkzeuge, Besen, Saatgut, Obst, Gemüse, Getreide, Fleisch usw. Dieser „Supermarkt unter freiem Himmel“ beflügelte die Fantasie meiner Großmutter. Sie wollte etwas verkaufen, um an selbst verdientes Geld zu kommen, mit dem sie für die Kinder Kleidung, Schuhe, Medizin und vieles mehr kaufen konnte. Kurz entschlossen bot sie zunächst an, was sie in ihrem Garten erntete und nicht für den Eigenbedarf brauchte: Gurken, Tomaten, Paprika, Salat. Der Erlös dafür war sehr mager, nur wenige Para. Bald hatte sie begriffen, dass sie ihren Gewinn mit ihrer Geflügelzucht erheblich steigern konnte. Gänse, Enten und Hühner brachten Eier, Fleisch und vor allem Gänsedaunen und -federn. Das entwickelte sich sehr schnell zu einem willkommenen zweiten Standbein für das Familieneinkommen. Doch der sehr erfreuliche Nebeneffekt war, dass Ama wieder unter Leute kam und reden musste. Sie war nicht auf den Mund gefallen, aber sie musste auch lernen, Deutsch und Serbisch zu reden. Zuerst war es nur Kauderwelsch. Aber mit der Zeit konnte sie sich in drei Sprachen mit allen Menschen unterhalten – wer eben gerade kam. Da sie keinen Nationalstolz oder Rassenhass kannte, hatte sie bald vor allem mit den serbischen Bewohnern von Stanischitsch ein gutes, freundschaftliches Verhältnis. Meine Mutter und ihre Geschwister wuchsen ganz selbstverständlich zweisprachig auf. Mit der Mutter redeten sie ungarisch und mit dem Vater deutsch, dem diese Sprache mehr lag.
Ata hatte inzwischen einen festen Stamm von ca. 50 Kunden, die sich zweimal wöchentlich balbieren (rasieren) ließen. Für diese Dienstleistung bekam er 50 kg Weizen pro Kunde und Jahr, immerhin ca. 2.500 kg pro Jahr. Das war eine gute Basis für den Eigenbedarf an Futter für das Geflügel und Mehl zum Backen von Brot und Kuchen. Auch die Nudeln stellte Ama selbstverständlich selbst her. Was sie nicht verbrauchten, tauschten sie gegen andere Bedarfsgüter oder Futtergetreide ein. Zum Beispiel gegen Kukuruz (Mais). Die Schweine wurden bei uns vorwiegend mit Mais gemästet. Wer das Fleisch und den Speck von diesen Tieren einmal gekostet hat, wird den köstlichen Geschmack nie mehr vergessen.
Durch ihren Zusatzverdienst konnte sich Ama nun auch mal einen größeren Kochtopf kaufen – die Familie wuchs ja stetig – oder neue Patschker, wenn sie nötig waren. Damals gab es noch keine Schuhe von der Stange. Sie wurden entweder vom Schuster maßgefertigt – das war sehr teuer – oder man trug die traditionellen Patschker, ein bequemes, einfaches und leichtes Lederschuhwerk, dessen Sohlen sich seitlich nach oben wölbten. Diese Patschker, oder ungarisch Opanken, konnte man entweder auf dem Markt kaufen oder in einer der drei Patschkermacher-Werkstätten erwerben.
Zur Einschulung im Herbst 1926 sollte für meine Mutter gemäß dem Brauch ein neues Kleid gekauft werden. Aber Ama kaufte ihr kein weißes Kleid, wie es die Kinder der wohlhabenden Familien tragen durften. Beim dunklen Kleid sah man den Schmutz nicht so schnell, war die praktische Überlegung. Es wurde immer am Samstag gewaschen und konnte am Montag wieder sauber für die Schule angezogen werden.
Kultur und Tradition
Dass Ata ein geselliger Mensch war, wirkte sich selbstverständlich auch förderlich auf seinen geschäftlichen Erfolg aus. Er wurde Mitglied in allen möglichen Vereinen. Er war bei der freiwilligen Feuerwehr, beim Gesangsverein und Gesellenverein. Außerdem wurde er Gründungsmitglied beim Sportverein Sloga und engagierte sich dort lange Jahre als Schiedsrichter. Im Winter, wenn die Feldarbeit getan war, hatte jeder Verein seine Jahresfeiern in den entsprechenden Stammlokalen. Es gehörte zur Tradition, dass dabei jeweils ein Theaterstück aufgeführt wurde. Ata wurde der Intendant und Maskenbildner. Auch das brachte ein paar Dinare zusätzlich in die Haushaltskasse. Sie sollten den Grundstock für seine Expansionspläne bilden. Ata wollte wieder einen richtigen, eigenen Friseursalon eröffnen.
Ab dem Jahr 1925 belieferte ein Stromaggregat der Mühle Stanischitsch mit elektrischem Strom. Deshalb träumte mein Großvater von einem richtigen Salon, in dem er alle damals modernen Schönheitsangebote machen konnte, wie Dauerwellen ondulieren und alles, was dazugehörte. Ata arbeitete wirklich hart, um auch dieses Ziel zu erreichen.
Aber im Jahr 1926 war das noch Zukunftsmusik. Im September 1926 wurde mein Onkel Johann geboren – mein J annionkel. Für ihn wollte Ata das Geschäft aufbauen. Er sollte sein Erbe werden. Der erste Sohn! Die Freude war unbeschreiblich groß.
Meine Mutter konnte eine deutsche Schule besuchen, weil die Regierung diese ebenfalls zugelassen hatte. Sie wurde von Ordensschwestern unterrichtet, die vor allem die Fertigkeiten in Handarbeit förderten. Da sie sehr großzügig waren mit dem Verteilen von Fleißbildchen, lernte meine Mama gerade dafür mit großem Eifer.
Meine Mutter hat mich nie aufgefordert zu nähen, zu stricken, zu häkeln oder zu sticken. Aber diese Arbeiten habe ich immer mit Vergnügen gemacht. Ich habe dabei wohl ihre Freude und ihren Eifer, den ich bei ihr beobachten konnte, nachgeahmt.
Auch im Religionsunterricht sammelte Katl, wie sie nach donauschwäbischem Brauch gerufen wurde, eifrig Fleißbildchen. Aber mit der Beichte hatte sie ihre Probleme, erzählte unsere Mutter gelegentlich. Einige Fragen, die sie sehr bewegten, habe ich mir notiert: Was sollte sie unter „unkeuschen Gedanken“ oder „Unkeuschheit treiben“ verstehen? Der Pfarrer fragte sie auch, wie oft sie vor dem Schlafen nicht gebetet hat. Dann nannte sie eine Zahl, aber sie hatte ein schlechtes Gewissen dabei, denn sie wusste es nicht genau. Das gleiche Problem hatte sie bei der „Sünde“, dass sie mit jemandem geredet hat, der nicht katholisch war. Wie sollte sie immer wissen, wer nicht katholisch ist? Aber auf diesen Punkt wurde von den Ordensschwestern sehr großer Wert gelegt. Das musste unbedingt gebeichtet werden. Auch die Frage, wie oft sie erwachsene Leute auf der Straße nicht gegrüßt hat, machte ihr Kummer. Sie konnte es einfach nicht bestimmt sagen. Also gab sie auch hierbei irgendeine Zahl an, aber mit schlechtem Gewissen. Ama war ihr dabei keine große Hilfe, denn sie bestritt vehement, dass ein Mensch, der selber sündigt, anderen die Sünden vergeben konnte. So war Katl mit diesen Zweifeln allein und sie fühlte sich gar nicht wohl bei der Sache.
Ama erzählte immer wieder von der Erfahrung ihres Vaters, die er an einem Karfreitag – das war ein sehr strenger Fastentag – während seiner Arbeit gemacht hatte. Er musste zum Anstaltspfarrer gehen, um den Tod eines Patienten zu melden. Es war in der Mittagszeit. Er traute seinen Augen nicht. Der Tisch war so reichlich gedeckt, als wäre es ein besonderer Festtag. Vater Horváth war schockiert. Die Patienten mussten mit geplatschtem Kukuruz ( Popcorn) zufrieden sein, weil Karfreitag war. Auch die gläubigen Katholiken fasteten. Der Geistliche dagegen schlemmte ausgiebig. Fortan hielt mein Urgroßvater die Religion für pure Heuchelei.