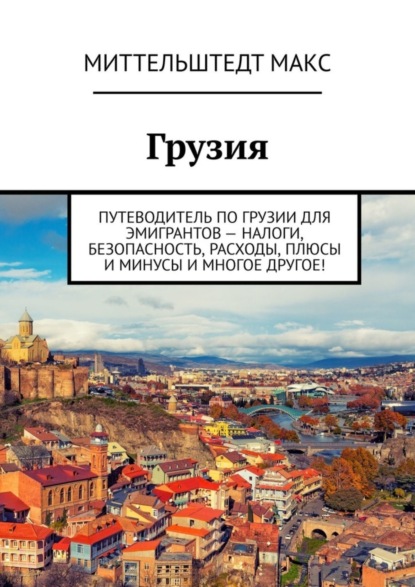Gespräche
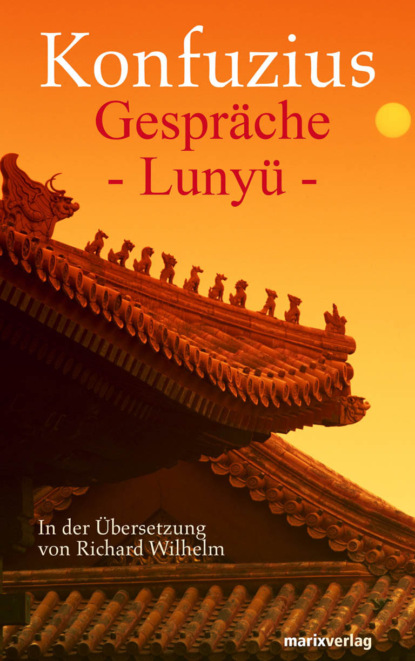
- -
- 100%
- +
Auf jeden Fall wird man anerkennen müssen, daß die Religion für Kung sozusagen einen ganz andern Ort im Seelenleben des Einzelnen und der Gesamtheit hat als im Christentum oder dem alttestamentlichen Prophetismus. Eine persönliche Beziehung des Einzelnen zu Gott als höchstes Streben liegt ihm vollkommen fern. Er bindet den Einzelnen durchaus an die diesseitige menschliche Gesellschaft. Und für diese Bindung benutzt er die Seelenkräfte, die anderwärts für die Religion frei wurden. Darum kann man wohl sagen, er hat der Religion, als der persönlichen Beziehung der Menschen zu Gott, die Kräfte entzogen und diese Kräfte dazu benutzt, um den Menschen an die Organisation der menschlichen Gesellschaft zu binden. An Stelle der Religion tritt für ihn die religiös betonte Pietät.
Aus dieser Stellung ergibt sich von selbst die wesentlich optimistische Beurteilung des Wesens des Menschen. Wo der Mensch in Beziehung tritt zum Unendlichen, zu Gott, erwacht als Reflex das Bewußtsein des Unzureichenden, der Sünde. Wo dagegen der Blick auf das Diesseits beschränkt bleibt, kann von »Sünde« im religiösen Sinn nicht die Rede sein. So ist denn auch für Kung der Begriff der Sünde etwas Fremdes. Der Mensch ist von Natur gut, und es liegt in der Hand jedes Einzelnen, durch einfachen Willensentschluß die Anlagen seines Wesens zur Entfaltung zu bringen. Alles Nichtgute und Schlechte ist nur ein Stehenbleiben der Entwicklung und kann durch vermehrte Kraftanstrengung überwunden werden. Daher steht er auch der Vergangenheit durchaus positiv gegenüber. Alles, was die Menschheit braucht zu einem Paradies auf Erden, ist in den Prinzipien der heiligen Könige des Altertums schon vorhanden; daher nirgends der Gedanke bei ihm, daß ein neuer Anfang, eine Weiterentwicklung und Überwindung des Vergangenen notwendig sei. Alle Mißstände der Zeit, die er in seinem eigenen Leben zur Genüge kennen gelernt hat, sind zu überwinden durch Reform. Der Erlösungsgedanke liegt ihm fern; es bedarf nur eines Fürsten, der den Idealen des Altertums in seiner Person praktische Wirksamkeit verleiht, und alles wird wieder gut. Sind erst die Menschen in Ordnung, so werden auch Himmel und Erde und der gesamte Naturverlauf in Ordnung kommen. Alle Störungen des Naturverlaufs sind nur Folgen von Unordnungen im Menschenleben, ebenso wie alle Verbrechen unter der Bevölkerung nur Folgen einer mangelhaften Charakterentwicklung in der Person des Herrschenden sind. Auch in diesen Anschauungen liegt letzten Endes eine große Wahrheit. Aber was sozusagen auf der höchsten Stufe idealer Geschichtsbetrachtung seine Berechtigung hat, gewinnt doch ein ganz wesentlich anderes Gesicht mitten im Kampf und Streit der Entwicklung. Wenn wir uns daher fragen: Was hat Kung erreicht? – so darf nicht verschwiegen werden, daß gerade diese optimistische Grundauffassung verschiedene Mißerfolge zu verzeichnen hat.
Schon im Leben Kungs hat sich das deutlich gezeigt. Seine starke und reine Persönlichkeit hat allerdings auf die ihm Nahestehenden einen bleibenden Eindruck gemacht und ihm ein unauslöschliches Recht verschafft in der Geschichte der Menschheit. Aber den Gang der Ereignisse im ganzen konnte er nicht aufhalten, es fand sich kein Platz für ihn, von wo er seine Zeit hätte umgestalten können. Schritt für Schritt mußte er zurückweichen in seinen Hoffnungen, und es läßt sich nicht leugnen, daß er schließlich in einer gewissen Schwermut gestorben ist. Auch nach seinem Tod gingen die Dinge ihren Gang unaufhaltsam weiter, es kam alles, wie es kommen mußte; noch jahrhundertelang dauerte der Verfall der alternden Dschoudynastie, und nicht Kung und seine Lehren haben China umgestaltet und die auseinander fallenden Einzelgebiete wieder vereinigt, sondern ein rücksichtsloser Real-Politiker von der Art Napoleons, der in allen Stücken ungefähr das Gegenteil war von dem, was Kung sich unter einem idealen Fürsten dachte: der berühmte Tsin Schï Huang Ti. Der hat mit militärischer Gewalt die Lehensfürsten beseitigt und aus China einen bürokratischen Beamtenstaat mit absoluter Monarchie gemacht. Und damit hat er – und nicht Kung – der äußeren Gestalt des chinesischen Staates bis in die neueste Zeit sein Siegel aufgedrückt. Das Staatsideal Kungs deckt sich durchaus mit dem Lehensstaat auf der Grundlage der Familienverwandtschaft, wie ihn die Dschoudynastie geschaffen hatte. Dieses Staatsideal ist nicht mehr zur Wirklichkeit geworden, die Geschichte schlug andere Bahnen ein, auch die späteren Dynastien haben daran nichts mehr geändert. Auch eine Reihe seiner sonstigen Anregungen, namentlich auf ethisch-ästhetischem Gebiet sind nicht durchgedrungen. So ist besonders die Musik, auf deren Einfluß zur Erziehung des harmonisch gestimmten Seelengrundes er große Stücke hielt, in den Stürmen und Umwälzungen der kommenden Jahrhunderte verloren gegangen. Die Kontinuität der Tradition wurde unterbrochen, und von der hohen altchinesischen Musik mit ihren Wirkungen hat heutzutage in China niemand mehr eine Ahnung; nur märchenhafte Sagen über ihren Einfluß sind noch erhalten, die an die Orpheussagen des griechischen Altertums gemahnen. Was dagegen heute in China als Musik produziert wird, entstammt ganz anderen Quellen und würde von Kung nicht der Beachtung für wert gehalten werden. Fiel somit ein wesentliches Hilfsmittel zur Ausgestaltung der Innerlichkeit fort, so ist es nur zu verständlich, daß die Innerlichkeit und der Ernst der Gesinnung, die für Kung ein und alles waren, im Lauf der Zeit immer mehr zurücktraten, immer mehr die äußere Form sich in den Vordergrund drängte. Im Zusammenhang damit nahm auch die geistige Weite und Toleranz unter den Anhängern Kungs immer mehr ab, und es wurde nicht vermieden, daß sich auch an seine Persönlichkeit eine starre und unduldsame Orthodoxie im Laufe der Zeiten anschloß, die anders Denkende verfolgte und zu unterdrükken strebte, wenn auch zu ihrer Ehre gesagt werden muß, daß sie doch nie den Gipfel der Intoleranz erreichte, zu dem die christliche Kirche in ihren schlimmsten Zeiten unter Preisgabe ihrer eigenen Prinzipien sich hinreißen ließ. Je mehr die hohe Innerlichkeit des Meisters verloren ging, desto mehr suchte das Volk für seine Gemütsbedürfnisse andere Quellen auf, und ein dichtes Netz von allerlei Aberglauben umstrickte die Gemüter; die Wind- und Wasserlehre, der Gräberkult in seiner heutigen Form, die Anfertigung von Götzenbildern und all die hypnotisch-spiritistischen Zauberlehren, die so lange Zeit charakteristisch für China waren und allen geistigen Fortschritt hemmten, die trotz und entgegen der konfuzianischen Lehre ihren Siegeszug machten. Aber alle diese Mißerfolge dürfen den Blick nicht trüben dafür, daß Kung dennoch einen Erfolg erreicht hat wie wenige der Heroen der Weltgeschichte. Gewiß, der Verfall des alten Bauwerks der chinesischen Kultur ließ sich nicht mehr aufhalten. Die Bedingungen, unter denen zur Hanzeit im dritten Jahrhundert vor Christus eine neue Welt aus den Trümmern zu steigen begann, waren sehr wesentlich verschieden von denen, die Kung vorausgesetzt hatte. Der bürokratisch zentralisierte Staat wurde auch künftig übernommen und durch alle Zeiten mehr oder weniger beibehalten. Infolge davon mußte der von Kung überlieferte Plan sich einige Änderungen in der Durchführung gefallen lassen. Doch bewies sich das Werk Kungs lebensfähig genug, um diese Änderung zu überstehen. Allmählich hob er sich von der Masse der Tagesgrößen immer klarer ab, und es entstand ein neuer Bau, der der chinesischen Kultur Obdach gab. Wiederholt im Lauf der chinesischen Geschichte sind gefährliche Stürme über den stolzen Bau der konfuzianischen Kultur hingegangen. Ja, man darf wohl vermuten, daß selbst die Menschen, die heute in China leben, Rassenelemente in sich tragen, die vom alten Chinesentum wesentlich verschieden sind. Dennoch hat Kungs Werk alle diese Stürme überdauert. Zu einem so gefährlichen Zusammenbruch wie am Ende der Dschouzeit ist es nie wieder gekommen. Der Grund davon ist, daß Kung eine wesentlich solidere Basis für die chinesische Kultur geschaffen hat. Die Dschoukultur mußte zugrunde gehen, weil ihre Prämisse, der Heilige auf dem Thron, etwas war, das in einer Dynastie mit Erbfolge notwendig versagen mußte. Kung hat eine breitere Grundlage geschaffen. Vor ihm war der Heilige als Herrscher der Träger der Kultur, durch ihn wurde der gebildete Mittelstand in seiner Breite der Träger der Kultur. Hier wurde die öffentliche Meinung erzeugt, der kein Fürst auf die Dauer entgegenarbeiten konnte. Dadurch bekam das Fundament der Kultur, das nun demokratisch gestürzt war, eine so lange Dauer. Man darf sich jedoch nicht vorstellen, daß dieses Durchdringen seiner Lehren kampflos vor sich gegangen sei. Bei seinem Tode hinterließ er eine Reihe von Philosophenschulen, die in kleinlicher Eifersucht sich befehdeten, und von denen jede die reine Lehre des Meisters zu haben vorgab. Allmählich setzte sich dann aber doch die eine Richtung als maßgebend durch, welche, von dem treuesten und hingebendsten Schüler des Meisters, Dsong Schen, begründet und von dem genialen Enkel Kungs, Dsï Si, fortgeführt, in Mong Ko (Menzius) ihren begabtesten Propagandisten gefunden hat. Dadurch war zunächst innerhalb der Schule eine gewisse Einheit der Tradition gesichert. Hand in Hand damit ging eine Auseinandersetzung mit den andern Philosophenschulen. Man darf nie vergessen, daß Kung nicht der alleinige und vollständige Zusammenfasser des chinesischen Altertums war. Im Taoismus liegen Seiten des altchinesischen Wesens vor, die noch über Kung zurückführen. Die konfuzianische Schule war eben nur eine unter den vielen Philosophenschulen der Zeit, von denen neun sich einen besonderen Namen gemacht haben. Namentlich der Dialektiker Mong machte es sich zur Aufgabe, durch Disputation in Kontroversen mit Andersdenkenden der guten Sache zum Sieg zu verhelfen. Es ist seiner Redekunst auch gelungen, eine ganze Reihe bedeutender Denker dauernd als schwarze Schafe zu brandmarken. Doch war dieser Sieg auch mit gewissen Nachteilen verbunden. Die große, freie Art des Meisters, der seine Wahrheit niemand aufdrängte, sondern nur dem mit Interesse und Verständnis Suchenden stufenweise erschloß, wich unter den Händen des eifrigen Reisepredigers einer logisch durchgearbeiteten, dogmatisch gefärbten Schullehre.
Seine schwerste Probe hatte der Konfuzianismus zu bestehen im Kampf mit dem Zäsarismus des Tsin Schï Huang. Einer solchen, auf Realpolitik gegründeten Despotennatur mußte das ethische Staatsideal des Konfuzianismus, das weit mehr die Pflichten der Herrschenden betont als ihre Rechte, prinzipiell zuwider sein. So ist es denn begreiflich, daß Tsin Schï Huang mit Feuer und Schwert gegen die Bücher des Konfuzianismus und seine Anhänger vorgegangen ist. Dennoch hat der Fürst letzten Endes nichts erreicht; an dem charaktervollen Widerstand der Gelehrten, die auch den Tod für ihre Überzeugung nicht scheuten, scheiterte das Machtgebot des Einzelnen. Die Dynastie verschwand schon nach der zweiten Generation, und die neu aufkommende Handynastie ließ es sich von Anfang an angelegen sein, den Meister und seine Anhänger in ihre alten Ehrenrechte einzusetzen. Die verbrannten Schriften wurden teils in einzelnen Exemplaren wiedergefunden, teils auf Grund mündlicher Tradition neu zusammengestellt, teils auch nach Bedarf fabriziert. Das Andenken des gewalttätigen Gegners auf dem Throne aber wurde von den Literaten für Jahrhunderte verfemt.
Weitere Auseinandersetzungen, namentlich mit dem von Süden her nach China importierten Buddhismus, brachten eine fortgehende Gedankenarbeit, die in der Sungdynastie von dem berühmten Gelehrten Dschu Hi zu einem gewissen Abschluß geführt wurde, nicht ohne Aufnahme verschiedener buddhistischer Gedankenlinien in die konfuzianische Schulphilosophie. Nachdem noch unter der Mingdynastie, namentlich durch Wang Schou Jen, eine von Dschu Hi abweichende, mehr historisch-kritische Richtung sich geltend machte, die besonders im japanischen Konfuzianismus bis auf den heutigen Tag großen Einfluß hat und von hier aus neuerdings auf China zurückzuwirken beginnt, ist von den ersten Kaisern der Mandschudynastie Dschu Hi’s Interpretation als autoritativ bezeichnet worden. Unter dem Kaiser Kiän Lung wurde der revidierte Text der dreizehn als klassisch bezeichneten Schriften auf steinernen Tafeln im Konfuziustempel zu Peking eingegraben, der seitdem durch kaiserlichen Befehl als maßgebend festgelegt ist.
Die hohe Verehrung, die Kung durch die Mandschudynastie gezollt wurde und die soweit ging, daß er beim großen Opfer als Genosse des höchsten Gottes verehrt wurde, hat nun neuerdings eine schwere Gefahr für ihn gebracht. Mit der Mandschudynastie brach auch die Verehrung Kungs in Trümmer. Sein Tempel verfällt. Keine Opfer werden ihm mehr gebracht. Die Literaten haben sich zum Teil anderen Idealen zugewandt, zum Teil stehen sie einflußlos abseits. Es scheint, als sei für den Konfuzianismus wieder eine ähnlich gefährliche Zeit gekommen wie die des Tsin Schï Huang. Ja, gewißermaßen ist heute die Gefahr noch größer. Denn was zusammengebrochen ist, ist nicht wie damals nur ein Glied im großen Zusammenhang, vielmehr sind die gesamten Grundlagen erschüttert. Der Fürst ist beseitigt und damit die notwendige Form des konfuzianischen Staates. Denn man mag sagen, was man will: auf eine Republik läßt sich die konfuzianische Staatslehre nicht aufpfropfen. Aber die Auflösung geht weiter. Die gesellschaftliche Struktur kommt ins Wanken. Die Familie, in der die wichtigsten Beziehungen der konfuzianischen Lehre wurzeln, ist in einer radikalen Umgestaltung individualistischer Art begriffen. Allerdings werden neuerdings wieder von den Autoritäten Versuche gemacht, die Stellung Kungs zu heben. Mit dem bisherigen Radikalismus kommt man nicht weiter. Doch die konfuzianische »Kirche», die in der Gründung begriffen ist und vom Christentum manche Formen geborgt hat, ist jedenfalls etwas prinzipiell anderes als was Kung gewollt.
Die Frage ist nun: Wird Kungs System die Wirren des heutigen Tages überdauern? Oder wird es untergehen in der Umwandlung der alten chinesischen Welt? Für alle Fälle ist es der Mühe wert, diesen Versuch der Menschheitsorganisation zu retten zu einer Zeit, da unmittelbare Anschauung seine Kenntnis noch ermöglicht; denn es handelt sich um eine der wichtigsten Erscheinungen in der Menschheitsgeschichte.
Fragen wir uns zum Schluß, was Kung Dauerndes geschaffen hat, so ist wichtiger als alle kunstvoll verschlungenen Linien seines Gedankengebäudes das persönliche Moment, das uns in ihm entgegentritt. Kurz gesagt: Es ist die Souveränität der sittlichen Persönlichkeit, die uns an ihm imponiert. Diese Unabhängigkeit von allen äußeren Gesichtspunkten wie Lohn und Strafe, die ruhige Klarheit, die sich von allem Abergläubischen und Verzerrten besonnen zurückhält, diese Energie des Forschens, die unermüdlich einzudringen sucht in die Wahrheiten des Lebens, diese abgerundete Einheit, die konsequent der inneren Gesinnung in allen Äußerungen den rechten Ausdruck zu geben sucht, – das alles sind Momente, die ihn über seine Zeit wie überhaupt jedes zeitlich beschränkte Niveau emporheben und seinem Beispiel Kraft verleihen. Kung ist eine Natur, die unserem Kant in vielen Stücken wesensverwandt ist, soweit man einen praktischen Politiker mit einem wissenschaftlichen Forscher überhaupt vergleichen kann. Dieses Vorbild hat denn auch immer wieder in der chinesischen Geschichte seine Nachahmer gefunden, die charaktervoll und unentwegt im Strudel der Ereignisse dastanden und auch unter ungünstigen Verhältnissen den Mut zur energischen Vertretung der Wahrheit und Gerechtigkeit fanden. Aber auch unter den Grundsätzen, die er für das Zusammenleben der Menschen aufgestellt hat, sind manche, die bis auf den heutigen Tag noch nicht Allgemeingut geworden sind, so der Grundsatz, daß sich Menschen dauernd nur beherrschen lassen durch die Macht einer sittlich ausgebildeten Persönlichkeit, nicht durch äußeren Zwang der Gesetze. Dem zur Seite steht der andere Grundsatz, daß die gesamte staatliche Ordnung auf natürlichen Grundtatsachen des menschlichen Wesens beruhen muß. Die sittliche Grundlage der gesamten Politik wird trotz allen Schwierigkeiten und der temporären Unmöglichkeit ihrer Durchführung so lange als ein forderndes Ideal vor der menschlichen Gesellschaft stehen, bis sie auf irgendwelche Weise ihren wahrheitsgemäßen Ausdruck gefunden hat.
Über das Alter der Lun Yü
Die Gespräche des Kung Fu Dsï oder Lun Yü stammen in ihrer heutigen Gestalt – abgesehen von einigen späteren Textvarianten – aus der Hand des Dschong Hüan (Dschong Kang Tschong), der von 127–200 n. Chr. lebte. Er stammte aus Kaumi bei Kiautschou und hat den späteren Teil seines Lebens im Lauschan bei Tsingtau verbracht. Für seine Redaktion des Textes lagen ihm drei Quellen vor. Die eine stammte aus dem Staate Lu. Sie enthielt – ebenso wie die heutige Ausgabe – zwanzig Bücher. Liu Hiang, der im ersten Jahrhundert v. Chr. im Auftrag des Kaiserlichen Hofes die alten, neu ans Tageslicht gekommenen Bücher zu begutachten hatte, sagt über diese Quelle, deren Überlieferer im ersten vorchristlichen Jahrhundert er namentlich aufführt, daß sie lauter gute Worte des Meisters Kung enthalte, die seine Schüler im Gedächtnis behalten haben. Die zweite Quelle waren die Lun Yü aus dem Staate Tsi, für deren Überlieferung ebenfalls eine Reihe von Namen angegeben werden. Sie enthielten zweiundzwanzig Bücher und waren, wie es scheint, wesentlich ausführlicher als die Quelle von Lu. Sie scheinen jedoch eine spätere Traditionsschicht darzustellen. Wir können uns eine ungefähre Vorstellung davon machen, wenn die Tradition richtig ist, daß das sechzehnte Buch im wesentlichen aus der Rezension von Tsi stammt. Die einzelnen Worte sind nicht eingeleitet mit dem Satz »Der Meister sprach«, sondern mit »Meister Kung sprach.« Alle diese Abschnitte, die sich übrigens nicht nur im sechzehnten Buch finden, zeigen deutliche stilistische Verschiedenheiten. Wo es sich um Gespräche handelt, ist die Situation mehr ausgemalt. Die Worte selbst sind sprachlich glatter. Mehrere Worte sind häufig zusammengefaßt und unter Zahlenreihen subsumiert. Es sind zu manchen dieser zusammengefaßten Äußerungen die einzelnen Bestandteile noch getrennt vorhanden. Alles in allem ist der Befund der Tsi-Rezension so, daß man es nur billigen kann, daß sie bei der endgültigen Redaktion erst in untergeordneter Linie berücksichtigt worden ist. Nun gibt es noch eine Quelle, die auf den ersten Blick das meiste Zutrauen zu verdienen scheint: die sogenannten »alten Lun Yü«. Als nämlich im Jahre 150 v. Chr. der damalige Fürst von Lu seinen Palast erweitern wollte, beabsichtigte er zu diesem Zweck das noch erhaltene Wohnhaus Kungs abreißen zu lassen. Allein eine wunderbare Musik ertönte, die ihn so erschreckte, daß er von dem Vorhaben abstand. In einer der Mauern aber fand sich ein Exemplar des Buchs der Urkunden (Schu Ging), der Gespräche (Lun Yü) und des Buchs von der Ehrfurcht (Hiau Ging). Diese Werke waren in alten kaulquappenähnlichen Zeichen geschrieben, die kein Mensch lesen konnte, bis sie ein Nachkomme des Meisters, der Gelehrte Kung An Guo, entzifferte und herausgab. Diese Ausgabe schloß sich im allgemeinen an die Rezension von Lu an, nur war das letzte Buch in zwei geteilt (Bei »Dsï Dschang fragte« begann das einundzwanzigste Buch, so daß diese Ausgabe zwei Bücher mit dem Titel »Dsï Dschang« enthielt: Buch XIX und XXI). Außerdem standen Buch VI und X an anderer Stelle.
Merkwürdigerweise blieb diese Entdeckung gänzlich unbeachtet. Es dauerte Jahrhunderte, ehe sich ein chinesischer Gelehrter darauf einließ. Erst Ma Ying, der Lehrer des Dsong Hüan, hat die alten Lun Yü wieder aufgenommen. Nun hat ja die Art der Auffindung, die sehr stark an den Fund des Deuteronomiums in Jerusalem erinnert, etwas an sich, das einen gewissen Verdacht nahe legt. Auch mit den »Kaulquappenzeichen« hat es eine eigene Bewandtnis. Die alte chinesische Schrift, wie sie uns auf Orakelknochen, Bronzen und den Steintrommeln in Peking zugänglich ist, hat keineswegs die Form von Kaulquappen. Vielleicht ist die Bezeichnung Kaulquappenzeichen ein Ausdruck, der ursprünglich überhaupt nicht chinesische Zeichen meinte, sondern Keilschriftzeichen, die auf irgendeine Weise nach China gekommen sein mögen. Auch ist recht schwer glaublich, daß die alte Schrift, die bis zur Zeit Tsin Schï Huangs im Gebrauch war, in der kurzen Spanne von einem halben Jahrhundert gänzlich unlesbar geworden sein sollte. Da es sich aber in den alten Lun Yü um eine Rezension handelt, die mit der Rezension von Lu ziemlich übereinstimmte, so können wir die Frage auf sich beruhen lassen, obwohl es natürlich sehr wertvoll wäre, wenn man eine bezeugte Spur des Vorhandenseins einer schriftlichen Sammlung von der Tsindynastie besäße, da die Bezeugung der Quelle von Lu nicht über die Handynastie hinaufgeht.
Was nun die Abfassung eines Werkes mit Namen Lun Yü »Gespräche des Meisters« anlangt, so sind wir imstande, die Tradition, nach der das Werk von den Schülern des Meisters nach dessen Tode niedergeschrieben sei, positiv zu widerlegen. Nicht nur findet sich in unseren Lun Yü eine Stelle (Buch VIII, 3 und 4), wo der Tod des Schülers Dsong Schen berichtet wird und ein Beamter (Mong Ging) mit seinem posthumen Namen genannt wird, der fünfzig Jahre nach Kungs Tod noch lebte, – das ganze Buch XIX enthält keinen einzigen Ausspruch von Kung, sondern führt unzweideutig in die Zustände der Schulen ein, die seine Jünger nach seinem Tode gegründet. Aber auch die Auskunft, daß die Schüler der Schüler die Lun Yü niedergeschrieben haben, ist unhaltbar.
Man wird sich die Sache wohl so vorzustellen haben, daß Worte des Meisters sich durch mündliche Tradition Generationen lang fortgepflanzt haben, ohne schriftlich gesammelt zu werden. Man macht sich von der Kraft und Treue mündlicher Traditionen im allgemeinen in Europa wenig Begriff, wogegen in China sich das Auswendiglernen großer Texte bis in die neueste Zeit erhalten hat. Wir finden einzelne in den Lun Yü enthaltene Worte in der späteren Literatur bis herab auf Mong Dsï zitiert. Aber die Art des Zitierens läßt erkennen, daß kein geschlossenes Werk mit dem Titel Lun Yü vorlag. Die Worte werden als Worte Kungs zitiert, ohne eine schriftliche Quelle zu nennen. Ganz in derselben Weise werden andere Worte, die sich in Lun Yü nicht finden, als Worte des Meisters erwähnt. Auf der andern Seite wird in Mong Dsï ein Wort, das in Lun Yü als vom Meister gesprochen steht, dem Mong Dsï zugeschrieben. Kurz, man kann mit Sicherheit behaupten, daß zur Zeit des Mong Dsï die Lun Yü noch nicht bestanden. Viel wahrscheinlicher ist es, daß sie erst im Anschluß an das Werk des Mong Dsi entstanden sind. Nachdem die Gespräche des Mong Dsï von seinen Schülern aufgezeichnet vorlagen, lag der Gedanke nah, auch eine ähnliche Sammlung der Gespräche Kungs herauszugeben. An Material teils mündlicher Tradition, teils in andern Werken (besonders Li Gi, Da Hüo, Dschung Yung) vorhanden, fehlte es nicht. Ja, wir haben noch heute außer den Lun Yü so viele Äußerungen Kungs verzeichnet, daß daraus noch im neunzehnten Jahrhundert eine sehr interessante Sammlung konfuzianischer Gespräche unter dem Titel »Kung Dsï Dsï Yü«, die in einer Sammlung von philosophischen Werken erschien, sich hat zusammenstellen lassen.
Daß die Lun Yü nicht zu den alten Werken chinesischer Literatur gehören, beweist auch der Umstand, daß sie nicht unter den fünf Klassikern (Ging) stehen, sondern unter den erst in neuerer Zeit als Schriften zweiten Ranges rezipierten vier Schriften (Schu). Wir werden daher bei aller Anerkennung dessen, daß sie gutes, zuverlässiges Material enthalten, zu dem Schluß kommen müssen, daß sie ihre heutige Gestalt erst in der Handynastie erhalten haben.
Buch I
Hüo Erl
1. Glück in der Beschränkung
Der Meister sprach: »Lernen1 und fortwährend üben: ist das denn nicht auch befriedigend? Freunde haben, die aus fernen Gegenden kommen: ist das nicht auch fröhlich?
Wenn die Menschen einen nicht erkennen, doch nicht murren: ist das nicht auch edel?«

Das Glück besteht in der Möglichkeit, seine Prinzipien durchführen zu können. Aber das hängt nicht von uns ab. Es gibt aber auch ein Glück für den, dem das alles versagt ist. Das Erbe der Vergangenheit sich anzueignen und es ausübend zu besitzen: das gewährt auch Befriedigung. Wenn dann der wachsende Ruhm aus fernen Gegenden Jünger herbeiführt: das ist auch Freude. Von der Welt sich verkannt zu sehen, ohne sich verbittern zu lassen: das ist auch Seelengröße.