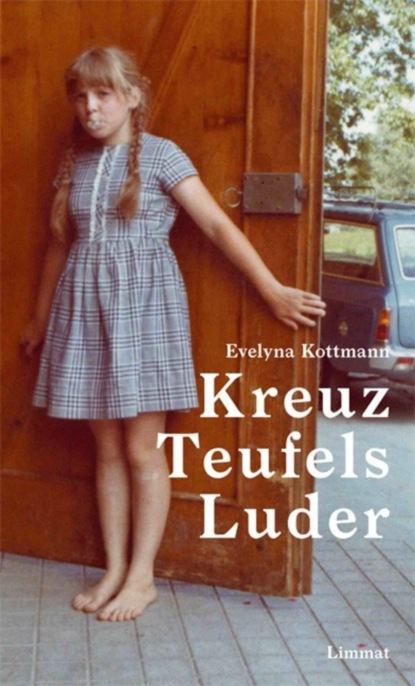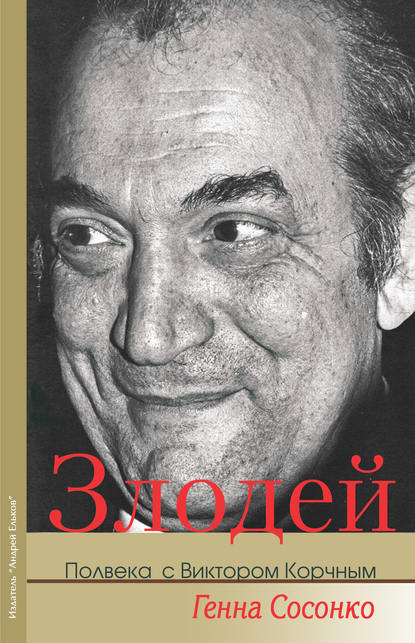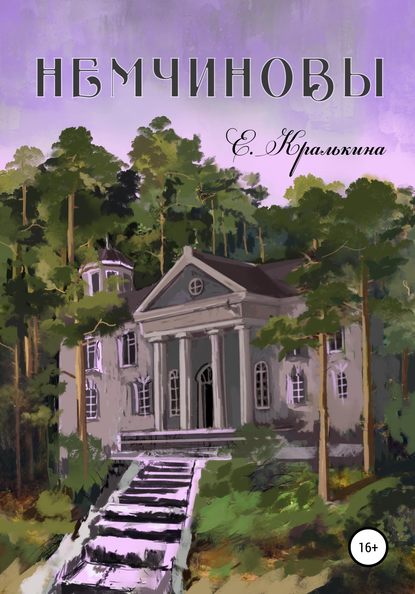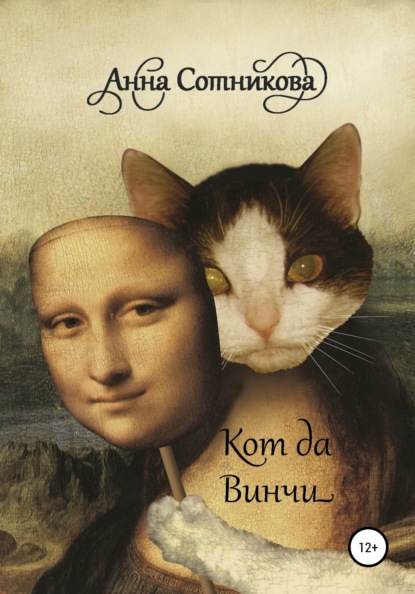- -
- 100%
- +
Fröstelnd zog ich mich nochmals am Fensterrahmen hoch, und das eingetrocknete Blut an meinen Händen wurde wieder lebendig. Statt mit dem Kopf voran versuchte ich es nun zuerst mit den Beinen, stützte mich mit den Händen an der Wand ab und konnte mich so aus dem Fenster schieben. Dann hielt ich mich am Fensterrahmen fest, liess mich in die Tiefe fallen und landete nicht gerade sanft neben dem Eimer, der immer noch dastand. Die Beine taten mir weh, und auch die Hände. Ich musste eine Weile einfach so liegen bleiben. Ich roch Sträucher und das Gras, Wassertröpfchen befeuchteten meine Lippen, und ich merkte, wie durstig ich war. Dann hörte ich Schritte und Gesang. Ich rappelte mich auf, ging leise um das Häuschen herum und sah einen Mann in einem langen, braunen Mantel mit Kapuze, um den Bauch einen langen Strick. Auch um seinen Hals hing ein Strick.
Er sang und sang in einer mir unbekannten Sprache. Ich stand ganz still, damit er mich nicht bemerkte. Er schloss die Tür zum Häuschen auf, und als er die Türfalle hinunterdrückte, knirschte sie, als wollte sie sagen: «Lass mich doch in Ruhe.» Mir schien, dass die Tür sich nicht so richtig öffnen wollte, denn sie knirschte weiter und stimmte mit ein in seinen Gesang. Der Kapuzenmann ging hinein. Die Tür blieb einen Spaltbreit offen, sodass ich mich anschleichen und hineinschauen konnte, ohne dass der Mann mich sah. Er rückte einen Tisch mit einem Stuhl darauf in die Mitte des Raums, stieg hinauf, stellte sich auf den Stuhl und hantierte ununterbrochen singend an der Decke herum. Ich konnte nicht so richtig sehen, was er machte. Plötzlich stiess er den Stuhl um und baumelte an der Decke. Er zappelte mit den Beinen, als wollte er durch die Luft rennen. Er zuckte noch eine Weile, dann wurde er wohl müde. Dann hing er da, als würde er schlafen.
Ich musste an die Katze denken, die ihr Zünglein draussen hatte, nicht mehr frass und nicht mehr auf ihren Beinen stehen konnte. Ich wollte nachsehen, ob der Kapuzenmann auch die Zunge draussen hatte, und schlich mich leise in den Raum. Ich konnte nicht recht sehen, ob seine Zunge heraushing, aber seine Augen waren gross, und er starrte in den Raum. Dieses Starren erschreckte mich, und ich rannte aus dem Häuschen und in die Arme einer Schwester, die betend im Garten stand.
Dann ging alles sehr schnell. Ich stand plötzlich vor der Schwester Oberin. Tausende von Fragen prasselten auf mich nieder, es war, als würden mich grosse Wellen verschlingen. Ich rang nach Luft, bis mir ganz schwarz wurde vor Augen und ich in den tosenden Wellen die Orientierung verlor. Ich konnte keine einzige dieser vielen Fragen beantworten. Den Mann, der so oft in dem grossen Garten gewesen war, sah ich nie mehr.
*
Natürlich wollte ich danach auch die anderen Häuschen im Garten auskundschaften. Jedes Mal, wenn wir draussen spielten, suchte ich eine Gelegenheit, um zu verschwinden. Doch die Augen der Schwestern waren jetzt immer auf mich gerichtet. Bis es mir eines Tages schliesslich gelang, mich ihren Blicken zu entziehen, und meine Entdeckungslust mich wieder lebendig machte. Ich rannte davon, so schnell ich konnte, und stand plötzlich vor einem grösseren Häuschen. Die Tür stand offen, als hätte es auf mich gewartet und sich für mich geöffnet, damit ich nicht durch das Fenster klettern musste.
Drinnen lag ein riesiger Plastikknäuel. Er bewegte sich ganz langsam auf mich zu und machte eigenartige Geräusche. Dieses lebendige Plastik machte mir Angst. Trotzdem blieb ich stehen, starrte ihn an und hielt den Atem an. Er kam näher und näher, und ich wusste nicht, ob er mit mir spielen oder mich fressen wollte. Dann erschien wie aus dem Nichts der weisse Kopf. Er ging langsam zur Tür hinaus, kam wieder zurück und ging wieder hinaus, so als wollte er mir sagen: «Komm mit mir, ich bringe dich zurück.» Ich rannte davon. Mein Herz schien hinter mir herzurennen, so schnell waren meine Beine. Ich wollte an dem kleinen Häuschen mit den bunten Bällen vorbeirennen, doch meine Füsse liefen dort einfach nicht mehr weiter. Also blieb ich stehen und verschnaufte, bis auch mein Herz wieder bei mir war. Die Tür zum Häuschen stand einen Spaltbreit offen. Und auch ihr unfreundliches Knarren konnte mich nicht daran hindern, noch einmal hineinzugehen. Vielleicht warteten die bunten Bälle ja darauf, dass ich mit ihnen spielte.
Ich schaute zur Decke, wo der Kapuzenmann durch die Luft gerannt war, bis er ausgezuckt hatte. Aber es sah alles genauso aus, wie als ich durchs Fenster gekrochen war. Nur die bunten Bälle waren nicht mehr da. Ich dachte, sie hätten sich vielleicht versteckt, und begann sie zu suchen. Ich kletterte auf den Gestellen herum und schob alles zur Seite, aber die schönen Farben waren nirgends zu entdecken, und es lag auch kein Duft nach etwas Neuem mehr in der Luft.
Dann hörte ich eine Stimme meinen Namen rufen und beeilte mich, wieder zu den anderen zurückzukehren. Lauter fragende Augen schauten mich an, als ich wieder auftauchte. Eine Schwester packte mich schimpfend und schüttelte mich, hob ihre Hand und schlug mir ins Gesicht, sodass mein Kopf ganz heiss wurde und meine Wangen Feuer fingen. Ich vergoss keine Träne.
Wieder musste ich ins Büro der Schwester Oberin. Durch das Fenster sah ich auf der Strasse Mutter Lilith mit dem Kinderwagen auf und ab gehen. Ich wollte geradewegs zu ihr laufen. Doch ich musste dableiben und der Schwester Oberin zuhören. Ich hörte ihre Stimme nur aus der Ferne, denn ich wollte doch sehen, was in dem Scheesenwagen war. Ich wollte zu meiner Mutter, wollte sie riechen und bei ihr sein. Ich spürte, wie es mein Herz zerriss, weil ich nicht zu ihr durfte, und mein Körper begann zu weinen. Ich zitterte am ganzen Leib, bis ich mich nicht mehr auf meinen Beinen halten konnte und zusammenbrach. Dann kam der Mann im weissen Kittel, den ich von unserer Ankunft im Heim her kannte. Er stach mich und ich fiel in einen tiefen und heftigen Schlaf.
Von jenem Tag an musste ich jeden Abend ein kleines Becherchen mit einer Flüssigkeit trinken, die mir nicht schmeckte. Am Anfang spuckte ich sie wieder aus, bis die Schwestern anfingen, mich zu zweit dazu zu zwingen, sie zu schlucken. Die eine hielt mich fest, umklammerte mich mit dem Arm, als müsste sie mich ersticken, die andere hielt mir die Nase zu, bis ich den Mund öffnete und sie mir den Trank einflössen konnte. Sie krallte sich solange an meiner Nase fest, bis ich ihn geschluckt hatte. Danach schlief ich sehr schnell ein. Am Morgen war ich immer müde. Der Trank machte mich zu einem kleinen, leblosen Mädchen, das immer lieb und nett bei den anderen Mädchen blieb, nicht sprach und nicht lachte. Ich war in einer Welt, die still und ohne Farben war und in der ich keinen weissen Kopf mehr als Begleiter hatte.
Ich dachte, ich sei gestorben. Bald konnte ich das Bett nicht mehr verlassen. Die Einsamkeit machte mich krank. Ich vermisste die Wärme meiner Geschwister. Man rollte mich in Wolldecken ein, die mich von aussen wärmten, aber in mir drin wurde es kälter und kälter. Im grossen Schlafsaal war ich für Stunden ganz allein. Ab und zu kam eine Schwester, die mich mit viel Geduld und Überredungskunst dazu brachte, etwas zu trinken und zu essen. Eines Tages begann diese Schwester, an meinem Bett zu singen. Mein Herz wärmte sich an ihrem Gesang. Er erfüllte den Raum mit Freude, und ich konnte wieder Farben sehen. Licht und Wärme durchfluteten den Schlafsaal und liessen die Kälte weichen. Meine innere Kraft kam langsam zurück, und bald konnte ich wieder aufrecht sitzen.
Dann begann die Schwester, mir Geschichten zu erzählen. Ihr Singen gefiel mir aber besser, denn die Geschichten handelten immer von einem Mann, der alle Menschen liebte und alles heilen konnte. Das Geheimnis sei, einfach daran zu glauben. Einmal fragte mich die Schwester: «Glaubst du daran?» Ich schüttelte den Kopf. Es konnte nicht stimmen, dass es einen Mann gab, der so lieb war. Wenn sie aber Lieder sang über eine Mutter, die Maria hiess, gefiel mir das. Dann strömte viel Licht aus ihren Augen und Wärme strahlte durch ihr langes, schwarzes Kleid. Und ich stellte mir vor, dass diese Mutter Lilith sein könnte.
Als ich wieder gesund war, durfte ich mit dieser Schwester zusammen oft die Kapelle besuchen. Dort gab es an den Wänden grosse Bilder zu den Geschichten, die sie mir erzählt hatte. Die Mutter Maria stand in einem blau-weissen Kleid in einer Nische und schaute mich mit sanftem Blick an. Auf dem Arm hielt sie ein Kind, das Jesus hiess. Die Mutter und auch das Kind trugen einen strahlenden, goldenen Reif um den Kopf, der mir sehr gefiel. Ich schaute mir die vielen Bilder an den Wänden lange an, doch für meinen kleinen Kopf ergaben sie keinen richtigen Sinn. Maria und alle Erwachsenen in der Himmelswelt waren in lange Kostüme gekleidet. Nur die kleinen Kinder und die Engel, die sich durch diesen goldenen Kranz von den Kindern unterschieden, waren nackt. Die Bilder liessen mich wieder nackt auf dem Tisch tanzen, die Gerüche und das Stöhnen der Männer erfüllten plötzlich den Raum.
Die himmlische Welt war in zarten Farben gemalt, und in allen Gesichtern war ein leidendes Lächeln. Ich sah, wie Mutter Lilith lächelnd und leidend vom Gemälde herabstieg, ihr Kostüm auszog und es gegen kräftig bunte Kleider tauschte. Zuoberst an der Decke war ein Bild in Rot und Violett, das ganz anders war und doch irgendwie zu den anderen gehörte. Die Gestalt darauf war Mensch und Tier zugleich, sie hatte Hörner auf dem Kopf wie eine Kuh oder ein Geissbock, und ihre Augen waren eher Schlitze als kleine schwarze Kugeln wie bei den anderen himmlischen Gestalten. Nicht die Hörner störten mich, sondern der lange Schwanz, den sie in der einen Hand hielt. Mir kam es vor, als wäre das etwas Heiliges. Die Schwester aber meinte, das sei der Teufel, der die Menschen zu schlimmen Taten verführe, und dass wir uns vor ihm in Acht nehmen müssten. Warum er Hörner hatte und einen so langen Schwanz, konnte sie mir nicht erklären.
Als ich mich an den Bildern in der Kapelle sattgesehen hatte, kletterte ich in den Bänken herum und sang die Lieder über Maria, die die Schwester mir beigebracht hatte. Obwohl ich sie nicht verstand, machten sie mich glücklich. Während dieser Stunden in der Kapelle war ich das glücklichste Kind, denn es gab nur mich, die Bilder und die Schwester. Ich konnte tun und lassen und denken, was ich wollte, ohne ermahnt zu werden.
*
Inzwischen war es heiss geworden, die Tage waren lang, und wir Mädchen durften in den Ferien in die Berge reisen. Das wollte ich nicht so gerne, denn dort konnte ich meinen Bruder Arabat nicht sehen, dem es nicht gut ging bei seiner Schwester und den anderen Buben. Und ich litt schon so sehr darunter, Mascha und Alioscha nicht mehr sehen zu können.
Wir fuhren in einem grossen Auto, von dem aus wir auf die anderen Autos hinunterschauen konnten, an einen abgelegenen Ort. Es gab dort keine grosse Eingangstür und keinen abgeschlossenen Garten. Es gab keine Grenzen, kein Nicht-hinein-Dürfen und Nicht-hinaus-Dürfen. Dieses Haus mit seinen offenen Armen gefiel mir. Es hatte kleine Schlafzimmer mit je zwei Betten. Ich fühlte mich geborgen und nicht so verloren wie in dem grossen Schlafsaal im Heim.
In dem Raum, wo wir assen, stand ein Ofen, der mit glatten, glänzenden Blumenplättchen eingepackt war, als wollte er seine Wärme nicht so gerne mit uns teilen. Dieser Ofen war so gross, dass eine Steinbank auf ihm Platz hatte, auf die wir Mädchen uns setzten und einen ganz warmen Hintern bekamen. Damit der Ofen warm wurde, durften wir ihn von der Küche aus mit Holz füttern.
Während dieser Ferien mussten wir sehr viel zu Fuss gehen. Einmal fuhren wir mit einem Schiff, und der Wind tanzte mir um die Ohren, und das Wasser tobte und schäumte unter meinen Füssen, als wäre es wütend. Vielleicht hatte es Schmerzen, weil so ein Schiff ja gross und schwer ist. Dieser See musste einiges ertragen. Wir marschierten dann zu einem Ort, wo vor langer Zeit ein Kapuzenmann gewohnt hatte. Dieser Kapuzenmann konnte mit allen Tieren reden. Vielleicht verstand er die Sprache der Menschen nicht, so wie auch ich sie manchmal nicht verstand. Ich fand ihn nett und freundlich, denn er lachte mich an. Zu meinem Erstaunen trug er einen goldenen Kranz um den Kopf. Die Schwester erzählte, er sei der Schutzpatron der Tiere – die Menschen hätten ja die Engel. Er sei ein Gottesmann gewesen, so wie auch wir Kinder Gottes seien. Aber wir Kinder trugen doch keinen goldenen Kranz um den Kopf, sondern ein helles Licht, das wie ein Regenbogen unseren ganzen Körper umhüllte. Und auch der Kapuzenmann redete eigentlich nur mit den Vögeln. Also fing ich an zu zwitschern und auszuprobieren, ob ich auch mit den Vögeln reden konnte, wurde aber sofort zurechtgewiesen.
Als wir diesen heiligen Ort verliessen, bekamen wir zum Abschied eine Kette mit einem kleinen Kreuz, an dem der Jesus hing – so wie ich ihn aus der Kirche kannte. Nur waren dort das Kreuz und der Jesus viel grösser. Ich bekam eine hellblaue Kette, doch ich wollte eine rote, denn die gefiel mir besser, und ich durfte mit einem Mädchen tauschen. Die Schwester sagte, wir sollten ihr die Ketten geben, aber ich weigerte mich, zog meine über den Kopf und band sie mir so fest um den Hals, dass es fast wehtat. Jede einzelne der roten Perlen konnte ich am Hals spüren, als wollten sie sich in mich hineinfressen. Die Aufforderungen der Schwester, ihr meine Kette zu geben, blieben erfolglos, denn sie auszuziehen, war nicht so einfach. Damit wir in Frieden zurückgehen konnten, gab sie es schliesslich auf. Ich kam mir vor wie eine Prinzessin mit der Kette, die rot funkelte und glänzte, mir aber auch die Luft wegnahm. Alle anderen Mädchen wollten ihre Ketten jetzt auch gerne um den Hals tragen. Sie schielten immer wieder zu mir hinüber.
Später nahm mich die Schwester im Ferienhaus zur Seite und erklärte mir, das sei keine Halskette, sondern ein Rosenkranz zum Beten. Das wusste ich bereits, denn die Schwester hatte in der Kapelle immer einen braunen Rosenkranz dabei und zupfte beim Beten an den Perlen herum. Aber wie konnte ein rot glänzender Rosenkranz nur zum Beten sein, wenn er so in die Welt hinausstrahlte und wunderschön war. Da wollte er sich doch nicht verstecken! Sie konnte mich nicht überzeugen. Sie sagte, wenn ich ihr den Rosenkranz nicht gebe und ihn nicht mit Würde behandle, werde Gott mich strafen. Doch ich behielt ihn lieber an.
Als wir abends im Bett lagen und alles still war, nahm ich die enge Kette ab, um einschlafen zu können. Ich hielt sie fest in der Hand und ballte sie zur Faust, drehte mich vom Rücken auf den Bauch, meine Faust darunter. So konnte keine der Schwestern sie mir wegnehmen, während ich schlief. Doch die Nacht dauerte nicht lange. Der Himmel grollte, es donnerte laut, helle Streifen zuckten durch den Schlafsaal und gleich darauf donnerte es wieder. Die Schwestern holten uns alle in den Raum mit dem Ofen, und es wurde viel und heftig gebetet, als könnte jeden Augenblick etwas Schlimmes geschehen. Das helle Licht zuckte immer schneller, und das Krachen wurde immer lauter. Manche Mädchen weinten, während die Schwestern beteten und immer wieder mit einem Bäseli Wasser über uns träufelten. Dann zuckte ein gewaltiger, heller Strahl durch das Zimmer und verstreute kleine, rote Funken. Es roch nach Rauch und krachte über uns, als würde das Gebäude einstürzen. Die Gebete verstummten, und wir wurden alle mit lautem Geschrei in die wütende Nacht hinausgetrieben. Ich war barfuss und trug nur mein dünnes Kleidchen, in meiner Faust die rote Kette. Die anderen rannten weiter, nur ich blieb auf der Wiese vor dem Haus stehen. Der Himmel war immer noch voller Wut, und das Haus spuckte Feuer aus dem Dach. Es sah aus, als würden das Haus und der Himmel sich streiten. Der Himmel liess die hellen Strahlen zucken, das Haus liess die Flammen tanzen, und je roter die Flammen wurden, desto weniger zuckte der Himmel, und schliesslich verzog sich das Donnerwetter. Mit der Kette in der Hand sah ich zu, wie die Flammen das Haus verschlangen. Bis ich die Hand einer Schwester spürte, die mich vom Haus wegführte.
Am Morgen hielt ich meine Kette immer noch fest in der Hand. Die Schwester sah sie und zwang mich, sie ihr zu geben. Sie habe mich ja gewarnt vor Gottes Zorn, sagte sie. Gott musste dieses grelle Licht gewesen sein, das am Himmel gezuckt und das Haus mit den Flammen hatte tanzen lassen. Meine rote, glänzende Kette sah ich nie wieder.
*
Als wir aus den Ferien zurückkamen, war Arabat nicht mehr in der Bubengruppe. Das grosse Haus hatte ihn verschluckt, und für mich war das die schlimmste Gottesstrafe. Die Tage vergingen, und meine Einsamkeit wurde immer grösser, nur meine innere Welt konnte mich am Leben halten. Meine Fantasie brachte ab und zu Farbe in das dunkle Heim. So oft wie nur möglich hielt ich mich im grossen Garten auf. Oder ich machte das Versteckisspielen zu meinem Abenteuer, denn immer, wenn man mich suchte, wurden alle Mädchen eingespannt. Ich konnte mich gut verstecken. Es gab in dem grossen Haus so viele Ecken, die nur darauf warteten, endlich entdeckt zu werden.
Eines Tages musste ich von Kopf bis Fuss Sonntagskleider anziehen. Ich durfte mit einer Schwester in die Stadt fahren, denn es musste abgeklärt werden, ob in meinem kleinen Kopf alles mit rechten Dingen zuging. Ich sprach viel und gerne mit mir selbst, mein Kopf war ja voller Fragen, die ich mir selbst beantworten musste.
Als ich mit der Schwester in der Stadt war, durfte ich bei einer Frau spielen und zeichnen. Diese Frau nahm sich viel Zeit für mich, aber ihre Fragerei war mir zu viel, und ich weigerte mich zu sprechen. Trotzdem fand sie, dass es mir vielleicht ganz guttäte, den öffentlichen Kindergarten zu besuchen. Man wollte mir die Chance geben, mich nicht mehr wie ein wildes Mädchen zu benehmen, sondern mich anzupassen, sodass man Freude an mir bekommen könne. Obwohl es natürlich schwierig sei, Vaganten beizubringen, was normal und sauber und korrekt sei.
Im Kindergarten gefiel es mir. Nur das lange Sitzen und Zuhören machte mir Mühe. Ich wollte viel lieber mit den vielen schönen Spielsachen spielen, da wir im Heim doch nur so wenige hatten. Die Glaskugeln waren besonders verführerisch mit all diesen Farben drin, und sie hatten auch so gut Platz in meiner Rocktasche. Also sammelte ich Stück für Stück, nahm sie mit ins Heim und versteckte sie im grossen Garten unter einem Strauch. Für mich waren sie ein Schatz. Wenn ich konnte, lief ich zu ihm, spielte im Gras mit den Kugeln Versteckis, sammelte sie wieder ein und vergrub sie dann wieder. Ich hatte bald ganz viele Murmeln, und im Kindergarten gab es fast keine mehr. Das fand die Kindergärtnerin nicht gut, und sie wusste genau, wer die Murmeln mit nach Hause genommen hatte. Liebevoll, aber sehr bestimmt sagte sie zu mir, ich solle die farbigen Kugeln wieder in den Kindergarten bringen. Immer wieder forderte sie mich dazu auf, aber meine Kugeln blieben in ihrem Versteck. Ich achtete gut darauf, dass mich keiner im Garten erwischte. Und auch die Schwestern konnten keine Murmeln finden, auch wenn sie noch so eifrig und überall danach suchten.
Dann sollte ich lernen, die Schuhe zu binden. Ich kämpfte mit den Bändeln und war die Letzte, die es schaffte, sie ordentlich zusammenzuknüpfen. Viel lieber liess ich sie frei an den Schuhen herumfliegen, oder ich stopfte sie zwischen Fussknöchel und Schuhe. Das ging viel einfacher und auch schneller. So musste ich nicht so lange auf dem Bänklein hocken und kam auch nicht zu spät in den Kindergarten oder ins Heim. Das Kindergartenlied nahm ich beim Anziehen nämlich sehr ernst:
S Elfiglöggli lütet scho, jetzt esch Ziit zum heime go!
Uf em Wäg ned ome stoo
Und ned wie es Schnäggli goo
Bim Bam Bum
Zeit, um die Schuhe zu binden, nahm ich mir keine, liess mir dafür aber viel Zeit auf dem Hin- und Rückweg. Ich schaute einer Schnecke zu und lernte so ihre Welt und ihre Zeit kennen. Sie bewegte sich so langsam und genüsslich. Mich faszinierte, wie sie ihre Knopfaugen ausfuhr und wieder einzog, wenn ich sie berührte. Sie konnte ihre Augen überallhin richten, aber von dem vielen Gucken wurde sie müde und verkroch sich dann in ihrem Häuschen. Manchmal musste ich dann lange warten, bis sie wieder herausgekrochen kam. Und so kam ich immer zu spät dorthin, wo ich doch pünktlich hätte erscheinen sollen. Ab und zu tanzten auf meinem Weg auch gelbe Schmetterlinge herum, die mich dazu verführten, in ihrer Welt zu verweilen. Weil ich mit ihnen mittanzte, kam ich vom Weg ab und wusste am Ende nicht mehr, wo ich war. Das Tanzen und Flattern liess mich die Welt vergessen, in die ich eigentlich zurück musste.
Wieder einmal kam ich zu spät in den Kindergarten, weil mich eine Ameise aufgehalten hatte, die etwas trug. Ich wollte herausfinden, wohin sie damit wanderte, verlor sie aber aus den Augen und konnte sie nicht mehr ausfindig machen. Als ich schliesslich im Kindergarten ankam, setzte ich mich auf das Bänklein im Umkleideraum und wartete, bis die anderen Kinder herauskommen würden. Ich hatte viel Zeit, um die fein gestrickten Wolljäckchen der anderen Mädchen zu betrachten. Einige waren sehr schön, darin hätte ich mich wohlgefühlt. Ich hatte nicht so schöne Kleider wie meine Gspänli. Ich war das einzige Kind aus dem Heim.
Als es Zeit war, wieder nach Hause zu gehen, kamen die Kinder alle fröhlich heraus, und ich gab mir alle Mühe, so zu tun, als wäre ich wie alle anderen von Anfang an dabei gewesen. Die Kinder merkten nicht, dass ich draussen gewartet hatte, aber die Kindergärtnerin schon. Sie behielt mich zurück und fragte, wo ich denn gewesen sei. Aber sie bekam von mir keine Antwort. Zur Strafe musste ich auf der Bank sitzen bleiben und warten, bis sie mit ihren Vorbereitungen fertig war. Ich sass ganz allein im Vorraum und hatte viel Zeit, um mir nun die Finken genauer anzuschauen. Ich entdeckte ein Paar, das mir sehr gefiel. Da niemand mehr da war, probierte ich die schönen Finken an, und sie gefielen mir so gut, dass ich sie anbehielt. Meine Schuhe stellte ich an den Ort, wo ich mir die Finken genommen hatte. Ich glaubte, so nichts Unrechtes getan zu haben. Die Kindergärtnerin bemerkte nichts und begleitete mich ins Heim zurück. Auch die Schwestern schauten nicht auf meine Füsse. Niemandem fiel auf, dass ich neue Schuhe hatte. Ausser einem Mädchen, das merkte ich an ihrem Blick beim Mittagessen, und ich wusste, dass ihr die Finken auch gefielen.
Nach dem Essen ging ich in den dunklen Keller hinunter, zog die schönen Finken aus und versteckte sie hinter einem dicken Rohr. Da stand ich nun in den Socken und überlegte mir, wie ich das den Schwestern erklären sollte. Ich beschloss, sofort in den Kindergarten aufzubrechen, um ganz früh da zu sein. So könnte ich die Finken wieder gegen meine Schuhe tauschen, ohne dass jemand bemerken würde, dass ich sie spazieren geführt hatte.
Die Kindergärtnerin war sehr erfreut, dass ich es diesmal rechtzeitig geschafft hatte. Ich war die Erste, was noch nie vorgekommen war, und vor Freude übersah sie die Finken an meinen Füssen. Ich durfte mir zur Belohnung ein Buch aussuchen aus einem Regal, an das wir Kinder nur mit ihrer Bewilligung durften. Beschämt griff ich mir eines heraus und dachte schon, sie würde es mir erzählen wollen, bis die anderen eintrafen. Dabei hatte ich doch etwas zu erledigen. Zum Glück liess sie mich mit dem Buch wieder allein im Vorraum und ich konnte die Finken rasch zurückstellen, bevor die anderen Kinder kamen. Ei, war ich erleichtert!
Ich war so froh, dass ich nach dem Kindergarten schnurstracks und singend ins Heim zurücklief. Kaum angekommen, musste ich ins Büro der Schwester Oberin. Sie tadelte mich, weil ich immer zu spät kam, aber das machte mir nichts aus, denn ich war glücklich. Doch dann schaute sie auf meine Füsse und meinte, ich hätte doch am Mittag andere Schuhe angehabt. Ich war mir aber völlig sicher, dass das an meinen Füssen meine Schuhe waren. Und auch wenn sie nicht so schön waren wie die anderen, kamen sie mir in diesem Moment zauberhaft vor. Da ich so darauf bestand, dass es meine Schuhe waren, liess die Oberin die Schwester kommen, die für mich zuständig war. Sie schaute auf meine Füsse und sah nichts anderes als meine alten, abgetragenen Schuhe, die ich von ihr bekommen hatte. Erstaunt war sie aber schon, offenbar hatte sie etwas anderes erwartet.
Als die Schwester bestätigte, dass die Schuhe mir gehörten, wurde das Mädchen, das am Mittag die Finken an meinen Füssen bemerkt hatte, ins Büro geholt. Sie hatte etwas ganz anderes über meine Schuhe erzählt, als zu sehen war, und die Schwestern glaubten mir. Von jenem Tag an schaute mich das Mädchen immer böse an, wagte es aber nicht, mich zu reizen.