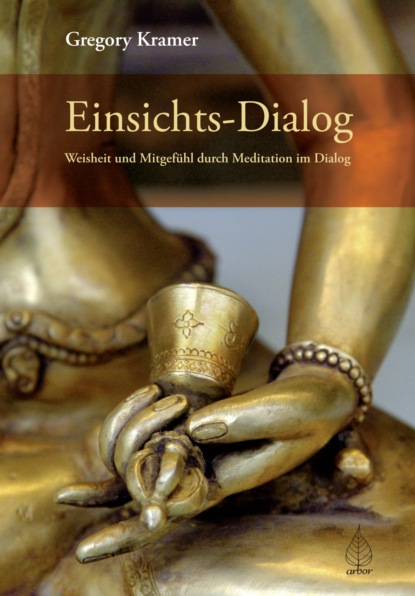- -
- 100%
- +
Stress ist manchmal versteckt, weil er mit Glück gemischt ist. Als zum Beispiel meine Söhne in den Ferien zu Hause waren, war unser Haus voller Leben, überbordender Aktivität und dem Selbstbehauptungsdrang frischgebackener junger Erwachsener. Überall stand Essen herum, und der Lärm war groß. Die Tage waren erfüllt mit Witzen, Ringkämpfen, zärtlichen Momenten. Aber als die Jungs wieder abfuhren, sagte meine Frau, sie fühle sich „abgenagt“ – wie von Geiern. Die Zeit war voller Freude – aber auch voller Arbeit, Aufregung und dem Geben und Nehmen, das den köstlichen und dornigen Charakter des Familienlebens ausmacht.
Bei anderen Arten von Stress ist das Elend ganz eindeutig. Einmal beschrieb uns eine Meditierende, wie es für sie war, mit einer sehr schwächenden und schmerzhaften Krankheit zu leben. Während wir an einem klaren Herbsttag zusammensaßen, die Bäume rund um den Meditationssaal in allen Farben leuchteten, weinte sie beim Sprechen. Noch entnervender als die körperlichen Schmerzen war für sie die Angst, dass die Krankheit nie mehr weggehen würde. „Es gibt keine Heilung, keinen Ausweg, nicht einmal eine verlässliche Prognose“, sagte sie. „Ich kann heute nicht sagen, ob ich morgen dieses oder jenes machen kann – nicht einmal, ob ich morgen überhaupt aufstehen kann.“ Und unter diesem schmerzhaften Zustand ständiger Anspannung verbarg sich der noch tiefere Schmerz der Einsamkeit: Ohne einen Partner und ohne angemessene Unterstützung war sie mit der Krankheit konfrontiert. Die letzten Jahre waren für sie eine Wüste gewesen. „Die Leute wissen nicht, was chronische Schmerzen sind. Nach einer Weile wollen sie nicht mehr darüber reden, nicht mehr mit mir reden. Ich fühle mich so schrecklich einsam.“
Viele Arten von alltäglichem Stress sind weniger offensichtlich. Vielleicht verfolgt uns den ganzen Tag eine diffuse Unzufriedenheit oder Entfremdung und überschattet unser natürliches Potential zu gelassenem Wohlbefinden und Verständnis. Heute wollen wir einfach nicht am Schreibtisch sitzen; wir haben einfach keine Lust, den Müll rauszubringen. Unsere Beziehungen sind voll solcher kleinen Unannehmlichkeiten: Wir haben keine Lust, mit der Kassiererin zu reden; wir drücken uns vor einem Rückruf. Ich erinnere mich, wie mich einmal mein pubertierender Sohn mit einem verächtlichen Grunzen abblitzen ließ. Kein großes Drama: Aber in diesem Moment wurde ich aus meiner Welt heraus in einen kleinen Käfig der Unzufriedenheit gerissen.
Sogar was uns Spaß macht, macht uns für Schmerz erst recht anfällig. Manchmal denken wir klar genug, um diesen Zusammenhang zu sehen. Eine Teilnehmerin an einem Dialog-Retreat beschrieb einmal sehr feinfühlig eine Serie von Stress-Erlebnissen, die schnell aufeinander folgten: ein angenehmes Gefühl der Liebe zu den anderen Retreat-Teilnehmern; dann Freude und Erleichterung über die Unterstützung dieser Gruppe; dann die Furcht, diese Gemeinschaft zu verlieren; dann ein Gefühl der Traurigkeit, gefärbt von der Erinnerung an frühere Verluste; dann ein geändertes Gefühl der Liebe, nun weniger angenehm und durch eine gewisse Vorsicht gedämpft. Sie fügte hinzu: „Das Ganze lief innerhalb von ein oder zwei Minuten ab.“ Dass sich Emotionen verändern wie ein Kaleidoskop, ist nicht ungewöhnlich; Freude kann sich schnell in Traurigkeit verwandeln, Traurigkeit wieder in etwas anderes. Die zwischenmenschlichen Verluste, die wir alle schon erlitten haben – Tod, Scheidung, Traumata, Umzüge, Stellenwechsel oder das langsame Sich-Auseinanderleben von Freunden –, haben uns konditioniert, sind fast ein Teil von uns geworden und beeinflussen tief greifend unser Erleben. Wie Schatten verbergen sich die Prägungen durch unsere Erlebnisse am Rande unseres Bewusstseins, bereit, in Sekundenschnelle zuzuschlagen, wenn die Bedingungen stimmen. Wir sind immer empfindlich und manchmal regelrecht wund – geben wir es ruhig zu! Sogar die, die immer eine rauhe Schale zeigen, haben das Leben mit einem sensiblen Nervensystem und in äußerster Verletzlichkeit angefangen. Wir legen uns nur in dem Maße eine Rüstung zu, wie die natürliche Sensibilität der Kindheit abgescheuert wird und die Hornhaut wächst, die wir „Erwachsensein“ nennen.
Aufgrund unserer komplexen Konditionierung kann sogar Freude Stress bringen, weil wir nach der Quelle des Glücks greifen und sie festhalten wollen – verkrampft und unausgeglichen, obwohl vielleicht gar keine Gefahr der Trennung oder des Verlustes besteht. Kleine Gewinne und Verluste ereignen sich fast andauernd. Wohlgefühl, Unbehagen; Gewinn, Verlust; Lob, Tadel: Sie zeigen uns den konditionierten Charakter des Lebens. Wir können der grundlegenden Tatsache nicht entrinnen, dass es, solange wir einen Körper haben, auch irgendwie Schmerz und Unbehagen geben wird. Wir können der Tatsache nicht entrinnen, dass die Welt um uns herum sich andauernd verändert; vergnügliche oder angenehme Situationen verändern sich zwangsläufig oder verschwinden. Wir selbst ändern uns; wir sind heute nicht mehr, was wir gestern waren. Das Verdrängen dieser Dinge verbannt uns aus der Realität und zieht uns immer tiefer in Entfremdung und Angst hinein.
Wenn wir aber ganz klar hinschauen, wie die Dinge eigentlich sind, können wir dem Dschungel unnötiger Angst entrinnen. Sich in einem echten Dschungel zu orientieren heißt, nach Erkennungszeichen zu suchen, wo wir sind und wo wir gewesen sind. Genauso täten wir gut daran, in diesem Dschungel des Elends nach Wegweisern zu suchen. Ein Konstrukteur von Autos kann es sich nicht leisten, die Reibung zu ignorieren; ein Architekt muss die Schwerkraft verstehen. Genauso darf jemand, der den Frieden verstehen will, nicht unwissend sein, welcher Mechanik Stress folgt. Ein Mensch, der Freude sucht, kann es sich nicht leisten, unwissend zu sein hinsichtlich der Kausalität, der das Leiden folgt.
Eine nüchterne Einschätzung des Leidens
Der Buddha sah ganz klar, dass Leiden eine zentrale Tatsache des menschlichen Lebens ist, und versuchte seinen Mechanismus zu verstehen. In seiner allerersten Unterweisung nach der Erleuchtung sagte er: „Dies, Mönche, ist die Edle Wahrheit vom Leiden: Geburt ist leidhaft, Alter ist leidhaft, Krankheit ist leidhaft, Tod ist leidhaft; Trauer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung sind leidhaft.“9 Innerhalb dieser grundlegenden Lehre können wir zwei große Untergruppen des Leidens unterscheiden: physisches oder biologisches Leiden und seelisch-psychologisches Leiden.
Geburt, Alter, Krankheit und Tod beinhalten den Körper betreffendes, biologisches Leiden. Sie entstehen zwangsläufig aus dem Geboren-Werden in einen Körper, der mit ruppigen, süßen, lauten, übelriechenden und bunten Objekten in Kontakt kommt. Kaum sind wir aus dem Geburtskanal heraus, überfallen uns kalte Luft, die unsere Haut berührt und in unsere Lungen dringt, grelle Lichter und die ersten ungedämpften Geräusche. Mutter bietet Geborgenheit, aber es ist nicht mehr dasselbe, es ist nicht genug. Die nächsten x Jahre muss dieser Körper ernährt, innerhalb eines gewissen Temperaturbereiches gehalten, vor Verletzungen und Mikroben geschützt und, wenn er nicht beschützt werden kann, bei der Heilung unterstützt werden. Dieser empfindliche Körper leitet selbst gewisse Veränderungen ein und steht dabei von der Morgen- bis zur verwirrenden Abenddämmerung des Lebens hormonelle und neurochemische Stürme durch. Physische Gestalt, Gefühle und Wahrnehmungen zu haben bedeutet, andauernd von den angenehmen und unangenehmen Dingen dieser physischen Welt berührt zu werden.
Wir erleben jedoch auch Leiden, das nicht direkt aus der physischen oder biologischen Situation herrührt. Trauer, Jammer, Schmerz, Gram und Verzweiflung rühren aus unserer Reaktion auf eine erlebte Situation her, nicht aus der Situation selbst. Wenn ich mir zum Beispiel die Hand breche, erlebe ich mehr als nur den physischen Schmerz des geschädigten Gewebes und der Nerven, die lautstark Aufmerksamkeit fordern – ich rege mich auch darüber auf, dass ich einen Monat lang nicht werde arbeiten können. Vielleicht ärgere ich mich auch über mich selbst, weil ich unvorsichtig war. Diese Emotionen sind an sich schon schmerzhaft. Sie sind auf Seelischem beruhendes, psychologisches Leiden. Was „durch gedankenhafte Berührung schmerzhaft, unangenehm empfunden wird“10, wie der Buddha es nannte, steigert unser Leiden ungemein. Sorge, Angst, Verwirrung und Unruhe entstehen aus den Ideen, Hoffnungen und Erinnerungen, die wir im Verlauf eines Lebens aufbauen. Wir haben einen konstruierenden Geist und ein Bewusstsein, das nach allem greift, was ihm der Geist anbietet; das bedeutet, dass wir ständig von den angenehmen und unangenehmen Produkten unserer emotionalen Geschichte berührt werden.
An einem Sommermorgen sah ich einmal ganz klar, wie der wuchernde Geist Leiden erzeugt. Ich wachte früh auf. Statt nach unten zu gehen und zu meditieren, entschied ich mich dafür, mein Erleben zu erforschen, wie es hier gerade war, im Bett. Als ich zu den Deckenbalken hochsah, die im Morgenlicht glänzten, sann ich den Aussagen des Buddha zu Gefühl und Wahrnehmung nach. Ich nahm wahr, wie Licht das Auge berührte, und das Auge funktionierte und eine Bewusstheit dieser Funktion – was wir „Sehen“ nennen – entstand. Im Moment des Kontaktes schien sofort ein „Ich“ da zu sein, ein Erleben: „Ich sehe jetzt.“ Immer wieder ließ ich diese Vorstellung los und entspannte mich in einfache Bewusstheit, einfaches Sehen. Als sich das stabilisiert hatte, tat ich dasselbe mit Geräuschen und körperlichen Empfindungen und kam damit zur Ruhe, heraus aus der gewohnheitsmäßigen Konstruktion eines Selbst.
Während dies geschah, drehte sich Martha, meine Frau, auf die andere Seite, und ihr Fuß berührte meinen Fuß. Sofort wallte eine Emotion auf. Es war kuschelig; ich war glücklich. Aber mit Hilfe des Flusses der Praxis ließ ich die geistige Fixierung los und stellte fest, dass dies einfach nur Berührung war. Es gab ein berührbares Objekt (Marthas Fuß), ein funktionierendes Sinnesorgan (meine Haut) und ein Bewusstsein der Berührung.
Zusammen mit diesem simplen Kontakt entstand in Beziehung zu „ihr“ ein „Ich“. Aus unserer langen, liebevollen gemeinsamen Geschichte kam auch ein Glücksgefühl auf. Dann bewegte Martha ihren Fuß weg. Sofort wurde ich traurig. Die Traurigkeit war leicht schmerzhaft. Ich hatte das angenehme Gefühl festhalten wollen, das ich mit dem schlichten Ereignis einer Berührungsempfindung verbunden hatte. Die Reaktion war automatisch, war konditioniert. An dieser ersten Welle der Traurigkeit hielt das Denken etwa zwei Sekunden lang fest; dann erkannte ich sie als einen Geisteszustand, der durch die Umstände ausgelöst worden war. Ich entspannte mich und blieb wieder beim Erleben des Berührungsempfindens von Moment zu Moment. Aber ich mochte dieses kuschelige Gefühl. Ich schaute zu, wie dieses Mögen sich steigerte, bis ich dachte: „Meditation hin oder her, ich möchte mehr Berührung.“ Also streckte ich meinen Fuß nach meiner Frau aus. Aber Martha schlief immer noch, wollte ungestört sein und drehte sich weg. Sofort fühlte ich mich abgelehnt. Dieses Gefühl entstand automatisch, eine Art Leidensreflex.
Wie entstand dieses Leiden? Seine unmittelbare Ursache war die konditionierte Emotion der Traurigkeit aufgrund einer vermuteten Ablehnung. Aber was steckte dahinter? Das Erlebnis beruhte auf einer Sinneserfahrung (die Berührung meiner Frau), dem Sinnesorgan (meine Haut) und einem Wahrnehmen körperlicher Empfindung, die alle sich mit bereits existierenden Konstrukten (Liebe zu meiner Frau und unserer gemeinsamen Geschichte) verbanden, um die Bedingungen für ein seelisch-emotionales Glückserlebnis zu liefern (meine Geliebte berührt mich). Das Glücksgefühl bei der ersten Berührung erzeugte den Wunsch nach mehr Berührung, was wiederum eine Anspannung in Form eines unbefriedigten Wunsches erzeugte (mein Verlangen). Dieser Hunger erzeugte Anspannung, die zu einer Handlung führte (ich streckte meinen Fuß aus), zu sich ergebenden Empfindungen (die kurze Berührung) und einer Emotion (flüchtiges Glücksgefühl). Darauf folgte weitere Anspannung, da komplexe Gebilde entstanden (ich interpretierte ihr Wegdrehen als Ablehnung, was konditionierte Ängste auslöste) sowie weitere Emotion (Traurigkeit).
Der Buddha fuhr in seiner Analyse des Leidens fort: „Mit Unliebem vereint, von Liebem getrennt sein ist leidhaft, Begehrtes nicht erlangen ist leidhaft.“ Diese Aussagen beschreiben verschiedene Arten seelischen Leidens. Im Hinblick auf Sinneswahrnehmungen verstanden, kommentieren diese Aussagen das Resultat eines Kontaktes mit unerwünschten Empfindungen wie Gerüchen oder Geräuschen. Aber der Buddha stellte klar, dass seine Aussagen auch menschliche Beziehungen betreffen: „Zu begegnen dem, der einem Unglück wünscht, Leid, Unangenehmes, Unsicherheit“ gehört ebenfalls zum „Unlieben“. Getrennt sein von Liebem bezieht sich nicht nur auf „Gewünschtes, Geliebtes, dem Auge, dem Ohr, der Nase Angenehmes“ und so weiter, sondern auch auf die Trennung von denen, die „einem Glück wünschen, Gutes, Angenehmes, Sicherheit, von Mutter oder Vater oder Schwester oder jüngeren Verwandten oder Freunden.“11
Die beziehungshaften Aspekte der Lehre des Buddha werden oft übersehen. Das lässt sich in allen buddhistischen Lehrrichtungen beobachten. Es ist, als wäre da eine unsichtbare Mauer, die diesen anrüchigen, obwohl unausweichlichen Aspekt unseres Menschseins von der jungfräulichen Reinheit der formalen Lehre Buddhas fernhält. Das Ergebnis ist eine große Unwissenheit bezüglich des Leidens, das mit menschlichen Beziehungen einhergeht, seiner Ursachen und des Wesens der Freiheit. Dieses Leiden ist übersehen und nicht beim Namen genannt worden. Es ist schlichtweg die Folge davon, als sensibles soziales Wesen in eine komplexe und wechselhafte zwischenmenschliche und soziale Umwelt hineingeboren zu werden. Das ist das zwischenmenschliche Leiden.
Großes Leiden ist leicht zu sehen: Es drängt sich dem Bewusstsein auf. Versuchen Sie einmal, ein paar der kleineren Unannehmlichkeiten des Lebens zu sehen – das Unbehagen, zu lange stillsitzen zu müssen, Langeweile, Sorgen –, und unsere fast pausenlose Aktivität, um sie zu bekämpfen: Essen, Körperhaltung verändern, Fernseher einschalten, zum Telefon greifen. Bemerken Sie das Wohlgefühl in der momentanen Erleichterung; bemerken Sie, wie auch dies vorbeigeht.
Zwischenmenschliches Leiden
Zwischenmenschliches Leiden ist das Leiden, das aus unseren Beziehungen zu anderen Menschen herrührt. Es ist eine weitläufige Untergruppe des seelischen Leidens. Stress mit Familienmitgliedern, Arbeitskollegen und Freunden ist zwischenmenschliches Leiden. Einsamkeit und Isolation gehören ebenfalls zum zwischenmenschlichen Leiden. Jeder von uns erlebt regelmäßig zwischenmenschliches Leiden. Es kann hilfreich sein zu erkennen, wie diese Dynamik abläuft, und zu wissen, dass sie als Konstrukte des sensiblen Herz-Geistes entstehen.
Eine Großteil unserer Emotionen, der schmerzhaften und angenehmen, entsteht im Zusammenhang mit anderen Menschen. Man braucht nur ein Buch über Sozialpsychologie, Soziologie oder Geschichte aufzuschlagen – oder irgendeinen Roman –, und man findet zahllose Beispiele zwischenmenschlichen Leidens, in der Intimsphäre und in der Öffentlichkeit. Probleme in Ehe und Familie sind zwischenmenschliches Leiden, ebenso wie Probleme mit Kollegen am Arbeitsplatz, romantische Techtelmechtel oder gerichtliche oder politische Auseinandersetzungen. Der Krieg und sein Herzblut, die militärische Ehre – vom Märtyrertum des Terroristen bis zum empfindlichen Stolz des Unteroffiziers –, ist durchzogen von zwischenmenschlichem Leiden. Schmerzhafter Zorn und die Angst vor Liebesentzug sind zwischenmenschliches Leiden. Soziales Unbehagen, Eifersucht, Neid und der Schmerz, andere zu verurteilen – oder von ihnen verurteilt zu werden –, all das ist zwischenmenschliches Leiden.
Wir erleben diese Formen des Leidens – oder irgendeines anderen Leidens – nicht, weil wir böse, krank oder wertlos wären. Wir erleben zwischenmenschliches Leiden deshalb, weil wir prinzipiell Beziehungswesen sind: Unser Geist will fassen und festhalten, während das soziale Leben, das uns berührt, voller unkontrollierbarer Veränderungen ist. Das natürliche Resultat solcher Bedingungen ist Leiden; Schuld- oder Schamgefühle wegen dieser Leidens-Tatsache sind fehl am Platze und trüben nur unseren Blick. Und wenn wir untersuchen, wie wir glücklicher sein können, mitfühlender, klüger, vielleicht sogar wirklich frei, dann müssen wir die Dinge so klar sehen wie möglich.
Biologisches, seelisches und zwischenmenschliches Leiden sind gründlich miteinander verflochten. Welches Leiden wir erleben, hängt nicht direkt von den Umständen ab, sondern wie wir auf die Umstände reagieren. Ich zum Beispiel wasche gerne Geschirr. Es befriedigt mich – meine Arbeit hat konkrete, sichtbare Ergebnisse. Aber manchmal sträube ich mich. Es ist persönliches Leiden, wenn ich mich sträube, weil ich lieber lesen würde. Es ist zwischenmenschliches Leiden, wenn ich mich wütend sträube, weil ich das Gefühl habe, ausgenutzt und für das, was ich leiste, nicht honoriert zu werden. Ein weiteres Beispiel: Sich seines Körpers zu schämen fühlt sich sehr persönlich an, aber es ist ganz eng mit unseren Vorstellungen verknüpft, wie andere uns wohl sehen. Wir fühlen uns vielleicht körperlich unwohl, weil wir zu dick oder zu mager sind, und das ist persönliches Leiden. Das emotionale Unbehagen, das aufkommt, wenn wir daran denken, was andere Leute über unsere Figur denken, ist zwischenmenschliches Leiden. Ich erinnere mich, wie meine Frau bei sich einmal eine kleine Läsion entdeckte. Als sie sich wegen der möglichen medizinischen Folgen, Schmerzen oder Behinderungen Sorgen machte, war das persönliches Leiden. Als ihre Besorgnis sich dann plötzlich um die Möglichkeit einer entstellenden Narbe drehte und ihre Wirkung auf andere, war das zwischenmenschliches Leiden. Mit Krankheit ist es genauso. Die Unannehmlichkeiten und der Schmerz, bettlägerig zu sein, verursachen persönliches Leiden. Aber es ist zwischenmenschliches Leiden, wenn es mir peinlich ist, dass mein Ehepartner mich zur Toilette begleiten muss. Krank zu sein, sich nicht gut zu fühlen und Angst vor dem Sterben zu haben ist persönliches Leiden. Sich auf dem Sterbebett zu grämen, weil man seine Lieben zurücklässt, oder Beziehungen nachzutrauern, die nicht gelebt worden sind, ist zwischenmenschliches Leiden.
Zwischenmenschliches Leiden ist eine zähe Angelegenheit. Menschen sind kompliziert, Emotionen verändern sich schneller als ein Sommergewitter, Lösungen sind immer unsicher. Wenn wir es mit Krankheit oder Verletzungen zu tun haben, nun gut, dann tun wir, was zu tun ist. Es ist vielleicht unerfreulich, und die richtige Vorgehensweise ist vielleicht nicht immer klar, aber normalerweise ist es nicht so kompliziert und schwer zu verstehen wie der Schmerz aus Beziehungen. Als bei meinem ältesten Sohn, Zed, Krebs festgestellt wurde, gab es viele Momente, in denen seine körperlichen Schmerzen und sogar seine Angst vor dem Tod zurücktraten hinter seiner Anteilnahme am Kummer und der Traurigkeit seiner Mutter, meiner Frau. Gleichzeitig kam unser Schmerz aus der Sorge um Zeds Leiden und der Möglichkeit, ihn zu verlieren. In diesem Moment waren wir drei ein intim verzahntes System gegenseitiger Beklemmung.
Wenn menschliche Systeme größer werden, wird aus dem zwischenmenschlichen Leiden soziales Leiden. Zum Beispiel ist der Schmerz einer Schusswunde persönliches biologisches Leiden; die Angst vor dem Tod ist persönliches seelisches Leiden. Der Schmerz des Hasses gegen den Menschen, der auf Sie geschossen hat, ist zwischenmenschliches Leiden. Der Schmerz des Hasses gegen das Land oder die ethnische Gruppe, der der Täter angehört, ist soziales Leiden. Soziales Leiden ist die systemische Manifestation zwischenmenschlichen Leidens, genauso wie zwischenmenschliches Leiden die systemische Manifestation persönlichen Leidens ist.
Einsamkeit ist eine fundamentale Form zwischenmenschlichen Leidens. Sie ist die zwischenmenschliche Manifestation unserer Grundangst vor der Leere und dem Tod. Sie tritt in persönlicher wie auch sozialer Form auf und ist erschreckend weit verbreitet. In unserer persönlichen Einsamkeit fehlt uns ein vertrautes Gegenüber; in sozialer Einsamkeit fehlt uns die Integration in einer Gemeinschaft. Wir versuchen, das Loch der Einsamkeit mit Essen, Autos, Unterhaltung und Drogen zu stopfen. Wir verbrauchen, neben riesigen Mengen an Benzin und anderen Ressourcen, enorme Telefon- und Internet-Kapazitäten einfach dafür, sinnerfüllten Kontakt zu anderen herzustellen. In dieser Mischung lösen sich biologisches, seelisches und zwischenmenschliches Leiden gegenseitig aus, und jedes kann zu Verhalten führen, das unseren Kummer verschärft und verlängert.
Menschen in reichen Ländern – getrieben von Einsamkeit und dem Hunger nach Genuss – setzen eine Kaskade von anderen Formen des Leidens in Gang. In ihrer Suche nach Tröstungen saugen sie die Ressourcen der Welt auf, indem sie verreisen und exotische Nahrungsmittel, arbeitsintensive Produkte und unersetzliche Rohstoffe importieren. In den Ländern, die durch den Konsum dieser mächtigen, hungrigen Menschen geplündert werden, verschärft sich durch die massiven sozio-ökonomischen Umwälzungen, die mit ökonomischer Abhängigkeit einhergehen, das biologische Leiden von Unterernährung oder Seuchen. Wenn hungernde Völker kommunizieren, beruht ihre Gemeinsamkeit auf dem Mitgefühl füreinander, aber – oft – auch darauf, gemeinsam die dominanten Nationen zum Feind zu haben. Der Schmerz, den dieser Hass erzeugt, ist sowohl auf den Gesichtern der Kämpfer als auch ihrer Opfer zu sehen.
Währenddessen treten in den Ländern, wo die Macht angesiedelt ist, zum Schmerz von Einsamkeit und täglichem Stress die Belastungen hinzu, seinen Lebensstil verteidigen und die hassen zu müssen, die ihn eventuell attackieren wollen. Vielleicht geht irgendwo in einer Kleinstadt wegen der zusätzlichen Belastungen eine Ehe in die Brüche, und das Paar erlebt das tiefe zwischenmenschliche Leiden einer Scheidung. Unterdessen wird auf der nationalen Ebene zugunsten militärischer Maßnahmen der Etat umgeschichtet, und Millionen von Menschen verlieren ihre medizinische Absicherung, was das biologische Leiden erhöht. Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wird ebenfalls das Geld gekürzt, was das seelische Leiden erhöht. Der Hass zwischen willkürlichen politischen Lagergrenzen vertieft sich, und Anspannung wird für jeden zum persönlichen Begleiter. Persönliches, zwischenmenschliches und soziales Leiden existieren in unserem persönlichen Leben nebeneinander und durchdringen das Herz der Gesellschaft, nicht weil wir böse wären, sondern weil wir Menschen sind.
Wenn Sie sich von Stress überwältigt fühlen, nehmen Sie sich einmal einen Moment Zeit und reflektieren Sie, welche Stressfaktoren sich mehr um Sachen drehen – Besitztümer, Arbeitsstelle, praktische Bedingungen – und welche mehr um Beziehungen. Können Sie zwischen beiden irgendeinen Unterschied feststellen?
Ein realistischer erster Schritt
Das Leben so direkt zu betrachten ist nicht pessimistisch; es ist realistisch. Es hilft nichts, das Problem zu ignorieren. Im Gegenteil, Ignorieren macht das Leiden unsichtbar, sichert sein Fortbestehen und lässt zu, dass es die Grundstimmung unseres Lebens bestimmt. Dies wissend, sind wir zu einer Entdeckungsreise eingeladen. Wie der Buddha es ausdrückte: „Darum sage ich, ihr Mönche, ergibt sich aus dem Leiden entweder Verzweiflung oder Hoffnung“.12 Um zu sehen, wie die Dinge wirklich sind, müssen wir Achtsamkeit kultivieren, das heißt die Fähigkeit, in jedem Moment unsere Reaktionen zu beobachten. Wir müssen auch so weit zur Ruhe kommen, dass wir bei dem bleiben können, was die Achtsamkeit beobachtet, und die emotionalen Reaktionen anschauen können, die uns in diesen vielen Stress-Kreisläufen herumjagen. Was stellen wir fest, wenn wir die Mechanik des zwischenmenschlichen Leidens klarer sehen? Können wir die Ursachen für dieses Leiden ausmachen? Wenn wir die Dinge klar sehen, können wir anfangen, unser Leben in Richtung Zufriedenheit und Freiheit neu zu orientieren. Die Ursachen des Leidens zu verstehen ist der erste Schritt in Richtung Freiheit.
8 Im Original „the human condition“, englische Entsprechung für André Malraux’ Begriff „la condition humaine“ (Anm. d. Übers.)
9 Samyutta Nikâya (=SN) 56.11, zitiert nach Schumann, a. a. O., S. 25
10 Majjhima Nikâya (=MN) 141.17, zitiert nach der deutschen Übersetzung von Karl Eugen Neumann; Verlag Beyerlein/ Steinschulte, Herrnschrot (Die Reden des Buddha. Mittlere Sammlung)
11 Dîgha Nikâya (=DN) 22.18