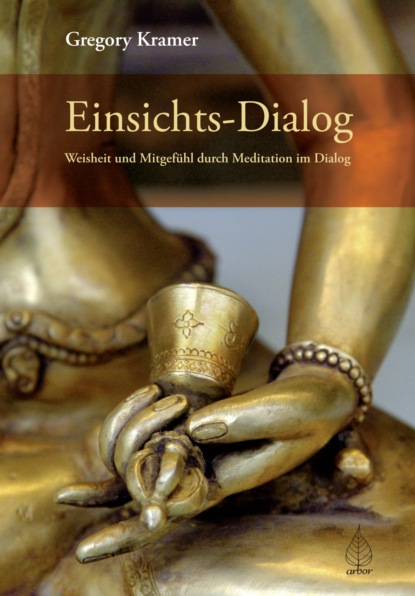- -
- 100%
- +
12 AN 6.63; Nyânatiloka: Die Lehrreden des Buddha aus der Angereihten Sammlung (Anguttara-Nikâya), Bd. III, S. 242 (Aurum Verlag, Braunschweig 1993)


Die Zweite Edle Wahrheit
Zwischenmenschlicher Hunger
Festhalten am Hunger verursacht Leiden
Wenn die Welt die Sinne berührt, entsteht schlagartig ein Selbst, und Verlangen kommt auf: Hunger nach Angenehmem, Sicherheit und nach dem Leben selbst. Das Selbst greift nach diesen Dingen und hält sie krampfhaft fest, wenn es sie bekommt. Wir halten an unseren Versuchen fest, zu bekommen, was wir wollen, und wir halten auch fest an der Angst vor dem Verlust dessen, was wir haben. Die Anspannung, die in diesem Greifenwollen steckt, ist die Wurzel des Leidens. Als Kinder lernen wir, welche zwischenmenschlichen Kontakte angenehm und unangenehm sind, und auch welche Sinneseindrücke angenehm und unangenehm sind. Wir entwickeln Vorlieben und Abneigungen. Wir entdecken, dass Wollen und Nichtwollen reziprok sind: Das Ende des Angenehmen ist unangenehm; das Ende des Unangenehmen ist angenehm. Die Brust der Mutter ist ein offensichtliches Beispiel – sie ist warm und süß, erfreulich; wird sie weggenommen, ist das eine unangenehme Erfahrung. Aber das ist noch nicht das Ende. Danach kommt der Hunger nach ihrer Rückkehr, nicht bloß der Nahrung wegen, sondern auch als Objekt des Trostes, des Glücks; grundlegender biologischer Hunger wandelt sich zu seelischem Hunger. Beide stellen „Ich“ in den Mittelpunkt des Universums. Es geht uns gut, wenn jemand lächelt oder uns lobt; unser Hunger nach derlei Aufmerksamkeit, die uns während unseres ganzen Lebens gewidmet und entzogen wird, bildet viele Nuancen. Worte der Kritik oder Ablehnung erleben wir als schmerzhaft; es wird wichtig, solche Kontakte zu meiden. Aus solchen konditionierten Hungergefühlen erwachsen unsere subtilsten Sehnsüchte nach Vertrautheit, Angenommen-Werden und Gemeinschaft. Klar benennbare, aber auch namenlose Sehnsüchte wirken in unserem Leben; wir können nur einen Bruchteil von ihnen kennen.
Zwischenmenschlicher Schmerz und zwischenmenschliche Freude sind eindringliche Konditionierungen. Als Kind wurde ich gelobt, wenn ich meine Suppe aufaß; ich lernte, für ein Lob zu funktionieren, auch wenn ich satt war, weil ich nach dem Lächeln und den Worten hungrig war, die ich die Male vorher genossen hatte. Die Kinder um mich herum wollten gelobt werden dafür, dass sie den Ball weit geschlagen hatten, am schönsten angezogen oder gut in der Schule waren. Aber wir sind alle verschieden. Die Sehnsucht meines Vaters richtete sich nicht auf öffentliche Anerkennung, sondern auf private Liebe. Lange nachdem meine Mutter gestorben war, hungerte er immer noch nach Zweisamkeit, die ihm eine uralte Einsamkeit, die in seinem Leben immer wieder auftrat, zumindest zeitweilig etwas erleichtern sollte. Die Ursprünge seines Hungers waren jedoch unter den Schichten von nahezu einem Jahrhundert gelebten Lebens begraben. Die Hungergefühle meiner Familie, wie alle unsere Hungergefühle, bildeten ein Selbst, das sich im Zusammenfluss von Sinneseindrücken, angenehmen und unangenehmen Gefühlen und konditionierten emotionalen Gewohnheiten bildete.
Das Bindeglied zwischen Hunger und Leiden heißt Greifenwollen. Wenn wir nicht bekommen können, was wir wollen, bleibt die Anspannung des unbefriedigten Hungers bestehen. Wir klammern uns an die Bilder und Gefühle, die mit dem, was wir suchen, zusammenhängen. Wir lechzen nach Kaffee und haben ein Bild im Kopf: Wir sehen, halten sogar die Kaffeetasse, riechen das Aroma und sehnen uns nach den Gefühlen, die mit dieser idealisierten Befriedigung zusammenhängen. Solange wir an diesem Bild und dem Habenwollen, das darin steckt, festhalten, bleiben wir unbefriedigt. Im zwischenmenschlichen Bereich ist es ähnlich: Wir spüren vielleicht ein intensives Verlangen, mit einem geliebten Menschen zusammen zu sein. Wir stellen uns diesen Menschen vor, hören seine oder ihre Stimme und tragen ihn oder sie in unseren Gedanken, bis wir zusammen sein können. In beiden Fällen klammert sich der Geist an seinen Wunsch, ist besessen davon. Wenn wir an dem Gedanken an jemanden festhalten, den wir nicht mögen, ist die fundamentale Dynamik dieselbe. Das Denken ergreift das Bild des betreffenden Menschen und wird zu Aversion oder sogar Wut aufgestachelt. Ob wir nun mögen oder nicht mögen, wir sind besessen.
Um Leiden zu verstehen, müssen wir uns dieses krampfhafte Festhalten ganz genau anschauen. Wenn wir etwas Weiches berühren, ist der Geist erfreut, hält sich an dem Genuss fest und möchte, dass er bestehen bleibt. Aufgrund der Gewissheit, dass das angenehme Erlebnis zu Ende gehen wird, sind wir angespannt; wenn es endet, wollen wir es wiederhaben. Wenn wir uns an etwas Scharfem schneiden, spüren wir sofort körperlichen Schmerz, und das Denken fixiert sich auf den Wunsch, dass dieser Schmerz aufhören soll. An diesem Festhalten ist auch das Gefühl eines Selbst beteiligt, wie wir noch sehen werden. Hunger und krampfhaftes Festhalten halten sich gegenseitig aufrecht, während die Freuden und Schmerzen kommen und gehen.
Zwischenmenschlich ist die Dynamik dieselbe. Wir sehen die Gestalt eines anderen Menschen; wenn wir mit diesem Menschen Angenehmes verbinden, entsteht eine konditionierte Befriedigung. An dieser Befriedigung halten wir fest. Aber im zwischenmenschlichen Erleben hat das Festhalten mehrere Ebenen und ist deshalb eine besondere Herausforderung. Nicht nur genießen wir die angenehmen Empfindungen durch diesen Menschen, wir finden in ihm oder ihr in vielerlei Hinsicht auch momentane Linderung für hartnäckige Hungergefühle: Du bringst mir Anregung und Glücksgefühle, du machst, dass ich gesehen werde, du bist der Mensch, der mein Gefühl, wertlos zu sein, aufhebt. Während wir uns entwickeln, ist es unvermeidlich, dass wir solche Befriedigungen suchen und festhalten; sie sagen uns, dass wir leben und in Sicherheit sind. Die Hungergefühle nisten sich ein, indem wir uns innerlich festklammern an der tiefverwurzelten Idee eines Selbst – desjenigen, was befriedigt, anerkannt und beschützt werden muss – und an den Gefühlen dieses Ichs. Gleichzeitig klammern wir uns äußerlich an die andere Person. Dieses Festklammern ist nicht nur das Ergebnis des aktuellen Moments von Freude und Schmerz; sein Entstehen ist auch konditioniert durch alle Momente von Freude und Schmerz in der Vergangenheit.
Dass wir uns an dem festklammern, was angenehm ist, ist leicht zu sehen; aber es ist unbedingt notwendig, zu verstehen, dass wir uns auch an schmerzhaften Gedanken und Emotionen festklammern. Auf der ganzen Welt – Balkan, Naher Osten, Afrika – gibt es Völker, die immensen gegenseitigen Hass hegen. Wenn ein Einzelner in sich das Bild eines gehassten anderen hegt – Araber, Amerikaner, Ausländer –, hält das Denken an diesem Bild fest, obwohl dieser Hass intensiven Schmerz verursacht. Direkt vor der eigenen Haustür ist es der Ärger über einen Nachbarn, Kollegen oder Verwandten, der das festklammernde Denken etabliert, und wir halten an unseren großen und kleinen Verletzungen fest. Dieses Festklammern – ob im Hass oder im Begehren – erzeugt Anspannung, die zur Basis für Unzufriedenheit und Schmerz wird. Aus solchem Festklammern entspringen Handlungen, die den Schmerz beenden und Befriedigung bringen sollen. Wir verurteilen, verletzen den verhassten „anderen“, töten ihn sogar.
Ob nun das Ergebnis von Karma, DNS oder starken neuronalen Verschaltungen, dieses Greifen und Klammern wurzelt in einer Geschichte, die unvorstellbar subtil ist. Weil Geist und Körper ein untrennbar Ganzes sind, manifestiert sich dieser schmerzhafte und aufgewühlte Zustand des Greifenwollens in Körper und Geist. Die Begegnung mit einem anderen Menschen ist eine besonders eindringliche Form des Kontakts und kann zu mächtigen, subtilen und komplexen Gefühlen führen. Aus diesen Eindrücken entsteht der Drang zu greifen, etwas Zähes im Herzen und Denken, das in jedes Zusammensein eine gewisse Beunruhigung bringt und Trennung schmerzhaft macht.
Wenn Sie das nächste Mal in einer ihrer Beziehungen Leiden bemerken, prüfen Sie, ob Sie das Greifenwollen darin erkennen. Halten Sie an einem Bild, dem Wunsch nach Kontrolle, einer Hoffnung oder einer Angst fest? Wenn Sie es bemerken, verändert sich dadurch der Schmerz oder das Greifenwollen?
Drei Arten elementaren Hungers
Als der Buddha den Mechanismus dieser Zyklen von Schmerz und Zwang auslotete, erkannte er als ihre Quelle drei miteinander verbundene Arten des Hungers. Er sagte:
Dies, Mönche, ist die Edle Wahrheit vom Ursprung des Leidens: Es ist der Wiedergeburt bewirkende, mit Freude und Vergnügen verbundene Hunger (tanhâ), der mal hier, mal dort Gefallen findet, nämlich: der Hunger nach Lust, der Hunger nach Werden, der Hunger nach Vernichtung.13
Als ich zum ersten Mal auf diese Aussage stieß, verstand ich sofort, wie der Hunger nach sinnlicher Lust und die implizite Aversion gegen Schmerz zu allen möglichen Frustrationen und Sorgen führen kann. Den Hunger nach Werden, nach Sein verstand ich als körperlichen Überlebenstrieb, aber da normalerweise mein körperliches Überleben nicht direkt gefährdet war, fragte ich mich, ob diese Lehraussage auch für jeden konkreten Moment des Lebens etwas zu bedeuten hatte. Der Drang nach Vernichtung, nach Nicht-Sein war mir ein völliges Rätsel, abstrakt und schleierhaft. Ich glaubte schon, dass er für mein Leben irgendwie relevant war, aber ich fragte mich, ob ich ihn jemals verstehen würde. Nachdem ich ein bisschen mehr studiert hatte, sah ich im Hunger nach Nicht-Sein den Drang, diesem schmerzhaften Leben zu entfliehen – den Selbstmord-Gedanken; obwohl ich wiederum nicht wusste, was das mit meinem Leben zu tun hatte.
Als ich zu verstehen begann, dass Leiden das zwischenmenschliche Leiden beinhaltet, und den Ursprung dieses Leidens im zwischenmenschlichen Hunger erblickte, wurden die Lehraussagen des Buddha für mich plötzlich lebendig. Und als ich sah, wie diese drei Arten des Hungers im zwischenmenschlichen Bereich wirksam waren, vertiefte sich auch mein Verständnis ihrer persönlichen Dimension. Ich begann das Lechzen nach zwischenmenschlicher Befriedigung als Drang nach angenehmer Anregung durch andere Menschen zu verstehen, aber auch als Angst vor Einsamkeit, die durch diesen Lustgewinn oft übertüncht wird. Ich sah, dass der Hunger nach Werden auch der Hunger war, in einer Beziehung „da zu sein“ – das heißt, der Hunger danach, gesehen zu werden, und seine Kehrseite: die Angst, unsichtbar zu sein. Der Hunger nach Nicht-Sein, begann ich zu verstehen, war nicht nur der Drang, diesem verrückten und schmerzhaften Leben zu entfliehen, sondern auch der Drang, dem Dasein in einer Beziehung zu entfliehen. In diesem Drang, so sah ich, steckt die Angst vor dem Gesehen-Werden, die Angst vor Nähe14.
Allmählich verstand ich diese Arten des Hungers fast als Naturgewalten, die mich in Verwirrung und Stress gefangen hielten, weil ich von ihrem Wirken gar keine Ahnung hatte. Ich ahnte, dass unter dieser Düsternis schon immer Klarheit und Ruhe existiert hatten, auch wenn ich nicht wusste, wie ich dazu Zugang finden konnte. Es schien, als hätte jedes dieser drei Hungergefühle in meinem Herzen irgendwie ein Plätzchen reserviert, noch bevor elterliche Konditionierung oder Kognition an meiner ursprünglich strahlenden Bewusstheit herumdokterten.
Wie das Beziehungs-Selbst sich bildet
Ein Schlüsselelement in unseren konditionierten Reaktionsmustern – vielleicht das stärkste – ist das Gefühl eines Selbst oder Ich. Nach der Geburt hängt unser Überleben von anderen Menschen ab. Wir treten in eine Welt voller Empfindungen ein: Berührung mit harten und weichen, warmen und kalten Gegenständen. Reflexartig zieht es uns zu den Empfindungen, die wir angenehm finden, und wir wenden uns ab von denen, die wir unangenehm finden. Wie alle Tiere lernen wir. Wir lernen, wo es weich ist, und lernen, uns dort einzukuscheln; wir lernen, uns von lauten Geräuschen fernzuhalten. Wir suchen die Wärme und Fürsorge der Brust und weinen danach, verkrampft und um unser Leben schreiend. Von Wärme und Milch gestillt, entspannen wir uns. All das gehört dazu, wenn man als sensibles Wesen in eine anregende und wechselhafte Umwelt hineingeboren wird.
Mit drei Lebensmonaten in diesem Körper fangen wir an zu unterscheiden, was „ich“ ist und was nicht. Wir stellen fest, dass dieses Nicht-Ich reagiert. Die Brust ist nicht nur weich, sie wird auch dargeboten. Unser Beziehungsleben hat begonnen. Wir gehen daran, kennenzulernen und kennengelernt zu werden; das soziale Lächeln beginnt. „Halloooo“, sagt der neue Papa. Augen begegnen sich. Der Vater lächelt und das Kind lächelt bei diesem Erkennen, sein ganzer Körper dehnt sich wie ein grinsender Luftballon. Kontakt! Geschafft.
Dieser Kontakt wird eine Schlüsselerfahrung, während eine Flutwelle des Lernens anrollt. Unser Gehirn bildet fast zwei Millionen neue Synapsen pro Stunde. Das Gedächtnis bildet Verbindungen zwischen reiner Empfindung und menschlichen Interaktionen. In seinen Publikationen zur zwischenmenschlichen Neurobiologie berichtet Daniel Siegel über Forschungsergebnisse, wie unser Gehirn durch die Interaktion mit anderen konfiguriert wird.15 Wir lernen, uns bei bestimmten Menschen sicher und geborgen zu fühlen und werden ihnen gegenüber anhänglich, lächeln, gurren und wollen gefallen. Wir werden Fremden gegenüber misstrauisch und verkrampfen uns, wenn wir wütende Stimmen hören. Diese Muster helfen uns, die nötige Fürsorge zu bekommen und Gefahren zu meiden. Zusammen mit ihnen entsteht das Gefühl eines „Ich“. Um die Spannungen durch sensorischen und beziehungshaften Kontakt herum gruppiert und neugruppiert sich ein vorläufiges „Selbst“, indem wir angenehme Gefühle ersehnen und unangenehme wegschieben. Mit zwei Jahren haben wir das überaus zweischneidige Schwert eines eigenständigen Selbstgefühls entwickelt.
Wie es für meine Mutter und meinen Vater war, war es auch für mich, und so ist es auch für meine Söhne. Wir haben alle ein Selbst entwickelt, das Konstrukt einer Sichtweise, die einen emotionalen Kern unseres Lebens stützt. Wenn dieses Selbstgefühl einmal ausgebrütet ist, wird das Konstrukt von jeder Empfindung weiter genährt. Es gibt nicht mehr einfach Sehen, sondern „ich sehe“. Mein Sohn Jared verspürt nicht einfach Hunger, er spürt „ich habe Hunger“. Von großer Tragweite für unser künftiges Glück und Leid ist, dass es nicht einfach den Anblick und die Geräusche von Leuten gibt: Da bist du, unabhängig von mir; da bin ich, unabhängig von dir. Wo es voneinander unabhängige Ichs und Dus gibt, gibt es Getrenntheit und Unterschiedlichkeit, und diese werden zur Grundlage von Beziehungen.
Wenn wir älter werden, beziehen wir uns nicht nur auf einzelne Menschen, sondern allgemein auf unsere Altersgenossen und unsere Kultur insgesamt. In der Adoleszenz konstruiert dieses sich bildende Selbst durch Imitation und Vergleich unser soziales Selbst. Mit fünfzehn lernte mein Sohn Max die Normen des Clans, die Regeln sozialer Begegnung. „Was sieht gut aus? Wie kann ich mithalten? Welches Verhalten wird mit Freundschaft und Lob belohnt? Welches führt zu Verurteilung und Ablehnung?“ Dieses Lernen wird bis ins Erwachsenendasein fortgesetzt; mit vierundzwanzig fragte mein Sohn Zed Sachen wie: „Wie kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen?“ - „Wie gewinne ich einen Partner?“ - „Wie verschaffe ich mir Respekt?“ Unser Selbstgefühl wird verstärkt, während wir mit dem Gefühl klarzukommen versuchen, ein klar abgegrenztes, in eine Gemeinschaft eingebettetes Individuum zu sein, das nach körperlichem und sozialem Überleben und Glück strebt. Das Gefühl der Getrenntheit und Unterschiedlichkeit wird vollständig verdinglicht.
Getrenntheit bezeichnet das Gefühl von einem Selbst, das von anderen Wesen verschieden ist. Unterschiedlichkeit bezeichnet die spezifischen Unterscheidungsmerkmale jeweiliger Individuen sowie die Identifikation mit diesen Unterschieden. Getrenntheit und Unterschiedlichkeit sind beides konstruierte Sichtweisen, wobei Getrenntheit die fundamentalere ist.
Das Gefühl eines separaten Selbst hat seine Wurzeln in der grundlegenden Aufteilung der Erfahrung in ein Selbst und das, was das Selbst erlebt. Beim Sehen erschaffen wir sofort die Erfahrung „ich sehe.“ Diese Empfindung ist Teil der Wahrnehmung „ich sehe diesen Gegenstand“; der Moment wird gebildet aus dem Subjekt und dem Objekt, dem Seher und dem Gesehenen. Werden Empfindungen in der Hand bewusst, ist da das Gefühl „meine Hand“. Wenn die Hand etwas berührt, ist da die Erfahrung „ich fühle.“ Wenn wir den Gegenstand oder seine Beschaffenheit identifizieren, vervollständigen wir den Satz zu: „Ich fühle etwas.“ Was ich fühle, ist von mir getrennt. Wenn ich einem anderen Menschen begegne, erlebe ich dieselbe Spaltung: Ich sehe dich, oder ich berühre dich. In dem Maße, wie wir diese Unterscheidung vollständig verkörpern – das heißt, wir leben die Subjekt-Objekt-Spaltung schließlich als die Wahrheit statt nur als eine Art und Weise, der schlichten Sinneserfahrung eine Bedeutung zu geben –, wird die Getrenntheit für uns real. Ob unsere Kultur nun das Gefühl in uns nährt, dass dieses Selbst in eine größere Gesellschaft eingebettet ist, oder nicht – immer erzeugt jeder Moment des zwischenmenschlichen Kontakts subtile Gefühle privater Autonomie. Das ist universell und keineswegs schlecht. Wenn wir aber diese Identifikation nicht erkennen, bereiten wir den Boden für Einsamkeit und andere Formen der Seelenqual.
Dieses Gefühl der Getrenntheit bildet die Grundlage von Vorstellungen der Unterschiedlichkeit. Gibt es erst einmal ein Gefühl von dir und mir, fängt das Vergleichen und Konkurrieren an – und jetzt legt das zwischenmenschliche Konstruktionsteam erst richtig los! Wenn wir einmal unsere Getrenntheit von anderen „be-griffen“ haben, legen wir Wert auf Unterschiede bei Geschlecht, Alter, Hautfarbe und schließlich Reichtum, Nationalität, Macht und Status. Auf der Basis der Unterschiedlichkeit bildet sich eine Identität. Aus Gefühlen der Gleichheit wird leicht Geborgenheit in und Identifikation mit einer größeren Gruppe, wie man am Beispiel von Auswanderer-Gemeinden auf der ganzen Welt sehen kann. Auf der Grundlage der Unterschiedlichkeit suchen wir die sozialen Belohnungen von Lob und Anerkennung. Dies zeigt sich in der Form von Hierarchie- und Statusdenken mit seiner stillschweigenden Unterscheidung des „besser als“. Solche Belohnungen verfeinern das Gefühl dafür, „wer man ist“, und stärken durch Identifikation mit Mitgliedern unserer Gruppe gute Selbstgefühle. Zum Beispiel bekommt man zu hören: „Als Mitglied dieser Kirchengemeinde fühle ich mich zufrieden und geborgen; hier sind lauter gute Menschen.“ Die Kehrseite der Sache ist, dass wir soziale Fehlschläge oder Bestrafungen meiden. Vorwürfe und Ablehnung kommen auf, indem wir Menschen außerhalb unserer Gruppe als noch weit mehr „anders“ einstufen, als weit verschiedener von uns, als sie den Sinnen tatsächlich erscheinen. Feinde werden dämonisiert, ihre „Andersartigkeit“ wird über das tatsächliche Maß hinaus übertrieben, wodurch ihr Status zementiert und gleichzeitig die eigene Gemeinschaft gefestigt wird.
Das Selbst, das aus diesen Vergleichen und Abstimmungsprozessen hervorgeht, fühlt sich unterlegen, überlegen, mit Verbündeten alliiert, gegen Feinde gewappnet und in einen Strudel von Vorlieben und Abneigungen hineingezogen. Meinungen, Rollen, soziale Segmentierung, Wünsche, Ängste und Verwirrung wuchern. All diese Gefühle und Standpunkte verursachen körperliche Spannungen und emotionales Unwohlsein. Die Anspannung steigt und die eingerastete Identität wird krampfhaft festgehalten; schließlich muss „ich“ mich ja schützen, muss „ich“ die Sicherheit für „mich“ und „die Meinen“ gewährleisten, habe „ich“ ja recht und daher auch das Recht, alles zu tun, um diese Sicherheit aufrechtzuerhalten. Aus gespeicherten Ideen über körperliche Merkmale („Ich bin klein“) und beziehungshaften Dynamiken („Ich bin verletzlich“) im Lauf der Zeit automatisch aufgebaut, bilden die Konstrukte der Getrenntheit und Unterschiedlichkeit die Basis einer Weltsicht, die jeden Aspekt unseres Lebens beeinflusst. Das Selbst, separat und verschieden, ist das, was hungert und wehtut.
Stellen Sie fest, wie Sie sich selbst in Bezug auf andere Menschen oder Gruppen anderer Menschen als ähnlich oder verschieden definieren. Welche Elemente spielen dabei mit? Geschlecht? Rasse? Sexuelle Vorlieben? Politischer Standpunkt? Beruf? Einkommen? Alter? Fitness? Stellen Sie fest, ob Sie die jeweilige Unterscheidung gewohnheitsmäßig mit einem Überlegenheitsgefühl verbinden.
Wie definieren Sie sich selbst in Bezug auf Ihre Eltern, Kinder oder Geschwister?
Beobachten Sie eine Zeit lang unauffällig fremde Menschen. Achten Sie auf jedes Gefühl der Getrenntheit, das aufkommt. Finden Sie Momente, in denen Sie einfach nur sehen, oder ist da immer dieses Gefühl von „ich“ und „sie“ und der Kluft dazwischen?
Der Hunger nach Lustgewinn und der Drang, Schmerz zu vermeiden
Wir haben das reziproke Verhältnis von Lustgewinn und Schmerz bereits betrachtet: Wir suchen den Lustgewinn nicht nur wegen seines anregenden Effekts, sondern auch, um Schmerz zu vermeiden. Wir finden das Ende eines Vergnügens schmerzhaft und fürchten uns deshalb davor; wir erleben den Drang, unseren Lustgewinn zu bewahren und auszudehnen. Das Ende eines Schmerzes finden wir angenehm. Wenn wir den Hunger nach Lustgewinn in zwischenmenschlichen Begriffen verstehen wollen, müssen wir verstehen, was mit zwischenmenschlichem Lustgewinn gemeint ist. Entscheidend ist auch, den dominanten zwischenmenschlichen Schmerz zu identifizieren, vor dem wir fliehen. Wenn wir diese einfachen Fakten verstehen, wird es leicht zu sehen, wie der Hunger nach Lustgewinn in unserem Leben wirksam ist; diese Einsicht macht den Weg frei zum Aufhören dieser Hungergefühle und dem Aufdämmern von Gelassenheit und Mitgefühl.
Zwischenmenschlicher Lustgewinn sind die angenehmen Emotionen und Empfindungen, die aus zwischenmenschlichem Kontakt entstehen. Ich finde es hilfreich, dieses Vergnügen in zwei Klassen einzuteilen: altruistisch und egoistisch. Egoistischer Lustgewinn: Mir ist langweilig, also besuche ich dich, weil ich weiß, ich werde viel Spaß und Ablenkung haben; es geht hauptsächlich um mich. Altruistischer Lustgewinn: Du bist verletzt, und es macht mir Freude, dich zu pflegen; es geht hauptsächlich um Mitgefühl und Großzügigkeit. In beiden Fällen gibt es das Gefühl eines Selbst und eine Motivation zu handeln. Wir werden altruistischen Lustgewinn etwas eingehender untersuchen, wenn wir über das Aufhören dieser Hungergefühle sprechen. Zuerst untersuchen wir egoistischen Lustgewinn.
Egoistischer Lustgewinn funktioniert so, wie der Name sagt: Wir suchen Kontakt, um unseren Hunger nach vergnüglicher Anregung zu befriedigen. Diese Anregung dient zwei Zielen. Sie unterhält und begeistert uns, erfüllt uns mit Leben, Schwung, vertreibt Langeweile. Sie lenkt auch von dem Schmerz unerfüllter Sehnsüchte ab. Genauso wie der physiologische Organismus sucht auch der soziale Organismus Stimulation, und zahllose Formen zwischenmenschlichen Entertainments bezeugen dies, von Partys bis zu Chatrooms im Internet, vom Fußball bis zum Büroklatsch. Hier wirkt der normale soziale Antrieb.
Um zu verstehen, warum egoistischer zwischenmenschlicher Lustgewinn beim Vermeiden zwischenmenschlichen Schmerzes so wichtig ist, müssen wir diesen Schmerz genauer verstehen. Einsamkeit ist die zwischenmenschliche Manifestation der Angst vor der Leere, welche wiederum eine Manifestation der Angst vor dem Tod ist. Aus diesem Schmerz heraus und der Angst vor diesem Schmerz erleben wir Eifersucht, Verrat und viele Formen des Hasses und der Wut. Einsamkeit beruht auf der Perspektive des Getrenntseins, wird von Vorstellungen über Unterschiedlichkeiten verschärft und wurzelt im Hunger nach Lustgewinn. Allein zu sein gehört zu den fundamentalen menschlichen Erfahrungen; Einsamkeit nicht. Ich bin allein in diesem Körper, du in jenem – das sind Aldous Huxleys „Inseln“, von denen „jede ein Weltall für sich bildet“.16 Wir erleben Myriaden von emotionalen und energetischen Wechselbeziehungen, aber wir fühlen uns einsam, wenn wir an der Idee eines isolierten Selbst festhalten, das bis in die Kindheit und darüber hinaus zurückreicht, eines Selbst, das in Wirklichkeit jeden Moment neu aufgebaut wird. Der Hunger nach Lustgewinn wird im Kontakt mit anderen vielleicht gestillt, aber wenn das vorbei ist, kommen Einsamkeit und Traurigkeit zurück. Wann immer wir nach Lustgewinn hungern und der Hunger nicht befriedigt wird oder die Befriedigung endet, kommt Schmerz auf.