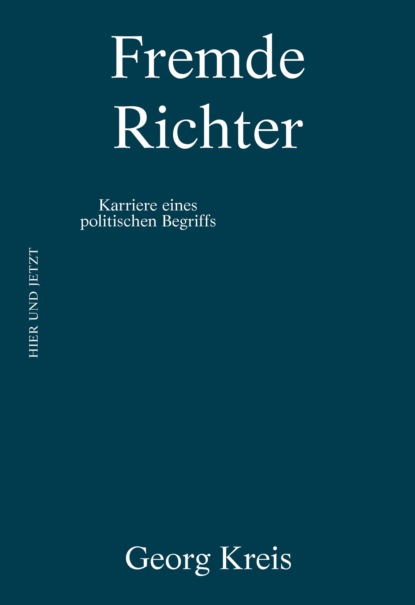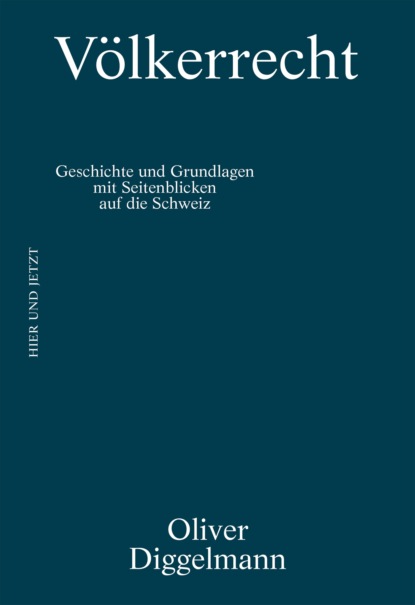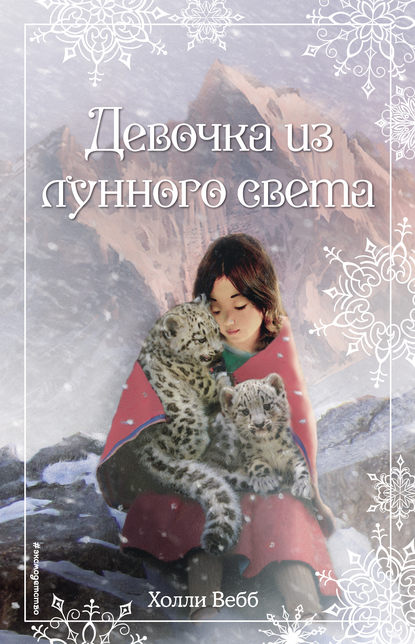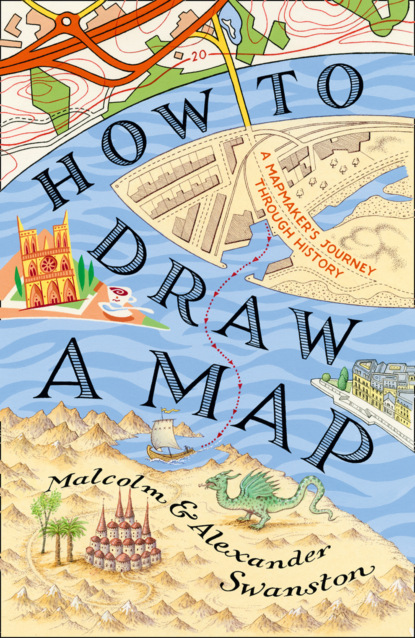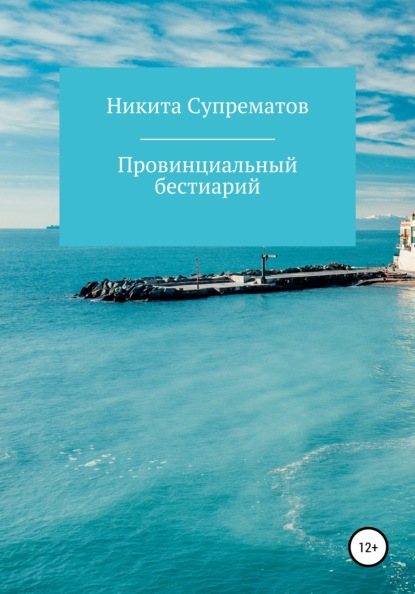- -
- 100%
- +
Nationalrat James Schwarzenbach (Rep./ZH), Führerfigur der Überfremdungsbewegung, liess es sich nicht entgehen, auf die Gefahr eines Verlusts der Souveränität hinzuweisen. Die Eindeutigkeit der Gefährdung betonend, erklärte er, er «brauche ja dieses Problem, das jetzt brennt, nicht beim Namen zu nennen», und unterstrich es dann trotzdem, nämlich die Gefahr, «dass wir uns in Zukunft dem Urteilsspruch eines fremden Gerichts beugen». Zudem war er der Meinung, dass die EMRK für ein christliches Land überflüssig sei.42 Damals stand die Befürchtung im Vordergrund, dass das fehlende Frauenstimmrecht und die noch nicht beseitigten antikatholischen Ausnahmeartikel Ausgangspunkte von Klagen in Strassburg werden könnten.
Bundesrat Willy Spühler (SP/ZH) ging 1969 in seinem Schlusswort im Nationalrat auf die Versuche ein, wie er sagte, mit dem Begriff der «fremden Richter» eine «unterschwellige Reaktion» hervorzurufen. Dabei unterstrich er den Unterschied zwischen den Verhältnissen im 13./14. Jahrhundert und den Gegebenheiten im 20. Jahrhundert. Die Vorfahren hätten sich dagegen gewehrt, dass habsburgische Richter in ihre Täler zogen und gegen den Willen der Eidgenossen dort Gericht hielten. Jetzt dagegen würde dem Schweizer Bürger mit der EMRK «bloss ein nach seinem freien Willen verfügbares zusätzliches Rechtsmittel vor internationalen Instanzen gewährt». Und indirekt Nationalrat Hofer korrigierend, bemerkte er, dass die EMRK keine supranationale Institution sei, weil der EGMR im Gebiet der Mitgliedstaaten keine für Einzelpersonen direkt verbindlichen Entscheide erlassen könne.43 Auch im Ständerat beteuerte er später, dass die Souveränität ungeschmälert erhalten bleibe: «Es gibt keinen Richter oberhalb der Bundesversammlung.»44 In diesem Schlussvotum ging er von sich aus auf den gängigen Topos ein, obwohl dieser zuvor während der ganzen Beratung gar nicht ins Spiel gebracht worden war: «Durch die Menschenrechtskonvention werden auch nicht fremde Richter ins Land gerufen, denn sie gibt dem Schweizerbürger bloss ein zusätzliches Rechtsmittel vor internationalen Instanzen in die Hand; er ist aber völlig frei, sich dieses Rekursrechtes zu bedienen oder nicht.»45
Es ist eine im engeren Sinn zufällige, im weiteren Sinn aber doch nicht zufällige Koinzidenz, dass die Bezugnahme auf die alteidgenössische Bilderwelt gerade in einem Moment wichtig wurde, da sie von Experten der Geschichte und einer weiteren Publizistik dekonstruiert wurde. Otto Marchi, Schüler des Mediävisten Marcel Beck, veröffentlichte 1971, nach Vorabdrucken ab Juni 1969 in der Presse, das Buch «Schweizer Geschichte für Ketzer», und Max Frischs «Wilhelm Tell für die Schule» erschien im gleichen Jahr.
Frühe Abwehr – zweite Runde
Als es in der zweiten Runde von 1974 um den nun beabsichtigten Beitritt zur EMRK ging, waren die «fremden Richter» wiederum sehr präsent, ja noch stärker als 1969. Der Bundesrat, der in seinem Bericht von 1968 gar nicht auf den Topos eingegangen war, hielt es jetzt für nötig, sich in seiner Botschaft von 1974 dazu zu äussern. Zum einen widersprach er explizit den Versuchen, «den alten Bündnisvertrag von 1291 heraufzubeschwören, der die Verpflichtung enthielt, nur heimische Richter anzuerkennen»; zum anderen betonte er, wie schon Masoni 1969, dass es um eine freiwillige Beteiligung an der Internationalisierung des Menschenrechtsschutzes gehe, was «keineswegs als Unterwerfung unter fremde Richter angesehen werden» könne.46
In dieser Runde äusserten sich Befürworter des EMRK-Beitritts sozusagen vorweg zur Berechtigung des Vorbehalts gegen «fremde Richter». Ständerat Raymond Broger (CVP/AI) ging gleich zu Beginn der Debatte auf diesen «Slogan» ein, um zu betonen, dass sich die heutigen Verhältnisse «sehr drastisch und wesentlich» von jenen um 1291 unterscheiden würden. «Unser Land ist nicht mehr ein weltabgelegenes Gebiet, in dem sich eine genossenschaftliche Freiheit gegenüber feudalistischer Bedrängnis halten konnte, sondern unser Land ist zwar noch ein Kleinstaat, aber ein solcher, der weltpolitisch eine eigentliche Handelsmacht bedeutet und zu überaus zahlreichen Ländern sehr intensive Beziehungen pflegt.»47
Broger mass den Strassburger Entscheiden allerdings einen zu unverbindlichen Charakter bei, wenn er sagte: «Im vorliegenden Fall kann von einem fremden Richter überhaupt nicht die Rede sein. Wir unterstellen uns auf eine beschränkte Zeit einer Pseudo-Jurisdiktion der Europäischen Kommission für Menschenrechte. Diese Kommission hat keine eigentliche richterliche Funktion. Sie beschränkt sich in Streitfällen auf die Feststellung von Tatsachen; sie strebt eine gütliche Einigung an und gibt allenfalls Empfehlungen an die Staaten ab, die ratifiziert haben, selbstverständlich Empfehlungen, die man freiwillig befolgt nach dem Grundsatz: pacta sunt servanda. […] Eine Einschränkung unserer Souveränität ist von dieser Seite her nach meiner Auffassung nicht im geringsten zu befürchten.»48
Berichterstatter Walter Renschler (SP/ZH) hielt später im anderen Rat zutreffend fest: «Ferner sind die Urteile des Gerichtshofes und die Entscheide des Ministerkomitees zwar verbindlich, aber sie haben keine kassatorische Wirkung, und sie sind nicht unmittelbar durchsetzbar.»49
Das für den konservativen Ständeherrn Broger bemerkenswerte Votum wurde in ähnlicher Weise sekundiert durch Ständerat Mathias Eggenberger (SP/SG), der ebenfalls den «wesentlichen» Unterschied von damals und heute betonte: «Jene Richter sollten uns von aussen, von einer fremden Rechtsauffassung her, aufgezwungen werden; wir entscheiden völlig autonom und frei über den Beitritt zur Konvention und damit auch zur Anerkennung des europäischen Gerichtshofes.»50 Schliesslich verstärkte Bundesrat Pierre Graber (SP/NE) indirekt das Bild der «fremden Richter», indem er den Beitrittsgegnern vorwarf, sich unter dem Banner der Ablehnung der «fremden Richter» versammelt zu haben («ses adversaires se rangeant sous la bannière de l’opposition aux juges étrangers»).51
Auch im Nationalrat kam die erste Erwähnung der «fremden Richter» von einem Befürworter des Beitritts zur Konvention. Nationalrat Claudius Alder (LdU/BL): «Der Beitritt bedeutet daher sicher keine rechtsstaatliche Revolution, sondern ist gewissermassen eine Selbstverständlichkeit. Die Bedeutung der Konvention für unseren Rechtsalltag darf daher auch nicht überschätzt werden. Die bösen Töne vom fremden Recht und den fremden Richtern, die uns mit der Konvention aufoktroyiert würden, können wir uns nur mit totaler Unkenntnis jener, die sie verbreiten, erklären, oder aber, diese Variante unterstelle ich lieber nicht, mit einem bewussten Störmanöver gegen unseren Rechtsstaat. Wir dürfen uns von diesen Tönen nicht beeindrucken lassen.»52
Diese Störtruppe hatte ihr Lager vor allem im Nationalrat. Und da taten sich insbesondere wiederum James Schwarzenbach (Rep./ZH) und zusätzlich Werner Reich (NA/ZH) hervor. Schwarzenbach erklärte in gespielter Tiefstapelei, sich zu entsinnen, «einmal gehört zu haben», der eidgenössische Bund sei entstanden, weil er keine «fremden Richter» und keine fremde Einmischung dulden wollte. Er übernahm aus der Debatte von 1969 wörtlich Hofers Formulierung, dass die Figur des «fremden Richters» in uns «tiefe Schichten des historischen Bewusstseins» aufwühle. Konkreter störten ihn aber die Individualbeschwerde und die «neuerliche Beschneidung unserer garantierten Souveränität». Im Weiteren war er der Meinung, ein Gang nach Strassburg, den er als «Gang nach Canossa» bezeichnete, würde sich erübrigen, wenn man selbst gute Richter habe: «Wenn wir uns aus Gründen der Wahrung unserer verbrieften Rechte nicht fremden Richtern unterstellen wollen, dann haben wir dafür besorgt zu sein, dass unsere Richter auch wirklich gute Richter sind und dem Staatsbürger garantieren, was ihm die Menschenrechtskonvention verspricht.»53 Und Nationalrat Reich lehnte den EGMR ab, weil er fremd und supranational sei und ihm mehr Rechte zuerkannt würden als dem eigenen Bundesgericht.54
Auf das Votum Reich eingehend, bemerkte Walter Renschler (SP/ZH) in seiner Eigenschaft als Berichterstatter: «[Es ist] völlig falsch, immer wieder mit dem emotionsgeladenen Schlagwort vom ‹fremden Richter› zu kommen. Darum geht es nun hier wirklich nicht; dieser Vergleich mit dem ‹fremden Richter› ist unzutreffend. Im Gegensatz zu den fremden Richtern zur Zeit der alten Eidgenossenschaft ersetzt die Europäische Menschenrechtskonvention unsere Rechtsordnung nicht durch fremdes Recht.»
Wie zu erwarten, wurden die wenigen Verurteilungen, die der Schweiz durch Entscheide des EGMR widerfuhren, von der politischen Rechten genutzt, um gegen die «Unterwerfung unter Strassburg» zu protestieren. 1987 reagierte die aus der Ablehnung der UNO-Mitgliedschaft von 1986 hervorgegangene AUNS auf das Strassburger Urteil im Fall F. zu einem Heiratsverbot mit dem Kommentar: «Es sind die fremden Richter in Strassburg, die bei uns sagen, was Rechtens ist.»55 1988 führte eine weitere Verurteilung der Schweiz durch «Strassburg» wegen ungenügender gerichtlicher Beurteilung einer Beschwerde gegen eine Busse von 130 Franken im Kanton Waadt (Fall Belilos) zu einer erneuten Belebung des Bilds der «fremden Richter».
Es war der Innerschweizer Ständerat Hans Danioth (CVP/ UR), der darin die Souveränität nicht nur des Landes, sondern auch der Kantone beeinträchtigt sah und darum am 6. Juni 1988 ein Postulat einreichte und sogar eine vorsorgliche Kündigung der EMRK anregte. In seiner Begründung ging der Urner Ständeherr davon aus, dass die eigene Ordnung nur schon deswegen Schutz verdiene, weil es die eigene ist. Auf Verbesserung bedachte Rechtsharmonisierung tat er ohne Überprüfung ihrer Berechtigung und Wünschbarkeit als «Nivellierung» ab: «Im ersten Bundesbrief haben die Eidgenossen geschworen, keine fremden Richter anzuerkennen. Es blieb uns fortschrittlichen Nachfahren des 20. Jahrhunderts vorbehalten, diesen weisen Grundsatz über Bord zu werfen. Wir sind drauf und dran, durch eine argwürdige Rechtsprechung seitens eines ausserhalb unseres Landes agierenden Gerichtes die traditionell gewachsene und im Rahmen von Verfassung und Gesetz weiterentwickelte innere Ordnung unseres Justizwesens zugunsten einer nivellierenden Einheitstheorie, welche auf unser Land keine Rücksicht nimmt, preisgeben zu müssen.»56
Ständeratskollege René Rhinow (FDP/BL), Ordinarius für Staatsrecht der Universität Basel, widersprach dem aus Uri erhobenen Anspruch auf kantonale Souveränität und verwies auf die garantierten Grundrechte in der für die ganze Schweiz geltenden Bundesverfassung. Zu den «fremden Richtern» bemerkte er: «Es wird mit Strassburg nicht Macht eines arroganten Herrschers über ein unterjochtes Volk ausgeübt. Wir Schweizer haben personell Anteil am Richteramt wie jeder andere Signatarstaat der Konvention.»57 Das wiederum wollte Parteikollege Ernst Rüesch (FDP/SG) nicht unkommentiert stehen lassen. Der Einfluss der Schweiz sei in Strassburg trotz der Vertretung «ausserordentlich» gering; eine grosse Mehrheit ausländischer Richter würde über die Schweiz richten.58
Bemerkenswert war und ist, dass Zeitungen, die eigentlich dafür disponiert waren, sich zur Vox populi zu machen, dieses Intermezzo nicht publizistisch auswerteten.59 Die «Weltwoche» stellte denn auch fest, dass der «Proteststurm von nationalistischer Seite» beinahe ausgeblieben und Danioth mit seiner Polemik gegen die EMRK ein «einsamer Rufer in der Wüste» geblieben sei.60
Der Topos der «fremden Richter» gehörte, auch ohne in akuten Kontroversen als schlagendes Argument benötigt zu werden, zu den Grundelementen des helvetischen Diskurses. Der Historiker und frühere Bundesrat Georges-André Chevallaz verkündete im Kontext des 700-Jahr-Jubiläums von 1991, bezogen auf die Formel von 1291, «l’hostilité au prince de dehors et au juge étranger» bilde neben Republikanismus und Föderalismus die dritte Konstante des schweizerischen Zusammenhalts.61 Doch erst im Kampf gegen den Beitritt zum EWR erhielt der Topos der «fremden Richter» die Bedeutung eines gängigen Schlagworts.
Wer die Formel der «fremden Richter» aufgeladen hat
Im Kampf gegen den Beitritt zum EWR erlangte der Topos der «fremden Richter» eine hohe Bedeutung, beziehungsweise: Sie wurde ihm gegeben. Die ursprüngliche Bedeutung, wie im vorangegangenen Kapitel umschrieben, spielte dabei überhaupt keine Rolle. Die «fremden Richter» wurden zur Chiffre für auswärtige Einwirkung unterschiedlicher Art, von Regulierungen durch «Brüssel» bis zur «Überschwemmung» des Landes durch fremde Arbeitskräfte und zum Lastwagentransit.
Nationalrat Christoph Blocher (SVP/ZH) nutzte seine vierte Albisgüetli-Rede vom 24. Januar 1992 zur Eröffnung seines Kampfs gegen den EWR-Beitritt und setzte dabei die später gebetsmühlenartig wiederholte Formel ein: «Haben wir 700 Jahre lang gegen ‹fremde Richter› gekämpft, haben wir uns 700 Jahre lang für eigene Richter eingesetzt, um jetzt plötzlich unsere Freiheit nicht nur gegen fremde Richter, sondern auch gegen fremdes Recht einzutauschen? So viel Verlust an Souveränität, an demokratischen Rechten, so viel Verlust an Selbstbestimmung lassen wir uns nicht gefallen!»62 Wie dargelegt, war die Inanspruchnahme eines 700-jährigen Widerstands falsch, Blocher knüpfte, was naheliegend war, an die im Vorjahr mit grossem Aufwand zelebrierten 700-Jahr-Feierlichkeiten an.63
Die «fremden Richter» waren – auch bei Blocher – bloss eine historische Figur fremder Mächte, die später in der nationalrätlichen EWR-Debatte auch als «neuzeitliche Vögte» mit Namen wie Delors, Mitterand und Kohl versehen wurden.64 Zutreffend interpretierte der deutsche Politikwissenschaftler Ralf Langejürgen, der eines der besten Bücher zur schweizerischen Europapolitik um 1990 verfasst hat, die «fremden Richter» als Teil eines breit angelegten «Widerstandsmythos», der einerseits mit dem Griff nach dem 13. Jahrhundert eine historische Kontinuitätslinie konstruierte, andererseits damit aber auch eine Parole zur Abwehr aktueller Überflutung insbesondere durch Arbeitslose zur Verfügung stellte.65
Nicht bemerkt hat Langejürgen jedoch: Der Aufruf zum Widerstand knüpfte an einen weiteren Topos an, und zwar an die gängige Losung von «Anpassung oder Widerstand» aus der Zeit der Bedrohung durch NS-Deutschland.66 Mit der Betonung des belasteten Worts der Anpassung konnte eine kooperative Haltung dem Projekt der Europäischen Gemeinschaft (EG) gegenüber diskreditiert werden. Blocher beschwor die Anpassung in der Rede vom Januar 1992 gleich zu Beginn und gleich mehrmals als Gefahr und betonte, dass sie nicht neu, sondern eben eine Wiederholung sei: «Ein weiteres Mal in der Geschichte unseres Landes ist überall von ‹Anpassung› die Rede. Anpassung sei das Gebot der Stunde. Anpassen müsse man sich an die Zeit und Umstände.»67 Anpassen woran? Bezeichnenderweise präsentierte Blocher die folgende Reihe negativer Gegebenheiten: anpassen an veränderte Drogensitten, an die stetig steigende Kriminalität, an missliche Asylpolitik – und vor allem an Europa beziehungsweise an die EG!
Entgegen der Gepflogenheit, Abstimmungskampagnen erst nach der Beratung der Vorlage durch das Parlament zu lancieren, hatte Blocher die Kampagne bereits im Januar 1992 eröffnet. Der Vertrag war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht abgeschlossen; dies sollte erst am 2. Mai 1992 der Fall sein. Die weitere Entwicklung stärkte Blochers Position. Der geplante EWR wurde zu einem Modell einseitiger Anpassung, weil der EuGH den Efta-Mitgliedern im EWR kein Ko-Entscheidungsrecht in strittigen Fragen des Europarechts zugestand und auf einer alleinigen Auslegung beharrte (Stichwort: Autonomie des Unionsrechts). Jacques Delors, Präsident der EU-Kommission, hatte bereits im Januar 1990 in seiner Jahresrede vor dem Europäischen Parlament dazu erklärt: «La codécision ne peut en effet résulter que de l’adhésion pleine et entière et donc de l’acceptation de l’ensemble du contrat de mariage.»68 Auf Antrag der Kommission wurde dies vom EuGH am 14. Dezember 1991 entschieden und am 14. April 1992 nochmals bestätigt.
Der Entscheid vom Dezember 1991 zog den Schweizern, die erwarteten, dass für den EWR ein gemeinsames EG/Efta-Gericht geschaffen würde, den Boden unter den Füssen weg. Der EG-freundliche Brüsseler Korrespondent Jörg Thalmann meinte, die «fremden Richter» würden «fremden». Er zeigte zwar Verständnis dafür, dass die EG eine einheitliche Rechtsprechung als «Kitt» für den Zusammenhalt brauche, und er erblicke in ihr (anders als die später gepflegten Bilder vom Monster) ein noch junges und schwaches Gebilde. Die EG müsse aber nicht nur sich selbst dienen, sie müsse heute weit über ihre Grenzen hinaus eine Ordnung gestalten und darum in den Aussenbeziehungen auch Kompromisse eingehen und ein «besonderes Nahverhältnis» aufbauen.69
Die auf schweizerischer Seite erwartete Gleichstellung der Partner im EWR-Vertrag und ein entsprechendes Mitentscheidungsrecht in strittigen Auslegungsfragen erwiesen sich als Illusion. Auf Delors’ Erklärung vom Januar 1990 gemünzt, erlaubte sich der schweizerische Aussenminister Wochen später in der Presse die wenig diplomatische Bemerkung, man sei es in der Schweiz nicht gewohnt, mit Leuten zu tun zu haben, die alle Jahre ihre Meinung änderten.70 Was blieb, war die Aussicht, in einem «Gemischten Ausschuss» bei geplanten EU-Gesetzen, die auch den EWR betrafen, im sogenannten «Decision Shaping» seine Meinung abzugeben. Ob die ernüchternde Erfahrung in der Öffentlichkeit zu einer Reaktivierung der «fremden Richter» führte, muss offenbleiben. Jedenfalls hätte die EWR-Mitgliedschaft bei strittiger Auslegung des betroffenen EU-Rechts die «Auslieferung» der Schweiz an das fremde Gericht bedeutet.

Die Bundesräte Adolf Ogi und Arnold Koller in der EWR-Debatte vom 20. November 1992 im Bundesbriefarchiv, vor dem Wandbild des Rütlischwurs. Die Abwehr gegen aussen war mit der Ablehnung auch der eigenen Regierung verknüpft.
Insofern als man dem Parlament eine meinungsbildende Funktion zuschreiben möchte, muss man sagen, dass es in diesem Fall spät, ja zu spät agierte. Ausgangspunkt der Beratungen war die bundesrätliche Botschaft vom Mai 1992. Darin musste der Bundesrat darlegen, dass der EuGH die Auslegungshoheit vor «nationalen Richtern» habe, er hütete sich aber, auf den Topos der «fremden Richter» einzugehen.71
Dieser Topos umfasste weit mehr als einzig die Richterfrage. An ihm haftete die ganze Gründungsgeschichte. Ein rechtsnationaler Volksvertreter vermisste in der bundesrätlichen Botschaft nicht die Ablehnung der «fremden Richter», ihm fehlte anderes, und das wollte Hans Steffen (SD/ZH) in seinem Votum nachtragen. Er erklärte, sich «einige Gedanken» zu Fragen gemacht zu haben, die in der Botschaft des Bundesrates nicht abgehandelt seien, und begann davon zu reden, dass er als Primarschüler in der Heimatkunde die Erzählung vom Schmied von Göschenen (von Robert Schedler, 1920) gelesen habe, der um 1240 den stiebenden Steg durch die Schöllenenschlucht gebaut habe, und dass es einen Kampf zwischen den drei Alten Orten und dem dynamischen Hause Habsburg um die Herrschaft über den Gotthardweg gegeben habe.72
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.