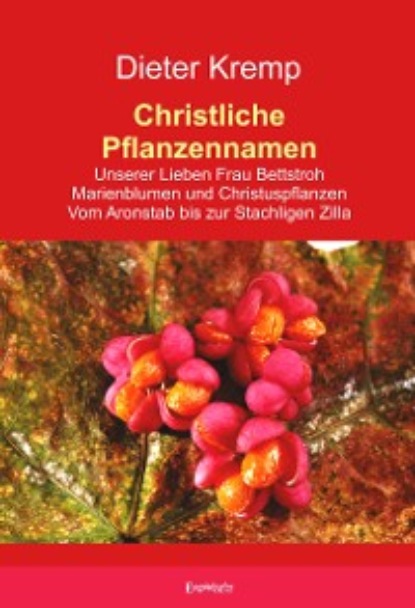- -
- 100%
- +
Lilia oder Lilie heißen seltsamerweise viele deutschstämmige Mädchen in Kasachstan. Vielleicht wollen damit ihre Eltern und Großeltern durch die Namensgebung an ihre deutsche Urheimat erinnern, als die Lilien die Modeschönheiten im deutschen Bauerngarten waren. Der Vorname kommt jetzt bei uns wieder zusammen mit Lilian und Liliane immer mehr in Mode.
Die einheimische Türkenbundlilie (Lilium maarttagon) gehört zu den unter Naturschutz stehenden Wildpflanzen. Sie kommt auf Bergwiesen in kalkhaltigem Boden vor. Ende Mai entfaltet sie ihr hellpurpurnes, reich punktiertes Blütenblattröckchen. Statt der erwarteten Lilienblüten lässt sie lauter vtürkische Turbane am 60 bis 80 cm hohen Blütenschaft lustig umherbaumeln. Diese unbekümmerten Gäste sollen natürlich den pfeilschnellen, auf der Stelle schwirrenden Nachtschwärmern den Zugang zu den Nektarrinnen im Innern der Blüten erleichtern. Deshalb ist auch der Duft aus ihnen am Abend stärker als am Tage, immer aber mit einer besonderen Note wie nach Vanille oder Zimt.
Die Weißen Lilien (Lilium candidum) sind die Lieblingsblumen der Orientalen, der Deutschen und der Romanen. Bei den Römern galt die Lilie als Zeichen der Hoffnung, im Morgenland war sie Sinnbild der Reinheit und der Unschuld. Nicht nur die „holde Jungfrau“ erhielt bei feierlichen Anlässen Lilien geschenkt, sondern Lilien wurden auch zum Zeichen der Trauer und der Treue als letzte Liebesgabe der Toten auf den Sarg gelegt. Bei den feierlichen Prozessionen an Fronleichnam tragen noch heute weißgekleidete Mädchen weiße Lilien in der Hand. In der deutschen Mythologie trägt Donar in der rechten Hand den Blitz und in der Linken das Zepter, das mit einer Lilie gekrönt ist. Während des Mittelalters wurden besonders in den Klostergärten die Lilien stolz bewundert. Die Weiße Lilie, später als Madonnenlilie kreiert, ist ein altes und weitverbreitetes Lichtsymbol; daneben gilt sie vor allem in der christlichen Kunst als Symbol der Einheit, Unschuld und Jungfräulichkeit. Auf Darstellungen Christi ist die Lilie auch ein Symbol der Gnade. Die Bibel spricht von den „Lilien auf dem Feld“ als einem Symbol der vertrauensvollen Hingabe an Gott. Die Lilie ist zudem ein uraltes Königssymbol und spielt besonders in der Heraldik eine bedeutende Rolle. Mit den Rosen zusammen wurden Lilien schon in altdeutscher Zeit oft erwähnt, und sie spielten in der Poesie unserer Dichter, besonders der Romantiker, eine wesentliche Rolle. Auch im Volkslied wurden die Lilien verewigt: „Drei Lilien, drei Lilien, die pflanzt ich auf sein Grab …“
Lilien gehören zum uralten Gartenadel. Die edlen Blüten der Lilien verleihen dem Platz, an dem sie wachsen, eine gewisse Würde. Auch in der Vase verlangen diese stolzen Adligen besondere Aufmerksamkeit und allen voran steht die Madonnenlilie – sie passen eben nicht in jede beliebige Gesellschaft. Es gibt heute hervorragende Neuzüchtungen. Die Begegnung mit diesen großblumigen, standfesten Hybriden ist ein Naturerlebnis besonderer Art. Grundregel aller Lilienkultur ist, dass sie mit den „Füßen“ kühlschattig stehen wollen, ihre Blüten aber im warmen Licht der Sonne entfalten wollen.
Die Naturformen können jahrelang ungestört in Wildstaudenpflanzenwachsen. Madonnenlilien und Hybride passen auch ins Staudenbeet. Leider werden ihre Zwiebeln hin und wieder von Wühlmäusen gefressen.
Zu den altbekannten Naturformen gehören die Goldbandlilie mit breit geöffneten, schalenförmigen Blüten, die Madonnenlilien mit schneeweißen trichterförmigen Blüten, die lebhaft gefleckten Tigerlilien, die orangeroten Feuerlilien mit offenen Kelchen und die Königslilien mit großen trichterförmigen Blüten. Im Riesenreich der Zuchtformen sind besonders die Martagon-Hybriden, die Auratum-Hybriden und die Bellingham-Hybriden zu empfehlen. Ihr starker, warmer, außerordentlich angenehmer Duft teilt sich der ganzen Umgebung mit.
In der Pflanzenheilkunde Chinas setzt man Lilien bei Vergiftungen, als stimulierende Mittel, bei Melancholie, zur Entwässerung, harntreibend, blut- und schmerzstillend ein.
In der Küche verwendet man alle Teile, getrocknet, frisch und eingefroren, hauptsächlich aber Knospen und Blüten. Je nach Sorte, schmecken sie – oder nicht – roh oder filtriert. Wer es übers Herz bringt, kann auch Taglilien für einen Blumenstrauß verwenden. Dafür werden abends dickknospige Stängel geschnitten. Allerdings müssen abgeblühte Blüten entfernt werden, denn sie werden matschig, nässen und verursachen dunkle farbige Flächen.
Madonnenlilien am Muttertag
„Diese mein frumme Mutter hat 18 Kind getragen und erzogen, hat große Armut gelitten, Schrecken und große Widerwärtigkeit.“ Schonungslos, wie ihr Leben war, zeichnete Albrecht Dürer das Gesicht der Mutter. Dieses „Bildnis der Mutter“ von 1514 wurde zum Symbol der „durch Krankheit, Kriege, Not und Entbehrung“ leidenden Mutter bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Ganz anders sah Vincent van Gogh das „Bild einer Mutter“. Er malte eine gütige Bürgersfrau als Denkmal der zeitlosen Mütterlichkeit. In seiner Figur, der bretonischen Wiegenfrau, stellt er die Mutter dar, die nach dem Volksglauben der Bretonen den Schiffern auf hoher See als milden Trost das Schlummerlied ihrer Kindheit sang; und wenn sein letzter Vers ihnen Untergang und Tod ansagt, dann nimmt sie die Allmacht der Liebe auf. Wir erfahren aus Briefen des Malers, dass er das Bild in den Hafenschenken von Marseille zwischen zwei kreisenden Sonnen aufgehängt wissen wollte, um damit die menschlich Gestrandeten zur Ahnung einer höheren, reinen und ewigen Liebe zu bekehren: Die Gestalt der geheimnisvollen, mütterlichen Frau im Verein mit dem glühenden Wirbel von mächtigem Licht, den die Sonne bei van Gogh immer bedeutet, soll als Tröstung und Kraft die Verlorenen in der ewigen Versöhnung bergen.
Fast in allen frühen Kulturen findet man unter wechselnden Formen die Figur der Mutter mit dem Kind, die ebenso gut eine Gruppe aus dem alltäglichen Leben darstellen kann wie eine machtvolle Göttin, die den Menschen Segen bringt. Das Bild der fruchtbaren Frau erscheint in der Geschichte der Menschheit als älteste Weihegabe an die großen Kräfte, denen alles Gedeihen anheimgegeben ist.
Ein mütterliches Wesen ist nach altägyptischen Göttermythen das Weltall – eine große Kuh, die jeden Morgen die Sonne und damit alles Leben gebiert. Ihr Leib ist der sternenbesetzte Himmel, und auf dem gütigen Haupt trägt sie zwischen den Hörnern, die den Mond bedeuten, die golden strahlende Sonnenscheibe. Unter ihrem Haupt aber steht die Gestalt Pharaos, den sie mütterlich beschützt und der von ihr seine Kraft empfängt.
Gewaltig und drohend wie eine Urmacht ist die große Diana von Ephesus, eine Muttergottheit aus dem ältesten Kleinasien, die noch die späte Antike in berauschenden Orgien und sinnüberladenden Bildern feierte. Ihr Leib ist schwarz wie die Tiefe der Erde, aber ihr Haupt ist umgeben vom Lichtkreis des Himmels und Sternbilder sind ihr Halsgeschmeide. Löwen und Stiere auf ihrem Gewand sind ihre heiligen Tiere. Die Vielzahl der Brüste bezeugt die nährende Allmacht der großen Mutter Natur. Unendlich spendet die Allgebärende.
Mutter aller Gläubigen ist die heilige Kirche, ihr Leben ist die Liebe des Heiligen Geistes. In ihren Visionen schaut sie die heilige Hildegard von Bingen, Mystikerin, Pflanzenheilkundige und Äbtissin des Mittelalters, als Frau in königlicher Gestalt, überragt vom festen und lichten Turm der göttlichen Kraft, aus dem die goldenen Feuerzungen des Pfingstfestes hervorbrechen. Die ganze Christenheit birgt sie im jungfräulichen Schoß, und unablässig fleht ihre liebende Sorge um die Gnade Gottes für die Menschen.
„und Adam gab seiner Frau den Namen Eva, das ist: Mutter aller Lebendigen.“ Aus dem Ursprung dieses Geschlechtes empfängt die ganze Menschheit das Leben, aber auch die schwere Last der Schuld und des Schicksals, die Erde und Himmel trennen. Als Königin ist die Jungfrau Maria geschmückt, selig gepriesen von allen Geschlechtern der Zukunft. Die gebenedeite Frucht der neuen Eva ist der Sohn Gottes, der Erlöser aller Menschen. Maria wurde vom göttlichen Ratschluss zur Mutter einer erneuerten Welt bestimmt, weil sie mit der Geburt Jesu allen das wahre unsterbliche Leben schenkt.
Die Lilie ist die Blume der Bibel. Sie zierte auch die Säulenkapelle im Tempel Salomos in Jerusalem. Sie war ein Symbol der Schönheit, oft auch von Fruchtbarkeit und Reichtum. Unter christlichem Einfluss wurde sie zum Sinnbild für geistige Reinheit, Heiligkeit und Auferstehung und deshalb häufig in der Nähe und Umgebung von Kirchen angepflanzt.
Vornehmlich Tulpen, Nelken und Lilien schenkt man Frauen seither zu besonderen Anlässen, wobei Marienlilien, also Madonnenlilien, gerne als Blumengeschenke zum Muttertag verschenkt werden. Aber es müssen keine Lilien sein. Blumen sollte man mit Bedacht verschenken. Niemals kommt es darauf an, ob es wenige oder viele sind, ob sie selbst gepflückt, billig oder teuer waren. Blumen sollten immer ein „teures“ Geschenk sein, um damit zu zeigen, wie teuer einem ein geliebter Mensch ist.
Herz und Blumen sind die Symbole des Muttertages, Madonnenlilien und Rosen. Das Fest ist verhältnismäßig jung: Miss Anna Jarvis aus Philadelphia war die erste, die 1907 „Muttertagsblumen“ verschenkte. Und Philadelphia war auch die erste Stadt der Welt, in der der erste Muttertag gefeiert wurde: 1908. US-Präsident Wilson verkündete am 9. Mai 1914 in einem Kongressbeschluss, den zweiten Sonntag im Mai „als öffentlichen Ausdruck für die Liebe und die Dankbarkeit zu feiern, die wir den Müttern unseres Landes entgegenbringen.“ Und seither schenkt man den Müttern Madonnenlilien am Muttertag. In Deutschland wurde der „Tag der besonderen Ehrung der Mutter“ zum ersten Mal 1922 gefeiert.
Die weiße Lilie der Maria
Ich bin eine Blume auf den Wiesen des Sharon,
die weiße Lilie der Madonna,
ich bin die Königsblume der Romanen,
die Wappenblume der Orientalen
und zier die Säulen im Tempel Salomons.
Ich bin das Sinnbild der Jungfräulichkeit,
der Reinheit und der Heiligkeit,
von Gott geweiht der Christenheit,
der „holden Jungfrau“ Fruchtbarkeit.
Ich bin die stolze Lilie in den Klostergärten,
Symbol der Mönche für Marias Schönheit,
der Auferstehung und der Reinheit,
ein Denkmal in den heil’gen Stätten,
Symbol der Treue und der Seligkeit.
Ich hab die Dichter aller Zeiten
zu ihren Werken inspiriert,
in Prosa, Poesie und Lyrik
und in Romantik aufgeklärt.
Als Lichtsymbol in der Heraldik,
trag ich der Sonne goldnes Kleid,
auf dass das Leben ewig währt.
Am Grabe pflanzt ihr weiße Lilien,
der Toten Geist steigt auf zu mir,
ein Bild der Hoffnung und des Friedens,
ist ein Geschenk von mir.
(Dieter Kremp)
Die Frauenminze heißt auch Marienbalsam
Die Frauenminze (Tanacetum balsamita) ist eine mehrjährige, krautige Pflanze, die in ihren bläulich-grünen, auf der Unterseite fein behaarten Blättern, zahlreiche ätherische Öle enthält, darunter auch Kampfer, Thujon und Menthol. Die verzweigten Stängel sind flaumig behaart. Die Frauenminze, auch Marienbalsam, Marienblatt, Balsamkraut, Riechblatt, Marienminze und Bibelblatt bezeichnet, ist eine, leider weitgehend in Vergessenheit geratene Heilpflanze, die 795 n. Chr., von Karl dem Großen vorgeschrieben, auf allen kaiserlichen Gärten angebaut werden musste. Seit dem 16. Jahrhundert wurde sie gegen Krämpfe, Würmer und zur Förderung der Menstruation gebraucht. Die ersten Siedler in Nordamerika haben getrocknete Blätter des Marienbalsams als aromatisches Lesezeichen in die Bibel gelegt. Daher kommen auch die Namen Bibelblatt und Gebetbuch-Pflanze. Die Blätter des Marienbalsams duften beim Zerreiben nach Pfefferminze und erinnern dadurch an Kaugummi (Kaugummipflanze).
Der Marienbalsam verströmt einen herrlich würzigen Geruch, der an Minze und Zitrone erinnert, der von einer süßlichen Note begleitet wird – besonders, wenn man ihn zwischen den Fingern zerreibt. Der Geschmack des Marienbalsams ist aromatisch und leicht bitter.
Die Frauenminze ist keine Minze-Art, sondern gehört zur Familie der Korbblütler. Sie ist eng verwandt mit dem Rainfarn und dem Mutterkraut.
Das erste neuzeitliche Kräuterbuch, das die Frauenminze erwähnt, ist aus dem Jahr 1539. Hier beschreibt Hieronymus Bock ausführlich die Pflanze und geht auch auf die Heilwirkung näher ein: In „Wein gesotten und getrunken“ helfe sie gegen verschiedene tierische Gifte, „stillet auch den bauchfluss und das Grimmen im leib“. Äußerlich als Umschlag und Schweißbäder angewandt, sei die Frauenminze menstruationsfördernd und schmerzstillend: „Das kraut zerstossen und pflasters aufgelegt heilt die harten knollen und andere geschwulst.“
Heute wird der Marienbalsam in der Naturheilkunde angewandt als Tee bei Blähungen, Fieber, Verdauungsstörungen, Verstopfung, Leberschwäche, Nierenschwäche, Blasenschwäche, bei Menstruationsstörungen und gegen Periodenkrämpfe. Zerreibt man das frische Kraut auf der Haut, dann hilft es ähnlich wie der Spitzwegerich bei Insektenstichen und Wunden. Die frischen Blätter dienen auch zur Abwehr von Läusen, Flöhen und Stechinsekten. Als Küchenkraut findet der Marienbalsam wegen seines intensiven Geruches eine sparsame Verwendung – z. B. zu jungen Kartoffeln, im Salat, zu Geflügel, für Füllungen oder Obst- und Pfannkuchen. Die heutige Bauerngartenpflanze eignet sich als Duftkraut auch für Potpourris und für Duftsäckchen.
Es gibt noch einige andere Marienblumen, so z. B. auch das Marienblatt (Chrysanthemum balsamika), eine alte Bauerngartenpflanze, die Marienglockenblume (Campanula medium) und auch das Schneeglöckchen (Galanthus nivalis), das zu den Amaryllisgewächsen zählt. Wie viele weiße Blumen gelten Schneeglöckchen, auch Schneehase und Marienglöckchen genannt, vielerorts als Symbol für jungfräuliche Liebe. Nach der Christianisierung wurden sie zu einer der vielen Marienblumen. Mit dem ersten Schneeglöckchen, was man im Frühjahr sieht, soll man sich die Augen wischen. Das soll sie vor Krankheiten bewahren oder sogar Augenkrankheiten heilen. In der Slowakei gräbt man Schneeglöckchen aus und gibt sie den Kühen, damit Zauberinnen ihnen die Milch nicht stehlen können. Schüchterne Liebhaber benutzten früher getrocknete oder gepresste Schneeglöckchen als Amulett, um auf Gegenliebe bei ihrer Angebeteten zu stoßen.
Der Legende nach hat das Marienglöckchen mit dem Schnee seine Farbe geteilt, darum sollen Schnee und Schneeglöckchen befreundet sein.
Die „schöne Bella“ ist ein Marienblümchen
„Bellis“ sind die „Schönen“ – ein treffender Name! Unscheinbar klein, sittsam und bescheiden und kaum beachtet, schmiegen sich die Gänseblümchen (Bellis perennis = die „schönen Kleinen“) mit ihrer runden Rosette aus kleinen, eiförmigen Blättchen dem Boden an und klecksen doch auch in den sterilsten Rasen leuchtend weiße Tupfer – und das auch noch im Winter. Klein, aber oho, in vielfacher Hinsicht!
Diese Blume, im Volksmund auch Marienblümchen, Mondscheinblümchen und Tausendschön genannt, soll dem, der die Wurzel der Pflanze bei sich trägt, Zuneigung, Klugheit und Verstand verleihen. Das zierliche, kleine Blümchen galt auch als Symbol der Mutterliebe und damit Marias, weil die Blätter sich bei Regen so über die Blüte zusammenlegen, dass sie ein schützendes Dach bilden. Es symbolisiert das ewige Leben und Erlösung, aber auch, wie die Margarite, Tränen und Blutstropfen. In der nordischen Mythologie war es der Frühlingsgöttin und der Göttin der Auferstehung, der Ostara, geweiht. Ludwig IX. nahm das Marienblümchen mit den Lilien in sein Wappen auf.
„Bescheidenheit ist seine Zier …“, könnte man beim Gänseblümchen sagen, und doch nimmt das zarte Pflänzchen in der Evolutionsskala einen hohen Rang ein. Trotz seiner großen Zahl von Floretten(Einzelblümchen) wirkt das Marienblümchen bei oberflächlicher Betrachtung so, als sei es eine einfache, offene Blüte der allerprimitivsten Prägung. Das ist es aber mitnichten. Werbung um Insekten betreibt das Marienblümchen durch ein Körbchen aus weißen Strahlenblüten, die unterseits zu meist rötlich angehaucht sind und die gelben, röhrenartigen Scheinblüten wahrhaft schamlos ausnutzt.
Bei Sonnenschein sind die Köpfchen weit geöffnet, nachts und bei Regen schließen sie sich und nicken traurig nach unten. Die Sonne lieben sie über alles, nach ihr drehen sie sogar das Körbchen.
Das Gänseblümchen versteht die Kunst des Werbens um Liebe, duckt sich flach auf den Boden unter dem Tritt des Vorübergehenden, doch es steht wieder auf. Maßliebchen und Tausendschönchen sind seine vornehmen Schwestern. Ohne Schaden an seinem Blumenschmuck zu nehmen, verträgt das Marienblümchen bei trockenem Wetter Temperaturen bis minus 16 Grad. Kein Wunder, dass das Gänseblümchen fast das ganze Jahr über blühen kann. Von den ersten Vorfrühlingstagen bis in den Winter hinein erfreuen uns die „Blümchen aus unseren Kindheitstagen“ auf Grasfluren aller Art. Wie bei der Margerite, einer ihrer zahlreichen größeren Verwandten aus der Familie der Korbblütler, werden nostalgische Erinnerungen wach. Das Gänseblümchen, auch „Orakelblume“ genannt, galt schon in alter Zeit als „Blume der Unentschiedenheit“. Man zupfte die äußeren Strahlenblüten nacheinander ab. „Er (sie) liebt mich, er (sie) liebt mich nicht …“ war der früher am häufigsten beim Abrupfen gesprochene Spruch. Und die letzte Zungenblüte entschied den Orakelspruch über die erste Jugendliebe. Aber der Spruch wurde auch abgewandelt und erweitert: „Er liebt mich – von Herzen – mit Schmerzen – ein wenig- oder gar nicht.“ Aber auch andere Fragen musste das Marienblümchen beantworten. Es entscheidet über den Beruf des Zukünftigen: „Edelmann, Bettelmann – oder Bauer.“ Schließlich orakelte das Blümchen auch über die ewige Seligkeit: „Himmel – Fegefeuer – Hölle …“
Zahlreiche Volksnamen künden von der Beliebtheit des Gänseblümchens: Marienblümchen, Marienschönchen, Mutterblümchen, Augenblümchen, Himmelsblümchen, Sonnenblümchen, Mondscheinblümchen, Gänselieschen und Mümmelie.
Tausendschönchen oder Maßliebchen, die vornehmen Schwestern unseres heimischen Gänseblümchen, sind dichtgefüllt und kugelrund; so wirken sie wie Sonntagsschönheiten auf dem Lande. Die weißen, rosa und manchmal roten Blütenköpfchen lassen sich zu hübschen Biedermeiersträußen binden. Die stets winterharten Maßliebchen eignen sich am besten für Einfassungen im Garten, als Grabschmuck und als Frühlingsbalkonzierde. Vorsicht bei ihrer Vermehrung ist geboten! Maßliebchen samen leicht aus, fallen aber meist in ihre „ungefüllte“ Vergangenheit im Gänseblümchenkleid zurück. Besser ist eine Vermehrung durch Teilung besonders kräftiger Pflanzen.
Woher kommt nun die Bezeichnung Gänseblümchen? Das Gänseblümchen ist seit Jahrhunderten eine äußerst beliebte Futterpflanze für Federvieh, insbesondere für Gänse. Die botanische Bezeichnung „bellis“ = „schön“ und „perennis“ = „ausdauernd“ hängt mit ihrer langen Blütezeit zusammen.
Die Blütenköpfchen des Marienblümchens schließen sich nachts bei Regen, tagsüber folgen sie dem Lauf der Sonne. So war es auch allerorten ein Wetterprophet. Ein Sträußlein Marienblümchen in der guten Stube symbolisierte die soziale Eintracht in der Familie. Ein Sträuchen am Hut, in der Johannisnacht gepflückt, sollte dem Jüngling offenbaren, wer seine Zukünftige ist. Umgekehrt warfen Mädchen ein Sträußlein Gänseblümchen in den Bach. Dort, wo das Sträußlein am Ufer hängen blieb, sollte der Auserwählte wohnen. Im 18. Jahrhundert geriet jedoch das Gänseblümchen in Acht und Bann und wurde systematisch vernichtet, weil man es, übrigens zu Unrecht, als abtreibendes Mittel ansah.
Als Heilpflanze wurde das Marienblümchen relativ spät entdeckt. Die medizinischen Eigenschaften sind erst seit der Renaissance bekannt. Umschläge mit frischen Blümchen wirken schmerzlindernd und blutstillend bei Wunden, Blutergüssen und Geschwüren. Gänseblümchentee wirkt bei Bronchitis schleimlösend und hustenreizmildernd, als Galle-, Magen- und Lebermittel, aber auch als blutreinigendes Schönheitsmittel. Die frischen Blüten sind außerdem eine dekorative und leckere Zutat zu grünem Salat und sollen gleichzeitig hartnäckige Verstopfung kurieren. Für einen Teeaufguss nimmt man einen Teelöffel der getrockneten Blüten auf eine Tasse kochendes Wasser und lässt zehn Minuten ziehen. Täglich trinkt man zweimal eine Tasse Tee.
Die Inhaltsstoffe der „stillen Schönen“ verschönern auch die Gesichtshaut schöner Frauen. Aus den Blüten der Gänseblümchen stellt man ein Gesichtswasser her, das die Talgproduktion einer stark fettenden Haut wieder normalisiert. Schließlich tragen auch die Blätter zur Verjüngung des Organismus bei: Sie ergeben einen wahrhaft delikaten Wildsalat, der in seinem milden Geschmack dem etwas bitteren Löwenzahnsalat Konkurrenz macht.
In der homöopathischen Anwendung nimmt man die Dilution bis D 30 bei Schleimhautentzündungen des Nasen- Rachenraumes und der Atemorgane, bei Ekzemen, Akne und Furunkeln, bei Verstauchungen und Prellungen. In der spagyrischen Anwendung nimmt man täglich 15 bis 30 Tropfen der Urtinktur als Kompresse bei Hautwunden.
Rezepte mit Marienblümchen für die Küche:
Rezept „Falsche Kapern
Man nimmt dazu die noch geschlossenen Blütenknospen, trocknet sie und gibt sie in eine kalte Essig-Salzmischung: ½ Liter Obstessig, 1 Teelöffel Salz, 1 Lorbeerblatt. In Gläser einfüllen und gut verschließen. An einem dunklen Ort aufbewahren.
Gänseblümchengemüse
Dazu benötigt man 150 Gramm Gänseblümchenblätter, 15 Gramm Butter, 1 kleine Zwiebel, 0,05 Liter Milch, Glutal, Salz, Kurkuma, Liebstöckel, Basilikum. Die Blätter in kochendem Wasser garziehen, abgießen und klein schneiden. In Butter die gewürfelte Zwiebel anschwitzen und im Anschluss eine Mehlschwitze fertigen, mit der Gemüsebrühe auffüllen und sämig rühren. Die fertigen Gänseblümchenblätter dazugeben und mit Kräutern und Gewürzen abschmecken.
Quark mit Gänseblümchen
Zutaten: 50 Gramm Gänseblümchenblätter, 100 Gramm Quark, 10 Gramm Löwenzahnblätter, 0,05 Liter Milch, Kümmel, Salz, Paprika, Thymian, Bärlauch.
Zubereitung: Den Quark mit der Milch sämig rühren. Die ausgelesenen Blätter klein hacken und mit den Kräutern unter den Quark mischen. Den Quark würzen und noch etwas durchziehen lassen.
Kräuteressig mit Gänseblümchen
Zutaten: 200 Gramm Gänseblümchenknospen, 0,3 Liter Essig, Estragon, Ysop, Bohnenkraut, Thymian, Zwiebel.
Zubereitung: Die geputzten Gänseblümchenknospen und Kräuter mit Essig übergießen. Die eingelegten Gänseblümchenknospen können anstelle von Kapern verwendet werden.
Gänseblümchen mit Sauerampfer
Zutaten: 30 Gramm Gänseblümchenblätter, 30 Gramm Sauerampfer, 30 Gramm Borretsch, 30 Gramm Kräuter wie Kerbel, Petersilie, Dill und Estragon, 50 Gramm saure Sahne, Pfeffer, Salz, Zitrone, Zucker.
Zubereitung: Die Kräuter feinhacken, würzen und mit saurer Sahne vermischen. Dazu Pellkartoffeln mit Leinöl servieren.
Angelika, der Engel auf Erden, heißt auch Marienbote
Die Engelwurz (Angelica archangelica), im Volksmund auch Marienbote, Gottesbote, Mariengruß, Marienengel, Mariensüß, Brustwurz, Himmelsengel, Waldengel, Waldbrustwurz, Engelgeist, Heiligensüß, Himmelfahrtswurz, Michaelwurz, Zahnwurzel, Magenwurz, Engelsgabe und Klosterengel genannt, hat viele Anwendungsformen in der Volksheilkunde, was ihre Volksnamen besagen.
Die Engelwurz ist eine der ältesten Symbolpflanzen innerhalb des Christentums. In der Kunst ist sie Symbol der Dreifaltigkeit und des Heiligen Geistes, weil der Stängel zwischen zwei sich gegenseitig umschließenden Häuten hervorwächst. Sie galt früher als Hauptheilmittel gegen die Pest. Der Legende nach brachte ein Engel einem Mönch die Heilpflanze. Im Mittelalter war der Glaube verbreitet, dass die Engelwurz engelhafte Kräfte gegen Zauberei und böse Verwünschungen besitze. In hohen, schon toxischen Dosen war sie jedenfalls früher ein Abortivum.