Von der Weisheit und vom Brauchtum unserer bäuerlichen Vorfahren
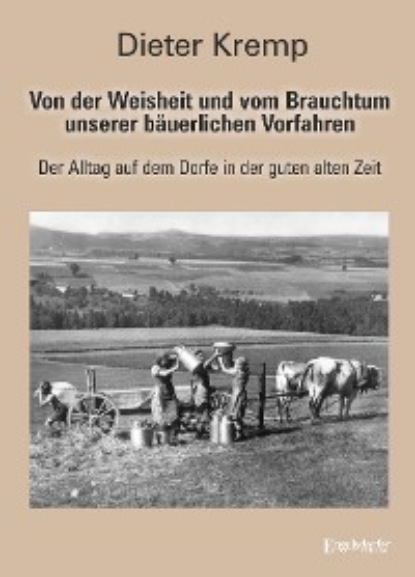
- -
- 100%
- +
Mit dem Bestellen der Mais- und Kartoffelfelder waren die vorzüglichsten Frühlingsarbeiten der Hauptsache nach beendet, aber es gab trotzdem noch immer draußen und im Hause genug zu tun. So galt es zum Beispiel, den der Erde anvertrauten Samen vor fressgierigen Elstern und Rabenvögeln zu beschirmen, indem man Vogelscheuchen aufstellte. Es war aber auch wichtig, das Beschützen des Ackers vor bösen Geistern und vor der Ungunst des Himmels zu erreichen. Dafür war das sogenannte „Palmen“ gut. So gab man von d en am Palmsonntag geweihten Palmzweigen und von d en am Karsamstag gesegneten Kohlen einige in die Mitte und an den vier Ecken des frisch angesäten Ackers, oder man fertigte aus den bei der Feuerweihe angebrannten Osterscheithölzern kleine Kreuze und steckte sie in das Feld, um dasselbe gegen den Abfraß und Hagelschlag zu schützen. Ebenso wurden beim Pflügen drei kleine Kreuze in die erste Furche gelegt.
Auch die Bäuerin hatte zu Hause noch viel zu tun. Sie hatte die Wäsche zu bleichen und den Hausgarten, ihre „Domäne“, zu bestellen. Streng genommen wollte es der Brauch, dass man mit der Gartenarbeit schon am Gertraudentag (17. März) begann, weil die Heilige Gertraud, wie die Legende erzählt, die „erste Gärtnerin“ war. Mit Dünger wurden die Beete bereits früher bedacht. Der Bauer hat im Baumgarten zu schaffen. Die Bäume mussten geschnitten werden, die Türen in Tenne und Schoppen erforderten Nachhilfe und besonders der Zaun um Haus und Feld bedurfte einer gründlichen Nachbesserung.
Als die Schulmeister noch bettelarm waren
„Und wird im Dorf ein Schwein geschlacht, dann könnt ihr sehen, wie er lacht, die größte Wurst ist ihm zu klein, dem armen Dorfschulmeisterlein.“
Sicherlich ist auch heute noch das „Lied vom armen Dorfschulmeisterlein“ bekannt. In den Anfängen des Schulwesens war der Dorfschullehrer noch bettelarm. Die Bezahlung war so gering, dass Sonderzuwendungen bei allen kirchlichen Anlässen, wie Taufe, Hochzeit, Konfirmation und Beerdigungen, eine hochwillkommene Zulage waren. Auch war es üblich, dass der Lehrer bei Hausschlachtungen eine Blut- und Leberwurst und einen Kessel Wurstbrühe erhielt.
Trotz der geringen Bezahlung war der Lehrer eine „Respektperson“, der einzige auf dem Dorf, der mit „Herr“ angeredet wurde. Er war „Dorfpolizist“ und „Richter“ zugleich, der über das sittliche Betragen der Kinder innerhalb und außerhalb der Schule zu wachen hatte. Beschwerden über Kinder anderer Leute wurden ihm vorgetragen. Nicht der Pfarrer, der Lehrer war verantwortlich für den Gottesdienstbesuch der Kinder. Nach der Abendglocke kontrollierte der Schulmeister auf den Dorfstraßen, ob alle Schüler zu Hause waren.
Aus einer Ostertaler Schule sind die „Zehn Gebote für Lehrer“ aus dem Jahre 1872 überliefert. Kaum zu glauben, was damals einem Lehrer alles aufgebürdet wurde: „Lehrer haben täglich die Lampen aufzufüllen und die Kamine zu säubern.“ „Lehrer dürfen einen Abend pro Woche auf Brautschau gehen oder an zwei Abenden, wenn sie regelmäßig zur Kirche gehen.“ „Nach zehn Stunden Schule dürfen Lehrer die restliche Tageszeit damit verbringen, die Bibel oder andere gute Bücher zu lesen.“ „Verheiratet sich eine Lehrerin, so scheidet sie damit aus dem Schuldienst aus, ist sie bereits im Ruhestand, so fällt der Bezug des Ruhegehaltes weg.“ „Jeder Lehrer sollte von seinem täglichen Lohn eine schöne Summe beiseite legen, damit er davon in seinem Alter leben kann und so der Gesellschaft nicht zur Last wird.“ „Jeder Lehrer, der raucht oder Alkohol – in welcher Art auch immer – trinkt, der Spielhöllen oder Wirtschaften aufsucht oder sich beim Friseur rasieren lässt, gibt zu der Vermutung Anlass, dass seine Integrität und seine Ehrlichkeit in Frage gestellt werden müssen.“ „Der Lehrer, der seine Arbeit treu und ohne Fehler fünf Jahre lang verrichtet, wird eine Gehaltsaufbesserung erhalten, vorbehaltlich der Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde.“
Gregor der Große, Kirchenvater und Papst, gilt als Schutzherr der Schule und der Schuljugend. Bei den Germanen war dies der Tag der Knaben- und Jünglingsheime.
Am Gregoriustag (14. März) schloss früher das Wintersemester in den Schulen. Es fanden festliche Umzüge statt, bei denen die Kinder als Handwerker verkleidet waren und historische Kostüme trugen. Die Umzüge schlossen mit Wettspielen und Wettsingen.
Das Gregorisingen ist eine Sitte, die zeigt, wie bettelarm früher die Schulmeister und ihre kleinen Schulen waren. Es war nämlich ein Bettelsingen, wobei der Schullehrer mit seinen Schülern von Haus zu Haus zog, von Gehöft zu Gehöft, Mehl, Eier, Fleisch, Brot und Speck einsammelte, um dann den Kindern im Wirtshaus ein kräftiges Mahl kochen zu lassen.
In manchen deutschen Landen zogen die als Engel verkleideten Schulkinder mit dem Lehrer, der den heiligen Gregorius darstellte, von Haus zu Haus, sagten Gedichte auf und sangen. Der Lehrer hielt eine kleine scherzhafte Versrede, bei der ein Schüler, als Fuchs verkleidet, ins Haus huschte, bei der vorher eingeweihten Hausfrau den Küchentisch plünderte und Gebäck und Obst in die Körbe der Mädchen füllte.
In Baden verkleidete sich ein Schüler als „Schulbischof“ und ritt auf einem Schimmel über den Schulhof. An einer langen Stange steckten Brezeln, die er an die Kinder verteilte.
Viele Schülerumzüge endeten auf einem Jahrmarkt, wo Zelte und Buden aufgeschlagen waren, wo man auf Scheiben schießen konnte, wo getanzt wurde und es zum Schluss einen Schmaus gab, zumindest einen Korb voller Gregoribrezeln für die Kinder.
Selbst gesponnen, selbst gemacht
„Selbst gesponnen und selbst gemacht ist die beste Bauerntracht“, lautet ein altes Sprichwort. Die Spinnräder kamen schon frühzeitig im Herbst in Betrieb. In einem Bauernhause waren so fünf bis sieben Stück vorhanden neben zwei oder auch drei Haspeln.
Die Mägde spannen schon im Oktober nach dem Essen bis zehn Uhr, obwohl noch keine Zahl aufgegeben war. Am anderen Morgen wurden die Rollen von der Hausfrau gehaspelt, um nachzusehen, ob sie auch fleißig gesponnen hatten. Später, wenn die Herbstfrüchte eingeerntet waren, vereinigten sich die Mägde zur Spinnergruppe. Es bildeten sich im Dorf mehrere Truppen. Die Kinder, so ab dem 8. Lebensjahr, waren die jüngste Truppe. Jungen und Mädchen gingen für sich. Die Töchter von den Höfen, obwohl sie auch Magdstelle einnahmen, bildeten auch eine Gruppe.
Gesponnen wurde von Martini bis ins Frühjahr hinein, mit Ausnahme des Sonnabends, wenn Roggen gedroschen wurde. Vormittags saßen alle mit ihrem Spinnrad allein. Nach Mittag wusste aber jede Spinnerin, wo die Zusammenkunft war.
Solch ein Spinnkreis bestand gewöhnlich aus lauter jungen Mädchen. Der Kleinknecht, sobald er nach dem Abendessen das Futter für die Kühe für den nächsten Tag geschnitten hatte, saß an der Türseite des Ofens und schnarchte. Die Mutter des Hauses mit ihren Kindern hatte ihren Platz an der anderen Seite des Ofens vor dem Kanapee. Der Vater, im Kanapee, rauchte seine selbst gedrehten Zigarren, wenn er es nicht vorzog, an solchen Spinnabenden seinen Nachbarn oder vertrauten Freund zu besuchen.
In solch einem Kreis von Spinnerinnen, der nicht selten aus acht, auch zwölf Personen bestand, - wurden drollige Hexen- und Spukgeschichten erzählt. Es wurden auch alle Neuigkeiten im Dorf ausgetratscht. Um die Wachsamkeit hochzuhalten, sang man zwischendurch Lieder. Auch Rätsel und Wörterspiele wurden gemacht. Je geräuschvoller es dabei herging, desto flotter ging das Spinnen vonstatten.
Im Winter, Punkt acht Uhr, ging der Spinnkreis hinaus auf die Diele. Dann spielte die Truppe auch mal Blindekuh. Es wurde auch getanzt, indem sie sich die lustigsten Weisen dazu sangen. Es fehlte dann nicht an Beteiligungen von Knechten aus dem Ort. Wo am Abend der Spinntrupp war, wusste jeder Bursche.
Nach einer Viertelstunde kamen alle wieder hereingestürzt und setzten sich hinter ihr Rad. Sie sahen sich dann gegenseitig auf die Rolle, wieviel wohl jeder gesponnen hatte. Um zehn Uhr nahm jede ihr Spinnrad unter den Arm und ging nach Hause. Zu Hause wurden dann noch die Rollen gehaspelt, und da stellte sich dann der Abendfleiß heraus.
Im Winter wurde schon nachmittags gesponnen. Wenn die Männer nach Holzfahren oder Dreschen Feierabend machten und die Knechte noch ihre Abendarbeit verrichteten, kamen die Mägde mit ihren Garnrollen ins Haus, um ihrerseits ihre Nebenarbeiten zu mache n. Nach dem Essen haspelten sie ihre Rollen, und dann ging es wieder zur Versammlung.
War ein armes Mädchen, das keine gute Anlage zum Spinnen hatte, so töricht und ließ beim Haspeln Fäden am Gebinde fehlen – man bezeichnete solches als „falsches Garn haspeln“ – dann war es eine tiefe Schmach für sie.
Ohne Flachs konnte auf dem Lande keine Familie bestehen. Auch in den Tagelöhnerfamilien spannen Mann, Frau und Kinder. Sie hatten ja ihren eigenen Flachs geerntet. Dafür mussten sie in der Ernte helfen. Man sah sie nicht anders zum Kaufmann gehen als mit ein paar Stück Garn in der Hand, wofür Kaffee, Öl oder Salz eingetauscht wurde. Auch ihre Kleidung bestand aus Selbstgesponnenem und war selbst gemacht.
Das Zimtwaffeleisen meiner „Großel“
Ich erinnere mich mit Wehmut an den würzig-süßen Duft Von Zimtwaffeln, wenn alljährlich in der Adventszeit meine „Großel“ (Großmutter) auf dem Kohlenofen die Zimtwaffeln gebacken wurden. Noch heute ist das uralte Zimtwaffeleisen im Besitz meiner Schwester Ursula. Es muss wohl über hundert Jahre alt sein.
Wie heimelig war es in der Stube, wenn der Duft alle Räume des Hauses durchströmte. Und oft war es so, dass auch Bratäpfel auf der Ofenplatte brutzelten. Heute rätsele ich über die Bedeutung der sechs verschiedenen Backformen-Symbole, die auf dem Zimtwaffeleisen erhalten sind. Da ist eine Schnecke (Spirale) dargestellt als Zeichen für die unaufhörliche Bewegung der Zeit, also eine Verheißung der ständigen Erneuerung. Für das Rotkehlchen gibt es zwei verschiedene Deutungen. Die christliche lautet, dass das Rotkehlchen dem Herrn Jesus am Kreuz einen Dorn aus der Stirn zog, sich dabei selbst verletzte und seitdem den roten Blutfleck auf der Brust trägt. Es kann aber auch sein, dass das Rotkehlchen mit dem Zaunkönig verschmolzen ist, der früher am Tag des heiligen Stephan (26. Dezember) gejagt wurde. es war der einzige Tag im Jahr, an dem dieser im Naturglauben heilige Vogel getötet werden durfte.
Vier Herzformen symbolisieren das Fest der Geburt Jesu, das Fest der Liebe. Die Christrose, im Volksmund auch Schneerose oder Schneekatze genannt, erinnert an die Blüte Jesse, die mitten im Dunkel der unerlösten Welt aufblühte: „Es ist ein Ros’ entsprungen aus einer Wurzel zart“. In der Wintersonnenwende haben unsere Vorfahren große Schalen mit Früchten auf den Tisch gestellt, um im kommenden Jahr keinen Mangel zu leiden. Zu den Früchten gehörten vor allem Nüsse als Symbol der Fruchtbarkeit. Die Nüsse waren auch Sinnbilder von Gottes unerforschlichem Ratschluss.
Schließlich ist auf dem Zimtwaffeleisen auch noch ein Kreuzsymbol. Am Luciatag (13. Dezember) wurde vielfach Lucienweizen in Kreuzform in flache Tonschalen gesät und feucht gehalten. Die Weizensaat stellte die wieder keimende Natur dar. Fast nicht mehr zu entziffern, weil „das Alter am Zahn der Zeit genagt hat“, ist ein Symbol auf der Kopfseite der Zimtwaffelpfanne. Es sieht aus wie ein Rad (Zahnrad) mit einer römischen Eins. Es könnte das Rad als Symbol der Sonne im Mithras-Kult der keltischen Vorfahren sein. Die römische „I“ weist auf den Beginn des neuen Jahres hin.
Meine Schwestern backen noch heute Zimtwaffeln nach einem uralten Rezept ihrer Großmutter, das in der alten Sütterlin-Schrift in einem Kochbuch ihrer „Großel“ aufgeschrieben ist: Man nimmt ½ Pfund Butter, 300 Gramm Zucker, drei große Eier, 100 Gramm Zimt und ein Pfund Mehl. Der Teig muss drei bis vier Stunden lang stehen.
Vom „Strohpatt“ und der „Binsegoth“
In unserem Dorf wurde das neugeborene Kind innerhalb acht Tagen getauft. Bis zu diesem Tage war es ein „Hädekend“ (Heidenkind). Je nachdem, ob es ein Bub oder ein Mädchen war, erhielt es früher den Vornamen des Vaters oder der Mutter. Waren schon Kinder in der Ehe vorhanden, so wählte man gern die Vornamen der Paten. Pate und Patin (Patt und Goth) wurden, wenn irgend angängig, der näheren Verwandtschaft entnommen. Die Frau des Paten war die „Binsegoth“, der Mann der Patin der „Binsepatt“. Pate und Patin zu werden, wurde als besondere Ehre empfunden, die aber auch zu Patengeschenken verpflichtete. Ein solches Geschenk, Zuckersteine oder auch Bargeld, erhielten vor allen Dingen der taufende Pfarrer und die Hebamme. Auch pflegten Pate und Patin an die vor der Kirche schon sehnsüchtig wartenden Kinder Zuckersteine auszuteilen. Bis zur Konfirmation waren Pate und Patin verpflichtet, ihre Patenkinder am Neujahrstag und an Ostern zu beschenken. In der Regel hatte früher ein Kind drei Paten. Diese wurden an Ostern und an Neujahr reihum aufgesucht. Die Pflicht der Paten war es auch, den Wein zu bezahlen, der bei der Kindtauffeier getrunken wurde. Zeigte sich der Pate knauserig, so wurde er zeitlebens den Namen „Strohpatt“ nicht mehr los.
Uralte Wiegenlieder wurden dem Kleinkind von der Mutter gesungen:
„Schlaf, Kindchen, schlaf!
Dein „Babbe“ hüt die Schaf.
Dein „Modder“ hüt die Lämmercher,
in den dunkeln Kämmercher,
schlaf, Kindchen, schlaf“
Oder die Großmutter sang:
„Guten Abend, gute Nacht,
mit Rosen bedacht,
mit Näglein besteckt,
schlupf unter die Deck.
Morgen früh, wenn Gott will,
wirst du wieder geweckt.“
Bei Krankheiten glaubte meine Urgroßmutter noch an einen Erfolg durch „gesundbeten“. Die „Gesundbetersch“ sollte durch „Sympathie“ heilen. Brave Kleinkinder wurden auf dem Schoß der Mutter reiten gelehrt. Dazu sang man:
„Reite, reite Rösschen!
Dort oben steht ein Schlösschen;
Da unten steht ein Glockenhaus,
da gucken drei schöne Jungfern raus!“
Aus meiner Kinderzeit kann ich mich auch noch an ein Neckliedchen erinnern:
„Miller, Miller, Maler
hatt de Sack voll Daler,
hat de Sack voll Haselness
Miller, miller, Maler!“
Oder es hieß:
Miller, Miller, Maler
Hatt de Sack voll Daler.
Miller, Miller, Plaschderschess,
die Dieter hat en die Hos geschesss.“
Den weinerlichen und ungehorsamen Kindern drohte man: „Pass off, der ewig Judd kommt und steckt dich en de Sack!“ Oder „Der schwarze Mann kommt und holt dich mit!“ oder „Der Bautz kommt!“ In der Zeit vor dem ersten Schulgange ängstigte man unverständigerweise das Kind mit den Worten: „Du musst noch in die glühend Kett beiße.“ In die Schule nahmen wir dann die „Greffelbichs“ (Griffelbüchse) und die „Lai“ (Schiefertafel) mit. Wenn der Saft im Frühjahr wieder in die Sträucher stieg, stellten wir Jungen uns Blasinstrumente aus der Rinde von Haseln und Weiden her: „Schalmeien, Huppen oder Hippen, Pfeifen, Tuten oder Tratschen. Kam dann der Herbst, dann verbrannten wir Kinder auf den Äckern das welke Kartoffelkraut und brutzelten die Kartoffeln im Kartoffelfeuer.
Von der „Katzenmusik“ bis zum „Leichenimbs“
Ein besonderer Tag im Leben des Kindes war bei uns im Dorf der Konfirmationstag und der Kommunionstag. Die Familie gab dann ein großes „Imbs“ (Imbiss). Die Verwandtschaft wurde eingeladen, Pate und Patin wurden nie vergessen. Nach der Entlassung aus der Volksschule zählte sich das Kind schon gern zu den „Großen“. Damals war es auf dem Dorf höchst selten, ein Kind auf die „höhere Schule“ zu schicken. Ich war 1949 der erste Junge im Ort, der auf die „höhere Schule“ ging. Ich war in der Volksschule der beste Schüler. Vor allem Deutsch, Naturkunde („Biologie“), Erdkunde („Geographie“), Heimatkunde, Religion und später Französisch waren meine Lieblingsfächer. Ich träumte schon damals im Geheimen vom Studium der Botanik. Doch wie sollte ich auf die „höhere Schule“ kommen? Meine Eltern waren wahrlich nicht begütert. Sie waren schon auf der Suche nach einer Lehrstelle für mich. Ich sollte Kürschner werden. Als das mein Lehrer Zwalla hörte, war er bitterböse. Er besuchte meine Eltern und bat sie inbrünstig darum, mich auf das „Saarländische Lehrerseminar“ in der benachbarten Stadt Ottweiler zu schicken. So geschah es also: Die Aufnahmeprüfung bestand ich mit sage und schreibe 20 Punkten. Im Saargebiet wurde damals nach folgendem Punktsystem bewertet: 18 bis 20 Punkte war die Note „sehr gut“, 16 bis 17 Punkte war „gut“, 13 bis 15 Punkte war „befriedigend“, 10 bis 12 Punkte war „ausreichend“, 6 bis 9 Punkte war „mangelhaft“ und null bis 5 Punkte war „ungenügend“.
Die Verlobung war bei uns auf dem Dorfe keine so einfache Sache, wie sie es heute ist. Die Eltern hatten bei der Auswahl des Ehegatten ein sehr gewichtiges Wort mitzureden. Die Verlobung erfolgte durch Handschlag, auch Handstreich genannt. Den Hochzeitszug eröffnete, mit der Braut am Arm, der Brautführer. Dieser war auch standesamtlicher und kirchlicher Zeuge. Beim Hochzeitsmahl ging es immer lustig zu. Wie bei allen bäuerlichen Schmäusen gab es früher zuerst Rindfleischsuppe, dann Rindfleisch mit Meerrettich, Rotrüben und Gurken als Beilage und hierauf Schinken mit Kraut. Es war auch Brauch, dass während der Hochzeitsfeierlichkeiten der Braut der Schuh geraubt und dann versteigert wurde. Am Spätnachmittag zog die Hochzeitsgesellschaft in die Wirtschaft, wo getanzt wurde. Vor dem Haus des Bräutigams wurde am Abend mit allen möglichen Gegenständen eine „Katzenmusik“, „Schariwari“ genannt, gemacht. Sie hörte erst dann auf, wenn der Bräutigam sich bereit erklärte, etwas Trinkbares zu stiften.
Wenn jemand in der Familie oder in der nahen Verwandtschaft gestorben war, stelle meine Mutter die Uhr ab, „damit der Tote in seiner Ruhe nicht gestört werde.“ Sie verhängte den Spiegel, um dem Toten nicht die „zweite Leich“ zu zeigen. Die Leiche wurde gewaschen und mit einem Totenhemd bekleidet. Des Mittags oder des Abends läuteten die Totenglocken. Um den Sarg stellte man vielfach brennende Kerzen. Abends kamen die Nachbarn und Verwandten zusammen, um zu beten. Ganz früher wurde auch Nachtwache gehalten. Am dritten Tage nach dem Tode wurde der Verstorbene beerdigt. Mit einem Pferdefuhrwerk wurde der Tote im Zug zum Friedhof gefahren. Nach der Beerdigung fand in der Wirtschaft das „Leichenimbs“ statt. Dazu gehörte vor allem Zuckerkuchen und Kranzkuchen.
Als noch das „Heimsje“ auf dem Bauernhof auf der Pirsch war
Mit dem Schwinden der bäuerlichen Struktur nahm die Zahl der Hauskatzen in den letzten Jahrzehnten bei uns rapide ab. Früher spielten sie auf dem Bauernhof eine wichtige Wächterrolle. Mit dem Anlocken „Heimsje oder Heimiche komm“ verband man die enge Beziehung der Hauskatze zu Haus und Hof. Daher kommt auch der liebevolle Name „Heimiche“: „Zum Heim gehörend“. Ein „Heimchen“ war früher auch die Hausgrille, ein kleiner Hausbewohner, auf dessen erstes Zirpen man im Sommer wartete. Und schließlich war eine gute Hausfrau ein „Heimchen am Herd“.
Einst war die Hauskatze der Wächter auf dem Hofe. Von großen Weizen-, Gerste- und Roggenhaufen wurden Mäuse und andere Nager geradezu magisch angezogen. Ganze Heerscharen taten sich oft an den Körnerbergen gütlich, solange keine Samtpfote einen Abschreckungseffekt erzielte. Mehr noch: Der Mäusekot und die schimmelnden Essensreste galten als höchst ungesunde Beimischungen für den Getreideschrot, der ja schließlich an Rinder und Schweine verfüttert werden sollte. Mit reichem Hunger und Jagdfieber ausgestattet, bewachten die Katzen auch die Futterübenhalde vor Mäusen und größeren Nagern, verscheuchten Ratten schon alleine durch die geschickt platzierten Duftmarken vom Komposthaufen und hielt zuweilen sogar im Gemüsegarten Wacht, um beispielsweise Amseln von den Beeten abzuhalten.
Auch kundige Obstbauern wussten die Arbeit des Schnurrers zu schätzen, denn kräftige Kater waren in der Dämmerung in den Obstanlagen auf der Pirsch, verharrten mucksmäuschenstill vor dem Eingang ins Reich einer Wühlmausfamilie und erwischten an einem Abend gleich drei der Schrecken. Kater „Tom“ hatte sich allein an diesem Abend schon bezahlt gemacht. Die wenigen nächtlichen „Gesangsarien“ der „Miezen“ wurden leicht verziehen.
Allerlei Schabernack trieben wir Jungen abends auf dem Dorf. Konnten wir einen Hausbewohner nicht leiden, so legten wir frische Baldrianwurzeln vor die Haustür. Dass Baldrianduft Katzen magisch anzieht, wussten wir. Die sich dann auf der Treppe tummelnden Katzen miauten so laut, dass der Hausherr nicht schlafen konnte. Meine Mutter brachte die erste Katze in unsere Familie mit. Es war eine schwarze Katze, und obwohl schwarze Katzen damals noch als Unglücksbote galten, waren wir hochzufrieden mit unserer „Mieze“. Meine Mutter Berta war mit meiner Tante Lina und der „Tilchegoth“ an einem Sonntagnachmittag den weiten Weg über den Berg von Steinbach nach Ottweiler ins Kino gegangen. Es war mitten im Winter. Auf dem Rückweg mitten in der Nacht fing es an zu schneien. Da kamen sie an einem kleinen Wäldchen vorbei und hörten ein klägliches Miauen. Es war ein schwarzes Kätzchen, das ihnen entgegenkam. Meine Mutter hatte Leid mit dem Kätzchen und nahm es mit nach Hause.
Der „Pfingstquak“ im Ostertal
Alljährlich zu Pfingsten findet in Werschweiler im Ostertal (Saarland) auch heute noch der uralte Brauch des Pfingstquakes statt. Was bedeutet „Pfingstquak“ und woher stammt dieser Brauch?
Sehr wahrscheinlich war der Quak ursprünglich ein Vegetationsdämon. Die Germanen glaubten, in diesem sei der Dämon selber und er würde so das Wachsen und Gedeihen der Natur günstig beeinflussen. Sie hüllten jemanden aus ihrer Mitte in das grüne Laubwerk des jungen Frühlings und schmückten ihn mit den ersten Blumen. Durch das Herumtragen von Haus zu Haus sollte er Segen spenden. So war wohl unseren Vorfahren dieses Umhertragen des Quakes eine sehr ernste, aber auch feierliche Angelegenheit.
Heute ist der Pfingstquak in Werschweiler nur noch ein Kinderbrauch. Das Wort „Quak“ wird unterschiedlich ausgelegt. Der Quak kommt außer in einigen Gegenden des Saarlandes noch im Hunsrück, Elsass und in der Pfalz vor. Man bringt damit etwas Junges, noch Unentwickeltes zum Ausdruck. Der Jüngstgeborene ist der Nestquak, unreife Kirschen werden ebenfalls als „Quaken“ oder „Quakerte“ bezeichnet. Der Pfingstquak wäre demnach das junge frische Maiengrün, die erste Gabe der überreichen Natur.
Jedes Jahr, wenn um Pfingsten die Natur sich zu entfalten beginnt, sich im Walde die ersten zarten Blätter zeigen, der Ginster am Wegrand und auf den Höhen seine goldenen Farben erstrahlen lässt und der Frühling sich in seiner schönsten Pracht zeigt, dann schenkt er der dörflichen Schuljugend den herrlichen Laub- und Blumenschmuck zum Pfingstquak.
Schon zehn oder auch vierzehn Tage vor Pfingsten, wenn die Rotbuchen ihr erstes zartes Grün zeigen, ziehen die älteren Jahrgänge der Schulbuben unter der Führung des Abschlussjahrganges – das sind die „Quakherren“ – mit zwei Handwagen hinaus in den Wald. Die Quakherren dürfen in den Handwagen Platz nehmen und werden in den Wald und später auch wieder nach Hause gefahren.
Im Wald angekommen, werden nun junge Buchen ausgesucht und die Äste, die sich gut zum Flechten eignen, abgeschnitten. Damit werden die beiden Handwagen voll geladen und noch ein Dach darüber geflochten, unter dem die Quakherren Platz nehmen.
Bei dem zweitältesten Quakherren zu Hause wird dann der Quak hergerichtet. Die Buchenreiser werden jetzt nochmals zurechtgeschnitten und damit das Gestell des Quakes umflochten. Das Gestell ist etwa 80 cm hoch, oben ist ein rundes Brett mit etwa 40 cm Durchmesser, am Rande sind 12 Löcher im gleichen Abstand gebohrt, in welche Haselnussstöcke gesteckt werden. Am unteren Ende sind die Stöcke an einem Blechreifen befestigt, der einen Durchmesser von 50 cm hat.
Ist das Gestell bis auf ein kleines Guckloch vollständig umflochten, wird der Quak bis zu seiner Vollendung in den Keller gestellt, damit er sich frisch hält. An Pfingstsonntag schon in aller Frühe sieht man ein emsiges Treiben der gesamten Schulbuben. Die gehen von Haus zu Haus und sammeln Blumen, die in den Dorfgärten wachsen. Die so gesammelten Blumen werden nun zum Quak getragen, denn mittlerweile haben die Quakherren den Quak auf einen provisorischen Tisch aufgebaut und jeder von ihnen ist mit einem kleinen Holzspieß bewaffnet, mit denen Löcher in das Quakgeflecht gebohrt werden. In diese Löcher steckten dann die Buben die Blumen hinein.

