Von der Weisheit und vom Brauchtum unserer bäuerlichen Vorfahren
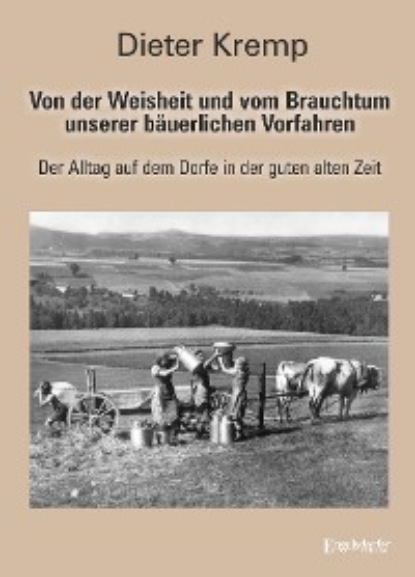
- -
- 100%
- +
Ist das Flechtwerk nun vollends mit all den bunten Blumen behangen, kommt als Abschluss ein kleines Fichtenkrönchen obendrauf, das in dem runden Brett befestigt wird. Dieses kleine Krönchen wird nun ebenfalls mit Blumen und bunten Bändern geschmückt. Der nun fertige Quak strahlt die ganze Kraft der bäuerlichen Blumengärten aus; besonders herrlich wirkt er, wenn Pfingstrosen, Flieder und Schneeball verwendet worden sind.
Am Nachmittag ziehen die vier ältesten Jahrgänge noch einmal in den Wald, aber diesmal ohne Handwagen. Jetzt werden die letzten Vorbereitungen für den nächsten Tag getroffen, die Anfertigung der „Taratschen“ (Schalmeien, Rindenflöten). Dazu müssen die Erlen herhalten, die sich besonders dafür eignen und an Waldbächlein gut gedeihen. Für jeden Schulbuben wird ein solches Instrument von den Erlen abgeschält.
Sobald sie mit ihren „Taratschen“ im Dorf erscheinen, stehen schon die jüngeren Buben, die nicht mitgehen duften, um ihre „Taratschen“ in Empfang zu nehmen. Nun sind alle Vorbereitungen getroffen, den Quak nach alter Sitte den Dorfbewohnern aufs Neue vorzustellen. Die beiden ältesten Jahrgänge bewachen in der Nacht den Quak, damit er nicht gestohlen wird.
Am zweiten Pfingsttag, schon früh beim Morgengrauen, werden alle Schulbuben des Dorfes durch d en Klang einiger „Taratschen“ geweckt. Die Töne, die man diesem Rindeninstrument entlocken kann, sind kaum zu beschreiben, den Dorfbewohnern aber bleibe n sie ewig in Erinnerung. Wenn sich die Buben alle bei den Quakherren versammelt haben, dann geht das Konzert richtig los. Einer trägt jetzt den Quak von Haus zu Haus, gefolgt von den „Taratschenmusikanten“.
Vor dem Zuge, aber hinter dem Quak, marschieren die Quakherren mit einem Eierkorb, einem Eimerchen für Speck und Butter und der Zigarrenkiste, die zum Aufbewahren des gespendeten Geldes benötigt wird. In diesen Geräten werden die Gaben eingesammelt. Es wird vor jedem Hause so lange musiziert, bis die Hausfrau oder der Hausherr an die Haustür kommen und ihnen etwas Essbares oder Geld geben.
Manchmal lehnt sich der Bauer neugierig über die Stalltür hinaus, da um diese Zeit das Vieh gefüttert wird und sagt mit einem ernsten Gesicht: „Ihr Buwe, es langt mit dem Krach“. Dabei kann er aber ein Lächeln kaum verbergen und denkt an seine eigene Schulbubenzeit zurück. Der Bauer nebenan, dem der Schalk schon von weitem aus dem Gesicht lacht, sagt: „Ihr Buwe, aber jetzt mal ordentlich geblasen.“
Sind die Buben mit ihrem Umzug durch das Dorf fertig, so geht es zum Haus des ältesten Quakherren. Hier werden jetzt die Eier entweder mit Butter oder mit Speck gebacken und von sämtlichen Quakbuben verspeist. Das Geld und den Rest des Speckes und der Eier teilen sich die Quakherren untereinander auf. Zu einem gewissen Ritual gehört auch das Zerstören der „Taratschen“ nach dem Umzug.
Das Quakgestell bleibt erhalten. Der nächstjährige Quakherr nimmt es mit nach Hause und bewahrt es auf. So endet jedes Jahr mit dem Eieressen an Pfingstmontag der schöne Brauch des Werschweiler Pfingstquakes.
Als die Frösche noch quakten
Erinnerungen werden wach, wenn wir an das „Märchen vom Froschkönig“ denken. Im richtigen Leben können Frösche und Kröten sich nicht wie im Märchen in Prinzen verwandeln, um die Sympathie des Menschen zu gewinnen. Im Mittelalter wurden sie als Teufelswesen verdammt und zu geheimnisvollen Salben und Tinkturen verarbeitet. Vor allem die Kröte galt in den volkstümlichen Vorstellungen unserer Vorfahren als Unglücksbote. Sie war das verfluchte Tier schlechthin, das Tier der Schatten, das Tier des Satans, der sich den Menschen häufig in dieser „hässlichen“ Gestalt präsentierte. Das Bild von der „hässlichen Kröte“, vor der man sich „ekelte“, ist zum Teil bis in unsere heutige Zeit erhalten geblieben.
Die Kröte war zum einen wichtiger Bestandteil der unheilvollen Absude und Tränke der Hexen, zum anderen aber auch – und das seit frühesten Zeiten bis Anfang des 20. Jahrhunderts – bedeutsam für die Behandlung von Rheuma oder Geschwüren. Man band sie lebend auf den erkrankten Körperteil. Zur Fieberbekämpfung schloss man sie in einem kleinen Säckchen ein, das man um den Hals trug.
Den Fröschen ging es bei uns ganz besonders „an den Kragen“: Sie galten als Delikatesse in der Landbevölkerung. Noch in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hat man die Teich- und Wasserfrösche im Frühjahr zur Zeit der Laichwanderungen massenhaft gefangen, ihnen bei lebendigem Leib die Schenkel abgerissen, um sie zu verspeisen. Der obligatorische Feuerlöschteich im Dorf war immer der Froschteich. Hier vor allem trieb man das grausame Spiel. Ich habe als Kind miterlebt, wenn in meinem Heimatdorf Anfang März die „Froschjagd“ begann. Bei Einbruch der Dunkelheit – Frösche wandern bei Regenwetter nachts zu ihren Laichtümpeln – versammelten sich die jungen Männer an der Hanauermühle im Bereich der Oster, um die umherziehenden Frösche zu sammeln. Einmal war auch ich dabei und noch heute denke ich mit Grausen zurück, wenn man ihnen die Schenkel aus dem Leib riss. Und das passierte in einer Nacht Hunderten von Fröschen. Ich erinnere mich, wie mein Patenonkel daheim Froschschenkel in der Pfanne briet. Und da sah ich was Unfassbares: Die Schenkel zappelten in der heißen Pfanne. Ich habe nie Froschschenkel gegessen. Heute stehen alle Frösche und Kröten unter Schutz; trotzdem werden die Froschlurche immer seltener, und manche Arten verschwinden sang- und klanglos.
„Froschkonzerte“ gehören der Vergangenheit an. „Wo Frösche sind, da sind auch Störche“, heißt es in einem alten Sprichwort. Das war einmal! Und da im Volksglauben „der Storch die kleinen Kinder bringt“, muss man sich nicht wundern, dass die Geburtenrate bei uns so niedrig ist.
Ich erinnere mich auch an den Laubfrosch, der gerne als Wetterprophet gehalten wurde. Seiner leuchtend smaragdgrünen Hautfarbe und seines „netten“ Gesichtsausdrucks wegen, war er früher der Liebling unter den Fröschen. Der Klettermaxe rutscht auch auf glatten Fensterscheiben nicht ab und springt mit einzigartiger Geschwindigkeit durchs Blättergewirr. Als Wetterpropheten siechten früher unzählige Laubfrösche in Einweckgläsern vor sich hin. Eine Leiterchen war die einzige Ausstattung. Das Geheimnis ihrer Wetterfühligkeit ist einfach zu lüften: Sie stiegen in die Höhe, wenn es ihnen im engen Behälter zu heiß wurde und sie unten keine Luft mehr bekamen. Dann sollte „schönes“ Wetter bevorstehen. Blieben sie im Glas unten sitzen, sollte Regen im Anmarsch sein. Und eine alte Bauernregel besagt: „Wenn im Mai die Laubfrösche knarren, magst du wohl auf Regen harren.“
Das Verhalten der Frösche und Kröten spielte bei unseren bäuerlichen Vorfahren als Wetterprophezeiung eine große Rolle. Besonders im Frühjahr, wenn Frösche und Kröten als „Frühaufsteher“ aus ihrer Winterstarre erwachten, wurden diese Amphibien als Wetterkundschafter angesehen, wobei häufig zwischen Fröschen und Kröten kein Unterschied gemacht wurde. Dies beweist auch die Redensart „einen Frosch im Hals haben“, vielfach bei uns abgewandelt „eine Kröte (Krott) im Hals haben“, wenn einer heiser spricht und nur noch „quaken“ kann.
Als die „Kersche“ noch „bockich“ waren
Wenn „Kersche“ „bockisch“ oder „wormisch“ sind, dann ist kein „Bock“ (im Volksmund beinlose Insektenlarven) und auch kein „Wurm“ drin, sondern die Made der Kirschfruchtfliege. Also sind solche Kirschen „madig“. Unreife Kirschen heißen im Volksmund „Quake“ oder „Quakerte“. Wer noch „grün“ hinter den Ohren ist, ist noch „unreif“, eben nicht erwachsen. So sollte auch der Pfingstquak, der heute noch im Ostertal (St. Wendel) nach uralten Riten gefeiert wird, den noch jungfräulichen Sommer herbeilocken.
„Kirschen in Nachbars Garten“ wurden früher von Jungen „gestrebbt“ oder „gestranzt“ („gestohlen“), weil sie eben besser schmeckten als die eigenen. Dabei musste man immer auf der Hut „vorm Schitz“ sein, der als Feldhüter die Fluren bewachte oder vor Frevlern „schützte“. Mit dem Dorfschütz war eben „nicht gut Kirschen essen“. Wurde man dann vom „Schitz“ erwischt, konnte man vor lauter Angst nur noch „quaken“, weil einem die Angst den Hals „zudrückte“. Wurden wir Buben beim Kirschenstranzen erwischt, kam am anderen Morgen der „Schitz“ in die Schule und „zeigte uns beim Lehrer an“. Hin und wieder gab es dann auch mal eine „Tracht Prügel“.
Die „Meikersche“ (Maikirschen) waren bei uns Jungen besonders beliebt, waren sie doch schon Ende des Monats reif. Es waren die ersten Kirschen, die uns anlockten. Doch da gab es auch einen „Kirschendieb“, der uns die Maikirschen immer „abpickte“. Es war der Pirol, der Pfingstvogel, dessen Lieblingsspeise eben Kirschen waren. Reife Kirschen wurden „gebrochen“, was pflücken bedeutet, aber „abbrechen“ heißt. Und sicherlich waren oben auf dem „Kerschbaam“ (Kirschbaum) noch ein Vogelnest mit einem „Quakerchen“ oder „Quakelchen“, was das Jüngste der Nestjungen war, eben das „Nesthäkchen“. Der Stein in der Kirsche ist im Volksmund der „Kerschekääre“, obwohl es kein Kern ist. Die „Kerschekääre“ wurden „ausgespauzt“ oder ausgespuckt. Im pfälzischen Dorf Altenkirchen gab es früher sogar einen Wettbewerb mit dem „Kirschenkern-Weitspucken“.
Die „Spatze- und Molkekersche“ schmeckten uns Jungen am besten und eben die schwarzen hoch oben im Baum, die von der Sonne „gebrannt“ waren. „Rote Kirschen ess ich gern, schwarze noch viel lieber …“
Die Kirschreife fiel früher immer mit der Heuernte zusammen, die oft zum Leidwesen der Bauern von schweren Gewittern begleitet wurde: Dann regnete es „Heigawwele“ (Heugabeln).
Mit der Schelle unterwegs: „Pass off, de Schitz kommt meddem Stecke“
„Es wird bekannt gemacht, dass Hausschlachtungen nur dann vorgenommen werden dürfen, wenn der Besitzer das Tier mindestens drei Monate im eigenen Stall gehalten und gefüttert hat. Jede Schlachtung bedarf andernfalls der Genehmigung.“ So wanderte der „Dorfschitz“ mit der „Schell“ in der Hand von Straße zu Straße im Dorf und rief seine Bekanntmachungen an die Bevölkerung aus. Die Menschen öffneten Fenster und Türen, um jedes Wort richtig verstehen zu können. Im Juli 1940 war es in Werschweiler „Feldschitz“ Karl Müller, der von 1933 bis ausgangs der 50er Jahre dieses wichtige Amt als Feldhüter und Ortspolizeidiener ausübte.
Dessen Vorgänger, so erinnern sich heute noch ältere Werschweiler Bürger, war Konrad Stoll. Im Februar 1953 „schellte“ Karl Müller weithin durch das Dorf, dass „aufgrund der letzten Untersuchung des staatlichen Instituts für Hygiene und Infektionskrankheiten das Trinkwasser hygienisch einwandfrei ist. Die bisherige Anordnung, das Wasser vor dem Genuss abzukochen, ist damit hinfällig.“
Der Dorfschütz von Niederkirchen machte am 9. Oktober 1952 den Tag der Obstversteigerung bekannt, der in früheren Jahren immer ein besonders Ereignis für die Ostertaler Bevölkerung war. Der Termin fiel immer auf den Selchenbacher Kirmessonntag. An der Gemarkungsgrenze in Werschweiler war vormittags Treffpunkt. Dann wurde Baum für Baum an den Meistbietenden versteigert. Natürlich war auch der Schitz dabei, der auf den regelmäßigen Ablauf der Versteigerung achten musste. Am Nachmittag war man dann in Selchenbach angelangt, und die Teilnehmer verbrachten dann den Rest des Tages auf der Kirmes.
Übrigens wird auch heute noch der Brauch der Obstversteigerung auf der Werschweiler Gemarkung durchgeführt, organisiert vom Obst- und Gartenbauverein. Vor dem „Schitz“ hatten die kleinen Dorfbuben auch Angst und einen Heidenrespekt. Mit dem „Schitzestecke“ (Stock) in der Hand, der Schirmmütze auf dem Kopf und dem Hund hinterdrein durchwanderte er Tag für Tag die Flure und achtete peinlich genau auf das, was sich aufc den Feldern, Äckern und Wiesen abspielte. „Pass off, de Schitz kommt mit dem Stecke“, wurden die Jungen von ihren Eltern bedroht, wenn sie was angestellt hatten. „Schitz“ kommt von „schützen“. Er war als Ortspolizeidiener auch zuständig für den Schutz der Felder, Wälder, Bachauen und Obstpflanzungen, eben der Gemeindefeldhüter. Feldfrevel wurde von ihm streng geahndet. Auch ich habe heute noch Erinnerungen an meine Kindheit, wenn uns Buben der „Schitz“ erwischte und dann verfolgte. Besonders zur Kirschenzeit waren wir vor ihm nicht sicher. Wir Jungen „stranzten“ besonders gerne die ersten „Maikirschen“.
Noch viel später, als ich als Junglehrer 1959 nach Hoof kam, wurde ich vom Leitersweiler „Schitz“ erwischt, als ich auf Leitersweiler Gemarkung auf der „Fröhn“ Brombeeren pflückte. Das durfte man nicht, so meinte jedenfalls „de Herrgott“, wie der Leitersweiler „Schitz“ im Volksmund genannt wurde. Als junger Mann war der spätere Werschweiler „Schitz“ Karl Müller, Feldhüter von 1933 bis 1959, Bergmann unter Tage. Er war dort im „Schlafhaus“ und als Koch berühmt. Natürlich war Karl Müller bei der jährlichen Bachschau als Feldhüter anwesend. Jeder Anlieger musste nach der Heuernte den Bach von Gestrüpp freimachen. Zur Inspektion kam eine Kommission mit dem Amtsbürgermeister, dem Ortsgendarmen und dem Feldhüter. Letzterer kannte die Parzellen genau. Wehe, wenn der Bachsaum nicht in Ordnung war! Der wurde gemaßregelt und musste binnen weniger Tage für eine Nachbesserung sorgen. Das Gebot, dass die Wiesen „zu“ waren, galt vom 1. April bis zum 24. Juni, dem Johannistag.
Auch bei der Aufteilung der „Rodhecke“ war der „Schitz“ der wichtigste Mann im Dorf. Er teilte sie in Schneisen auf, die er mit Stangen abmaß und kennzeichnete die die Schneisen mit Nummern. Der „Schitz“ achtete darauf, dass bis zum Johannistag die eingeteilten Parzellen in der „Rodheck“ als Stangenholz und „Fache“ (Reisigbündel) abgefahren wurde. Dann ging der Förster mit dem Feldhüter durch die „Rodheck“, ob auch die Wurzelstöcke ordnungsgemäß herausgeschlagen waren.
Ganz früher hatte der Dorfschütz auch die Aufgabe, darauf zu achten, dass bei der Bekanntmachung im Dorf die Fuhrwerke mindestens 60 Meter vor ihm anhielten, damit der Lärm nicht störte. Im Krieg hatte der Feldhüter eine weitere Aufgabe: Tag für Tag kloppte er die Kartoffelkäfer ab und passte auf, dass keine „Grombiere“ (Kartoffeln = Grundbirnen) geklaut wurden. Er musste auch bei der Zwangsablieferung von Kartoffeln beim Verladen in den Waggon dabei sein. Im Herbst 1944 wurden auf dem Werschweiler Bahnhof 212 Zentner Kartoffeln abgeliefert. Im Krieg musste der „Schitz“ auch das Getreide nach dem Dreschen abwiegen, denn ein bestimmter Prozentsatz musste abgeliefert werden. Bei den Hausschlachtungen wog er das Fleisch. Pro Person war ein bestimmtes Kontingent für den eigenen Hausverbrauch erlaubt. Was darüber hinausging, musste abgeliefert werden. Und am frühen Morgen ging der „Schitz“ durchs Dorf und schellte lauthals aus: „Heute Mittag um zwei Uhr gibt es in der Wirtschaft Ulrich die Lebensmittel- und Kleiderkarten.“ Immer gab es für den „Schitz“ einen Trunk Wein dazu, wenn er im Dorf ausschellte, zum Beispiel sein Getreide gegen Hagel versichern zu lassen. Am Dorfende stand er dann oft auf wackeligen Füßen.
Vom Großknecht und vom Kleinknecht auf dem Bauernhof
Der Großknecht war die erste Kraft und der Vertreter des Herren auf dem Bauernhof. Wenn er „gedingt“ (gemietet) wurde, dann musste er ein gesetztes Alter haben. Er durfte nicht unter 25 Jahre alt sein, und musste länger schon als Klein- oder Mittelknecht auf Höfen gedient haben, bevor von ihm erwartet werden konnte, die ihm obliegenden Arbeiten zum Vorteil seiner Herrschaft auszuführen. Wer geistig oder körperlich etwas zurückgeblieben war, konnte natürlich den Platz als Großknecht nicht einnehmen, er musste seine arbeitsfähige Zeit als Kleinknecht dienen. Bei dem Großknecht war es sehr wichtig, dass er morgens pünktlich wach wurde. Nicht jeder hatte damals schon eine Weckuhr. Der Großknecht hatte nach dem Erwachen für Licht und Feuer zu sorgen. Dafür hatte er einen Zunder, einen Feuerstein, Stahl- und Schwefelsticke. Fing der Zunder durch Streifschläge auf dem Feuerstein, als aus einem Funken an zu glimmen, dann hielt man einen Schwefelsticken daran, und daraus bildete sich eine Flamme. Diese wurde an den in Rüböl getränkten Docht des anzusteckenden Lichtes gehalten, bis das Öl zum Sieden kam und sich zur Leuchtflamme entfaltete. Petroleum war damals noch sehr rar, es gab es erst so seit 1920. Hatte der Knecht nun licht, dann musste er für die Pferde das Futter auf der Lade, auch Zappelbock genannt, am ganz frühen Morgen schneiden. In dieser Zeit fütterte er auch die Pferde und weckte den Kleinknecht zum Putzen der Pferde und die Mägde zu ihrer Morgenarbeit.
Beim Pflügen hatte der Großknecht sämtliche Ackerstücke zu furchen. Seine Aufgabe war es auch, das gesamte Korn auf die Furche breitwürfig auszusäen. Der Bauer selbst und sein Kleinknecht hatten mit Eggen zu tun. In der Ernte musste der Großknecht vorweg mähen und vor Sonnenuntergang mit der Sense schon einen Teil zu Boden gelegt haben. Im Winter wurden abwechselnd Mist, Erde und Holz gefahren. Es wurde aber die meiste Zeit mit dem Flegel gedroschen.
Abends wenn die Frauen und Mägde spannen, der Kleinknecht die Pferde fütterte und das Kuhfutter schnitt, musste der Großknecht auf der Rolle Stricke aus Grobhede spinnen. Man benötigte sehr viele Stricke zum Anbinden der Kühe und Pferde, sowie für Stränge an Wagen-, Pflug- und Eggenschwengel.
Der Knecht ging sogar an den langen Winterabenden mit Rolle und Hede ins Dorf. Zugleinen, Gartenstricke, Sackbänder, Garnstricke für die Egge, Kuhstricke sowie sämtliche Pflug- und Eggenschwengel wurden an den Sonntagnachmittagen gemacht. Das war eine Arbeit für drei Personen, gewöhnlich für den Bauern, den Groß- und den Kleinknecht. Mittagspause gab es nur während der Mähtage in der Ernte. Selbst an Feiertagen, außer der Zeit d es Gottesdienstes, wurde gearbeitet. In der Mittagspause während der Ernte tranken die Mägde ihren Ziggoriekaffee. Der Bauer trank in der Regel ein Malzbier.
Meine Mutter war als Magd beim Bauer Nauhauser beschäftigt. Dort arbeitete in den letzten beiden Kriegsjahren eine polnische Magd, die von den Nazis deportiert worden war. Die Polin war eine sehr fleißige Magd. Meine Mutter sagte mir viele Jahre später, dass sie wohl merkte, was sich da hin und wieder in der Tenne abspielte. Bauer und Magd hatten eine Liebelei, damals durfte das natürlich bei Strafe nicht sein. Polinnen waren ja keine Arier. Und wie es dann der Zufall wollte: Kurz nach dem Krieg heirateten die beiden.
Ganz früher wurde noch das Korn in der Winterzeit mit dem Flegel gedroschen, der Roggen mit Hilfe der Tagelöhner. Die Abend- oder Abarbeit des Kleinknechtes bestand darin, dass er die Schafe abfütterte und den Stall verschloss. Darauf musste er Stroh, Heu und Spreu für das Vieh für den nächsten Tag aus der Scheune hereinholen und auch ein paar Bunde Sommerstroh zum Abfüttern den Kühen vorgeben.
Der Kleinknecht war wirklich der Sündenbock auf dem Hofe, denn nicht nur der Bauer, sondern auch der Großknecht hatte ihm zu befehlen. War aber mal was beim Fahren in Unordnung geraten oder passierte hier und da mal ein Malheur, so hatte der Junge Schuld, obwohl er in manchen Fällen unschuldig war.
Vom Aberglauben im Ostertal
Das sittliche Leben der Ostertäler war von jeher ein ziemlich gutes zu nennen, auch im 17.Jahrhundert. Weltliche Vergnügen, wie Tanzen, Kartenspiel, Kegeln waren durch Friedrich Ludwig strengstens verboten. Die Ostertäler wussten sich gemäß zu helfen, da ihnen in den benachbarten nassauischen Orten Werschweiler und Dörrenbach, wie in den kurpfälzischen Orten Frohnhofen und Altenkirchen die Tanz- und Kegelplätze offen standen. Dort waren solche Vergnügungen erlaubt.
Die Schulbildung im Ostertal war bis zur Einführung des Schulzwanges (Anfang des 19. Jahrhunderts) sehr mangelhaft. Die wenigsten Gemeindeglieder genossen Unterricht. Besonders das „weibliche Geschlecht“ war fast durchweg ohne Kenntnis des Schreibens und Lesens.
Noch in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde im Ostertaldorf Hoof „gebraucht“. Der Arzt wurde nur im äußersten Notfalle zu Rate gezogen, fast immer, wenn es zu spät und der Kranke nicht mehr zu retten war. Besonders häufig wurden kranke Kinder „gebraucht“, wenn sie im Winter unter fieberhaften Erkältungen litten.
Auch unsere Ahnen in Hoof versuchten mit alten Hausmitteln, mit „Brauchen“ und anderen geheimnisvollen Zaubertränken die Krankheiten zu vertreiben.
Fast in jedem Dorfe, so auch in Hoof und in Niederkirchen, gab es jemand, der das „Brauchen“ verstand. (Anmerkung: Ich selbst erinnere mich noch an meine frühe Kindheit in den Kriegsjahr en des Zweiten Weltkrieges in Steinbach bei Ottweiler, als noch das „Brauchen“ auch an mir ausgeübt wurde. Wenn ich Fieber hatte, Bauch- oder Kopfschmerzen, ging meine Mutter mit mir zu meiner Urgroßmutter. Sie legte ihre Hände auf meine Schläfe und sprach einige für mich unverständliche Worte. Und seltsam! Nach dem „Brauchen“ fühlte ich mich gesund.)
Im Ostertal war es in den 1880er Jahren noch so, dass ein Mann das „Brauchen“ am Vieh und eine alte Frau das „Brauchen“ am Menschen ausübte. So wird auch in der Pfarrchronik in Niederkirchen berichtet, dass eine Marther Mutter mit ihren zwei Kindern nach Hoof ging, wo eine alte Frau in der „Aacht“ das „Brauchen“ pflegte. Nach einiger Zeit kam das heraus und der Pfarrer in Niederkirchen verhängte die Kirchenzensur an die Marther Frau.
Auch von alten Hausmitteln wird berichtet. Hilfe vor „blöden Augen und Ohren“: „Nimm ein rein Blatt von Zinn oder Kupfer, beräuchere es, schreibe darauf mit Milch von einer Frau, so ein Knäblein geboren und den 7. Tag im Kindbette liegt, also. „Ein Ohr, dass da höret, ein Auge, dass da sehet, werden beide von Adonay gemacht.“ „Lasse es von sich selbst trocknen, dann wische es ab mit reinem Mandelöl, salbe damit die Augenlider oder lasse es in die sausenden Ohren tropfen, tue es sieben Tage, siebenmal am Tage und Du wirst Wunder erleben.“
Für die Gelbsucht bei Menschen: „Nimm Holderwurzeln, die mittlere Rinde, schabe sie und siede sie und gib den Menschen alle zwei Stunden zwei oder drei Esslöffel voll und sechs Morgen und Abend hintereinander.“
Um gestohlenes Gut wieder zu bringen: „Schreib auf 2 Zettelchen folgende Worte, lege das eine über die Tür und das andere unter die Türschwellen, da kommt der Dieb am dritten Tag und bringt den Diebstahl: „Abraham hat gebunden, Isaac hats erlöst, Jakob hats heimgeführet, es ist so fest gebunden als Stahl und Eisen, Ketten und Banden.“
Aus der Pfarrchronik in Niederkirchen wissen wir, dass auch mit Wünschelruten nach verborgenen Schätzen gesucht wurde. Am 4. April 1693 wurden mehrere Gemeindeglieder von Hoof und Marth von der Kirchenzensur zu Niederkirchen bestraft, weil sie in der Wiesenaue des Betzelbachtales zwischen Hoof und Marth mit einer Glücksrute auf Schatzsuche waren.
Am 2. August 1671 wurde von der Censur vorgebracht, „dass Junge unter den Zuhörern das abergläubische „Gurgelfingerhalten“ praktizierten.“ Es wurde ihnen geboten, sich für solchen abgöttischen Wahn in Zukunft straff zu hüten.
Der Glaube an Zauberei und Hexerei war natürlich ebenso verbreitet. Am 3. Februar 1697 wurde Jakob Becker aus Hoof exkommuniziert, weil er „einer Zauberei nachgegangen war“, und weil er seinen Wahn nicht einsehen wollte. Als er aber um Verzeihung bat, wurde er am 3. Mai 1697 „absolviert“. Dementsprechend gab es auch Hexen im Ostertal. . Einmal wurden in einem Hexenprozess drei Sitzungen abgehalten, bei denen zum Teil alles in ziemlicher „confussion“ vorgebracht wurde. Die „Deliquenten“ mussten zu guter letzt „dygnocieren“ (Abbitte leisten). „Die Klägerin, der ihr Kleid an einigen Ecken war verschnitten worden, und die Stücke zu zauberischem Beruf verwendet worden, sich nachträglich beim Oberamt beschwerte, das die Schuldigen um 5 Fladen strafte, so ist das für eine einzig boshaften und unersättlicher Boshaft an der Klägerin gehalten worden.“
Von der Bullenzucht früher im Bauerndorf
Noch heute erinnern sich die ältesten Hoofer Bürger an die Zeit zurück, als der Landwitrt Reinhard Koch als Bullenzüchter weithin bekannt war. der „Stierstall“, im Dorfmund auch „Bockstall“ genannt, befand sich an seinem Bauernhaus auf dem „Nebenhügel“, wo Reinhard Koch bis Ender der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts die Bullenzucht betrieb. Und sein Sohn Kurt Koch muss heute noch schmunzeln, wenn er an diese Zeit zurückdenkt: „Natürlich waren wir kleine Jungen auch neugierig, was sich dort abspielte. Wir haben immer wieder „gespitzt“, doch verjagte man uns. Und bestialisch hat es dort gestunken.“

