Von der Weisheit und vom Brauchtum unserer bäuerlichen Vorfahren
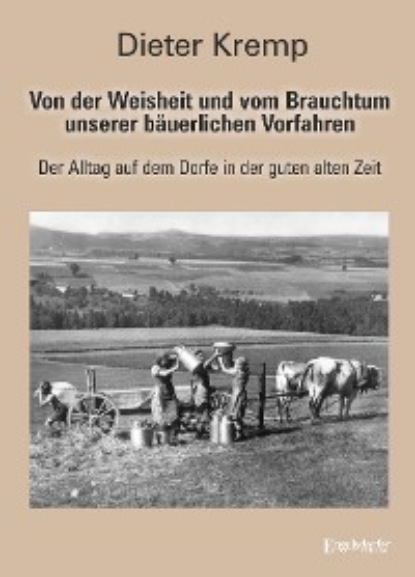
- -
- 100%
- +
Von der Errichtung bis zur endgültigen Inbesitznahme eines Gebäudes muss ein ganzer Komplex von mehr oder weniger wichtigen Riten beachtet werden, die nicht nur die jeweilige Familie angehen, sondern auch die meisten Dorfbewohner. Die Einfügung eines neuen Gebäudes in die dörfliche Siedlung darf nicht das Gleichgewicht stören, in das dieses bereits bestehende Gebilde eingebunden ist. Auf keinen Fall darf dieses neue Gebäude als völlig selbstständiges Gebilde betrachtet werden; es steht in unmittelbarer Abhängigkeit von den anderen Häusern, so wie von ihm wiederum eine gewisse Wirkung auf das Dorf ausgeht.
Zwei alte Bräuche zeigen sehr gut die Wechselbeziehung zwischen den Häusern und natürlich mehr noch die zwischen den einzelnen Familien. Der erste betrifft die jährliche Segnung der Häuser. Kein einziges Haus durfte dabei ausgelassen werden, weil sonst das ganze Dorf darunter hätte leiden müssen. Man konnte deshalb nicht zulassen, dass sich auch nur ein einziger Dorfbewohner nicht an die Regel hielt. Der zweite Brauch war noch zu Anfang des 20.Jahrhunderts lebendig. Sobald ein Haus fertig gestellt war, fanden sich in der Nacht zum Sonntag eine Reihe von Freunden der Besitzer vor dem Haus zusammen, gaben unter den Fenstern des Hauses einige Gewehrschüsse ab und fragten die Bewohner, ob sie einen Scheiterhaufen wollte, Am darauffolgenden Sonntag errichtete man vor der Haustür einen Holzhaufen, aus dem ein langer Mast herausragte; man setzte ihn in Brand, und alle Bewohner des Dorfes tanzten darum herum. Diese Willkommenszeremonie für die neuen Dorfbewohner zeigt sehr gut die Bedeutung, die der Aufnahme neuer Mitglieder in die Dorfgemeinschaft beigemessen wurde.
Gegenstände mit schützenden Eigenschaften im und am Bauernhaus sowie heilige Tiere und Pflanzen
Das Tier, ob domestiziert oder wild, ob nun fern vom Haus oder mehr oder weniger ständig darin wohnend, fungiert im Alltagsablauf unserer bäuerlichen Vorfahren als Träger von Zeichen, als Todes- oder Freudenbote. Der Bauer teilte die magisch bedeutsame Tierwelt in die glückbringenden Tiere und andererseits in die unheilbringenden Tiere ein.
Katze, Kröte und Kauz gelten in den volkstümlichen Vorstellungen als Unglücksbringer. Zu allen Zeiten glaubte man, dass vor allem die schwarze Katze vom Bösen besessen sei. Sie war das Tier des Teufels, das Tier, das bei den Sabbaten zugegen ist. Auch ist das Erscheinen einer Katze unter gewissen Umständen ein unheilbringendes Vorzeichen. Die Hauskatze ist in gewisser Weise der gebannte Zauber, der gezähmte Dämon. Ein Aufnahme- und Reinigungsritus erlaubt, sie ins Haus und in den Familienkreis aufzunehmen. Wie dem auch sei, die Katze symbolisierte in den meisten Gegenden die Seele des Hauses. Ihr Tod, vor allem wenn er sich im Innern des Hauses ereignet, wird als Vorzeichen großen Unglücks für die Familie betrachtet. Die ambivalente Natur der Katze spiegelt sich auch in dem zwiespältigen Schicksal, das ihr bestimmt ist. Selbst wenn sie ins Haus hineindarf – sie ist häufig das einzige Tier, dem dies erlaubt wird – bleibt sie dennoch eines der Tiere, die beim Hausbau und bei rituellen Festen geopfert wird. Noch im späten Mittelalter wurden Katzen oft in das Johannisfeuer geworfen. Mit Hunden ging man meist glimpflicher um. Nur der schwarze Hund flößt echte Furcht ein. Man empfahl, einen solchen Hund zu töten und mit seinem Blut die Mauern des Hauses zu besprengen, aus dem man die Dämonen vertreiben wollte.
Der Hahn, Symbol der Wiederauferstehung und der Wachsamkeit, von dessen morgendlichem Krähen man glaubte, dass es die Dämonen und die Geister der Nacht vertreibe, fand man häufig als Wetterhahn nicht nur auf Kirchtürmen, sondern auch auf Bauernhäusern.
Ein Unglücksbringer ersten Ranges ist die Kröte. Sie ist das verfluchte Tier schlechthin, das Tier der Schatten, das Tier des Teufels, der sich den Menschen häufig in dieser Gestalt präsentiert. Es gab den Brauch, eine Kröte unter der Schwelle des Hauses einzumauern. Die Kröte war auch ein wichtiger Bestandteil der unheilvollen Absude und Tränke der Hexen, zum anderen aber auch bedeutsam für die Behandlung von Rheuma oder Geschwüren. Man band sie lebend auf das erkrankte Körperteil; zur Fieberbekämpfung schloss man sie in einem kleinen Säckchen ein, das man um den Hals trug.
Die schwarzen Vögel, Rabe und Elster, hatten unter den magischen Tierbräuchen zu leiden. Ihre Opferung – sie wurden im allgemeinen mit einem Bein an einer Kordel in der Mitte des Hofes aufgehängt – entspricht dem tödlichen Drama, das sie mit ihrem Erscheinen in der Nähe des Hauses angeblich ankündigen.
Der Storch und die Schwalbe dagegen – die man auch Gotteshuhn nannte – galten überall als Symbole für Wohlergehen, Glück und Erfolg von Haus und Hof. Ihre regelmäßige Rückkehr zur schönen Jahreszeit, ihre Treue zum Nest mögen der Grund für diese Vorstellungen sein. Sie waren die vom Volk verehrten Tiere schlechthin, man schützte sie und half ihnen, sich auf dem Bauernhaus niederzulassen. Besonders dem Storch sagte man nach, dass er um jeden Preis die Tugend der Hausfrau schütze, wenn es sein muss, auch gegen ihren Willen. Storch und Schwalben symbolisieren auch die soziale Eintracht, die Dauerhaftigkeit der Beziehung des Paares.
Das Ei genoss bei unseren bäuerlichen Vorfahren im religiösen Brauchtum ganz besondere Verehrung. Es steht im magischen Arsenal der traditionellen bäuerlichen Welt an vorderster Stelle. Es ist ein Werkzeug des Hexers, der sich seiner bedient, um die Ernten zu zerstören: findet man zerschlagene Eier an den Rändern eines verwüsteten Feldes, so darf man Hexenwerk darin sehen. Aber das Ei stellt seine Macht auch in den Dienst des Guten: Je nach Gegend, glaubt man von den Eiern, die am Gründonnerstag oder am Himmelfahrtstag gelegt worden sind, dass sie niemals faulen und mit zuverlässiger Gewissheit Gewitter, Feuersbrunst, Krankheiten und Zauberei abwenden. Damit sie diese schützende Rolle übernehmen konnten, legte man sie aufs Fenstersims, in einen Türwinkel oder man fügte sie gar ins Mauerwerk ein.
Das Hufeisen gehörte wie der Spiegel oder die Nägel zu den magischen Hilfsmitteln, die das Haus vor den Übergriffen des Bösen schützen sollten.
Pflanzen hatten seit jeher eine schützende oder heilende Kraft. Die Haus- oder Dachwurz, auch Donnerwurz genannt, und all die kleinen, ihr verwandten Fettgewächse, wie etwa auch der Mauerpfeffer, bewahren seit undenklichen Zeiten die Gebäude und besonders die so gefährdeten Strohdächer vor Gewitter. Die Distel, die Sonnenpflanze schlechthin, eine magische und dekorative Pflanze, nagelte man in Berggegenden häufig an die Haustüren. Die Ährenbüschel wiederum, die zu kreuzen gebunden über den Scheunentoren, über dem Rauchfang oder gar über dem Ehebett als Glücksbringer und Unterpfand für künftige Ernten hängen, sind eine echte Opfergabe an die Mächte der Natur.
In vielen Gegenden genossen die in der Johannisnacht (24. Juni) gesammelten Pflanzen eine besondere Verehrung. Aufgrund ihrer ausgeprägten magischen Kraft werden Farn, Nussbaumblätter und vor allem Johanniskräuter deshalb zu Kränzen geflochten, gebündelt und über den Türen und Fenstern des Hauses aufgehängt, sowie in Scheunen und Ställen. Die katharische Kraft des Johannisfeuers, über das die ganze Dorfbevölkerung in der Johannisnacht sprang, erstreckte sich übrigens auch auf die Herdentiere; in manchen Gegenden rieb man den Schafen oder den gehörnten Tieren mit der Asche des Scheiterhaufens die Seiten ein. Die Wirksamkeit des zur Sommersonnenwende verbrannten Holzes ist auch dem zur Wintersonnenwende verbrannten eigen. Als Mittel gegen Gewitter pflegte man auch Johanniskräuter ins Feuer zu werfen und sie an Scheunen aufzuhängen.
Seltsamerweise soll der Maibaum, den man in den Mist stellt, die Schlangen vertreiben können. Man sagte: „Er hindert die Schlangen, den Kühen die Milch abzusaugen.“
Es gab auch eine Reihe von Gegenständen, die man mit großem Respekt behandelte. Auf den ersten Blick unerklärbar erscheint die Gleichsetzung der Steinaxt oder der Pfeilspitze mit Donner und Blitz. Doch trug bei den Germanen schon Thor, der Donnergott, Sohn Odins, diese Axt. Man glaubte lange Zeit hindurch, dass der Donner durch den Zusammenprall zweier kugelförmiger Steine aus konzentriertem Staub entstehe, und dass die so seltsam geformten Steine als Überbleibsel dieses „Unfalls“ auf die Erde herabfielen.
Ebenso wie das prähistorische Werkzeug als Gegenstand gedeutet wird, der die verschiedensten magischen Eigenschaften besitzt, unterlegt man in manchen Fällen auch den Werkzeugen und Geräten des täglichen Lebens apotropäische Eigenschaften. So stellte man vielerorts, wenn ein Gewitter drohte, eine Sense mit der Schneide gen Himmel gerichtet auf die Schwelle des Hauses, um es vor dem Blitz zu schützen; in manchen Gegenden nahm man dafür eine Axt. Man muss in diesem Fall hervorheben, dass diese Werkzeuge, abgesehen davon, dass sie aus Eisen, dem magischen Metall, sind, einen speziellen Symbolcharakter haben. Die Sense ist das Zeichen des Todes und die Axt das Utensil des Donnergottes.
Der Holzschuh war seit eh und je eng mit der Fruchtbarkeitsvorstellung verbunden, deswegen befestigte man ihn auch am Hochzeitsbaum. Jene Holzschuhe, die man so häufig aufgehängt an den Hauseingängen findet, sind vielleicht die Hochzeitsschuhe, die das Paar sorgsam bis zur Geburt des ersten Kindes aufbewahrt und sogar weitervererbt.
Das Rad ist seit den frühesten Zeiten der Menschheit ein Sonnensymbol. Es war auch früher Bestandteil vieler bäuerlicher Bräuche. Das Wagenrad wurde früher häufig an Bauernhäusern als zusätzliche Hofeinfassung benutzt. Manchmal waren es regelrechte Zäune aus Wagenrädern, die den Hof eingrenzten.
Ein sehr geachteter Beruf war früher der Hufschmied, und so ist es auch wohl zu verstehen, dass das Hufeisen ein Glückssymbol darstellte. Es zierte die Wände der Bauernhäuser – auch Schutzzeichen, die in die Mauern eingemeißelt wurden.
Sitten und Bräuche der Volksgemeinschaft im Wandel eines Jahres
Gehen wir die vier Jahreszeiten durch, so stoßen wir immer wieder auf Ruhe- und Haltepunkte, die Volksfeste, deren Verlauf sich in altgewohnten Formen bewegt.
Der Jahreswechsel ist nicht nur ein Markstein im Leben des einzelnen, sondern auch im Leben der Dorf- und Volksgemeinschaft. Nach dem Abendgottesdienst, in dem Gott der Dank für die Wohltaten des abgelaufenen Jahres gespendet wird, begibt sich der größere Teil der Jünglinge und Männer in die Wirtschaft. Wenn die Kirchenglocken das neue Jahr einläuten, wünscht man sich gegenseitig Glück und Gesundheit im neuen Jahr. Die jungen Burschen haben schon rechtzeitig vorher die Dorfwirtschaft verlassen, um ihrer Braut „das neue Jahr anzuschießen“. Auf die drei Schüsse folgt ein Spruch, der folgendermaßen lautet: „Ich wünsche euch ein glücklich neues Jahr, neues Glück und neues Leben, darauf soll es Feuer geben.“
Die Kinder wünschen ihren Eltern und ihren Paten am nächsten Morgen das neue Jahr an mit folgenden Worten: „Guten Morgen im neuen Jahr! Euch wünsche ich ein glückseliges neues Jahr, lang zu leben und glücklich zu sterben und den Himmel zu erwerben.“
Es gibt aber auch den Neujahrsspruch: „Ein glückselig neues Jahr, eine Brezel wie ein Scheunentor, ein Lebkuchen wie eine Ofenplatt, dann essen wir uns alle satt.“
Die Paten schenken ihren Patenkindern eine große Brezel oder einen Kranzkuchen. Die Leute, die sich auf der Straße begegnen, rufen sich zu: „Prost Neujahr!“ oder „Viel Glück im neuen Jahr!“
In manchen Gegenden hat sich der Brauch des „Dreikönigssingens“ oder des „Sternsingens“ bis heute noch erhalten. Ein wichtiger Tag im Leben des Bauern ist der 2. Februar, Mariä Lichtmess. Dieser Tag ist für ihn das Ende der Winterarbeit. Ein alter Bauernspruch lautet: „Mariä Lichtmess, das Spinnen vergess!“
Maria Lichtmess war in katholischen Gegenden früher ein allgemeiner Feiertag, an dem die Kerzen geweiht wurden. Zu gleicher Zeit segnete der Priester den Hals der Gläubigen, weil am 3. Februar der Tag des Heiligen Blasius ist, dessen Fürsprache gegen Halskrankheiten schützen soll.
Im Februar beginnt auch die Fastenzeit. Ihr voran gehen Maskenfeste, Maskenumzüge am Fastnachtssonntag. Die Kinder laufen an den Fastnachtstagen verkleidet, „verboozt“, auf der Straße herum. Der größte Trubel herrscht am Fastnachtsdienstag in den Wirtschaften. Am Aschermittwoch wird in vielen Dörfern die „Fastnacht begraben“. Die Burschen ziehen mit einer Strohpuppe, der Fastnacht, durch das Dorf, abwechselnd Trauerlieder oder lustige Litaneien singend. Dann wird auf einem freien Platz vor dem Dorfe eine Leichenrede gehalten und die Puppe unter großem Hallo verbrannt. In ähnlicher Weise wird auch mancherorts die „Kirmes begraben“. Während der Fastenzeit herrscht im Dorf große Stille.
Neues Leben bringt erst der Palmsonntag, wenn in der Kirche „Palmen“ (Buchsbaum) geweiht werden. Manche Bauern stecken noch heute einen geweihten Palmzweig in die Scheune, in den Stall oder auf jedes seiner Ackerstücke. Als Vorbote des Osterhasen erscheint dann auch der „Palmhase“, der den Kindern in ein vorbereitetes Nest seine im Kaffee gefärbten Eier legt.
Vom Gründonnerstag ab läuten die Kirchenglocken nicht mehr, es sei denn, es ist im Dorf jemand gestorben. Die Glocken „sind in Rom“ und kehren erst am Ostersonntag wieder zurück. Die Gläubigen müssen daher auf andere Weise vom Beginn des Gottesdienstes in Kenntnis gesetzt werden. Dies besorgen die „Klepperbuben“. Mit Holzklappern laufen sie durchs Dorf und rufen: „Wer in die Kirche geht, der läuft jetzt.“ Wenn das Kleppern am Ostersamstag zu Ende ist, gehen die Klepperbuben von Haus zu Haus, sammeln Eier und Geld ein und verteilen die Gaben unter sich. Dann kleppern sie noch einmal am Ostersonntag morgen s in der Frühe und rufen dazu im Sprechchor: „Auf – auf! Zum heiligen Grab!“
In der Nacht vom Ostersamstag auf Ostersonntag kommt der Osterhase und bringt den Kindern die Ostereier.
Nun ist die Fastenzeit zu Ende und frohe Feste können wieder beginnen. In der Walpurgisnacht, der Hexennacht, der Nacht zum 1. Mai, ist der Dorfjugend reichlich Gelegenheit geboten, sich übermäßig auszulassen. Türen werden ausgehängt, Pflüge, ja selbst ganze Kleinwagen auf die Dächer gesetzt, Puppen in den Hausflur gestellt und ähnlicher Hexensabbat getrieben. In einigen Ortschaften errichten die Burschen ihren Liebsten in der Walpurgisnacht Maibäume, in anderen Orten wiederum schmücken sie die Dorfbrunnen mit Birkenreisern.
Pfingsten ist das beliebteste Fest. In einigen wenigen Dörfern schmücken die Burschen den Pfingstquak. Dies ist ein hölzerner großer Zylinder, der von außen mit frischem Laubwerk geziert wird. Mit diesem Pfingstquak zieht die junge Welt von Tür zu Tür und sammelt Eier und Speck. In anderen Gegenden, ehe dort eine Wasserleitung bestand, reinigten die Mädchen in der Nascht auf Pfingstsonntag den Dorfbrunnen, und die Burschen errichteten den Pfingstbaum, den sie mit bunten Bändern schmückten.
Die altdeutschen Sonnwendfeiern haben sich in unseren Johannisfeuern erhalten. Selbst in den Städten sind Sonnwendfeiern wieder aufgelebt und haben beim Volk viel Anklang gefunden. In einigen Orten ist auch noch das Radbrennen Brauch. Nach den Tagen fröhlichen Schabernacks und ausgelassener Festesfreude kommen Tage der ernsten Besinnung: Allerseelentag und Totensonntag. Alt und jung zieht an diesen Tagen zu den Friedhöfen, um in ganz besonderer Weise der Toten zu gedenken. Früher gab es auch noch Trauerkundgebungen an diesen Tagen mit dem Gedenken an die im Weltkrieg Gefallenen und in fremder Erde Ruhenden.
Noch einmal kommt die Volksfreude zum Durchbruch an den Kirmestagen. In der Regel ist der Tag der Kirchweihe der Kirmestag. Auf dem Lande wird die Kirmes sehr ausgiebig gefeiert. Es war früher vornehmlich ein Fest in der Familie für die Verwandten aus den Nachbardörfern. Es wird ein großes „Imbs“ gehalten mit Rindfleischsuppe, Rindfleisch und Meerrettich. Später gibt’s Kaffee und reichlich Kranzkuchen. Die kleineren Kinder haben ihre Freude an den „Reitereien“, am Kirmeskarussell und an den Zuckerbuden auf dem Kirmesplatz. Die Jugendlichen gehen zum Tanz. In der gleichen Weise wird der Martinitag gefeiert, der für manche katholische Gemeinden der allgemeine Kirchweihtag ist. Der Bauer schlachtet sein erstes Schwein und veranstaltet ein großes Schlachtessen, zu dem auch der Dorfschulmeister eingeladen wird.
An Kirmestagen wird auch in manchen Ortschaften der Hammel („Hammelskerb“) oder ein Kranz herausgetanzt. In einigen Dörfern führt man auch den Quak herum und begräbt am Kirmesdienstag die Kirmes.
Am 5. Dezember kommt der Nikolaus. Er zieht von Haus zu Haus und verteilt an die braven Mädchen gebackene Puppen und an die braven Knaben Hasen, dazu Äpfel und Nüsse. Oft zeigt sich auch in der Begleitung des Nikolaus die sogenannte „Himmelsgeiß“. Sie wird dargestellt von zwei Personen, die sich in ein Leintuch hüllen und als Hörner eine Heugabel zeigen.
Wenn Weihnachten naht und der Abendhimmel golden strahlt, sagen die Mütter zu ihren Kindern: „Das Christkindchen backt Plätzchen.“ Die Kinder singen in der Vorweihnachtszeit: „Christkind komm in unser Haus, leer’ dein goldnes Säckelche aus, stell dein Eselche auf die Mist, dass es Heu und Hafer frisst.“
Am Weihnachtsabend bringt das Christkindchen den Kindern Spielzeug und wie der Nikolaus gebackene Puppen, Hasen, Nüsse und Äpfel. („Äpfel, Nüss’ und Mandelkern essen brave Kinder gern…“) Auch die Erwachsenen beschenken sich gegenseitig, dem Zug der Zeit folgend, fast durchweg mit nützlichen Gegenständen, die auch bei den Kindern mehr und mehr den Platz unnötiger Gaben einnehmen.
In abgelegenen Orten trifft man ab und zu noch den Glauben, in der Weihnachtszeit ginge der Werwolf um, und der Teufel säße auf den Schornsteinen. Zwischen Weihnachten und Neujahr liegen die heiligen Nächte. In ihnen krächzt der Unglücksrabe, und das wilde Heer braust durch die Lüfte.
Wie meine Großmutter noch die „schäle Migge“ vertrieb
Stechmücken und Bremsen wahren bei unseren Vorfahren auch „verpennt“ (unbeliebt, verhasst). Ursprünglich bedeutete „pennen“ in der Gaunersprache „in einer Spelunke übernachten, schlafen“, und „pennen“ im Volksmund heißt „zu ungewöhnlicher Zeit schlafen“: „Der pennt die ganze Zeit.“ Ein „Penner“ war auch ein Obdachloser, der auf der Straße eben „pennte“. Und die Stechmücken sollten sich „verpennen“ (verziehen). Vor den stechenden und blutsaugenden Weibchen war keiner von uns sicher, wenn man sich bei schwüler Witterung im Freien aufhielt. Vom Schweiß des Menschen werden sie besonders angelockt. Hatte man „sießes Blud“ ( süßes Blut), so lockte man die Plagegeister besonders an. Im Gegensatz zu den nicht stechenden Mücken und Fliegen hießen die Stechmücken auch „schäle Migge“ (scheele Mücken). Und was tat der Bauer an schwülwarmen Sommertagen, wenn er mit seinen Pferden draußen auf dem Acker war und diese vor Bremsen schützen wollte? Er steckte Farnkräuter in das Kummet, das sollte die Stechmücken vom Pferdekopf abhalten. Und das stimmte! Meine Großmutter kannte eine Vielzahl von Pflanzen, deren ätherische Ausdünstungen Stechmücken abwehren. Lavendel war für sie das beste Mittel, die Plagegeister vom Menschen und von der Wohnung abzuhalten. Man betupfte sich an gefährdeten Körperstellen mit Lavendelöl oder rieb sich mit den aromatischen Blüten ein. Die abwehrende Wirkung hielt bis zu acht Stunden an. Großmutter stellte aber auch Lavendel in einer Blumenvase in die „gudd Stubb“, um die „schäle Migge“ dort abzustecken. Die Lavendelsäckchen in den Kleiderschränken unserer Vorfahren hatten zudem noch einen anderen Zweck: Der wohltuende Duft erfüllte den ganzen Raum und führte zu einem geruhsamen Schlaf, hielt aber auch die Motten von den Kleidern ab. Auch ein Lavendelsäckchen unterm Kopfkissen im Bett führte zu einem erholsamen Schlaf.
Auch Ameisen mögen Lavendel nicht und machen einen weiten Bogen um das Kraut. Die ätherischen Öle der Zitronenmelisse haben eine ähnlich gute abschreckende Wirkung auf Stechmücken. Schließlich gab es damals auch noch in jedem Bauerngarten das Mutterkraut, im Volksmund auch „Mottenkraut“ genannt. Ein Strauß davon in der Vase in der „gudd Stubb“ vertrieb die „schäle Migge“ und die Motten.
Auf unserem Hof stand früher ein Walnussbaum. Unter dem Nussbaum stand eine Ruhebank, auf der sich Großmutter und Großvater nach getaner Feld- und Gartenarbeit am Abend ausruhten, sicher vor stechenden Plagegeistern. Der herbbittere Geruch der Walnussblätter hielt die Stechmücken ab. Ähnliches sagte man vom Holunderstrauch, der dicht an der Giebelwand stand. Aber der „Hollerstock“ war für meine Großmutter auch die „lebendige Hausapotheke“. Aus ihren Blüten bereitete sie Erkältungstee, aus ihren reifen Beeren Marmelade.
Geschwollene und schmerzende Mückenstiche rieb man früher mit Johanniskrautöl ein oder man betupfte sie mit dem ausgepressten Saft der Ringelblume. Auf Wespen- und Bienenstiche drückte man den Saft des Spitzwegerichs und legte eine Zwiebel – oder Kartoffelscheibe darauf.
Von der Heublumenmedizin meiner Urgroßmutter
Meine Urgroßmutter hat mir meine frühe Kindheit auf wunderbare Weise vergoldet. Meine Erinnerungen an sie leuchten heute noch wie güldene Sonnenstrahlen am Firmament. Im Volksmund war es die „Stemmchemodder“, weil sie „auf dem Stümpfchen“ wohnte. Ich hatte das große Glück, dass sie 98 Jahre alt wurde. Noch heute gehe ich im Traum mit ihr durch Fluren und Wälder, sehe ihr lachendes Gesicht und ihre Kräuterbüschel über dem Rücken. Sie hat mir die Natur in die Wiege gelegt.
Noch mit 90 Jahren war sie geistig und körperlich sehr rüstig. In den Kriegsjahren und danach streifte sie mit mir den Sommer über durch Feld und Flur. Jeden Samstag und Sonntag waren wir oft stundenlang unterwegs. Auch der kleinste Zipfel auf der Gemarkung meines Heimatdorfes Steinbach im Ostertal war uns vertraut. Ihr „heiliger“ Sammeltag war der Johannistag (24. Juni9, wenn sie ihre Lieblingsheilpflanze, das „Herz-Jesu-Blut“ pflückte. Sie presste die jungen Blüten des Johanniskrautes zwischen den Daumen und zeigte mir den blutroten Farbstoff. Am liebsten waren wir im „Kerbacherloch“, auf dem „Wälenberg“ und auf der „Trift“ auf der Suche. Sie kannte fast alle Kräuter, von der Kamille über das Tausendgüldenkraut, die Schafgarbe bis hin zum Arnika. Damals waren Arnika und Tausendgüldenkraut noch weit verbreitet; heute sind sie selten und stehen unter Naturschutz. Hatten wir die Körbchen voll, dann schnürte sie Kräuterbündel, hängte sie uns über den Nacken und wir trugen sie heim. Zu Hause wurden die Kräuter in kleinen Sträußchen unter den Walnussbaum gelegt, wo sie dann im Schatten trockneten. Das ganze Jahr über hatten wir unseren Kräutertee. Im Hochsommer pflückte sie auch Kornblumen in den Getreidefeldern, die heute fast gänzlich verschwunden sind. Ihre blauen Blüten dienten zur Färbung der Tees.
Aber auch im zeitigen Frühjahr waren wir schon auf Tour. Da galt es vor allem das Scharbockskraut zu sammeln. Sie wusste, dass es ein wichtiger Vitaminspender für die Frühjahrskur war. Aus den Blättern bereitete sie einen köstlichen Salat, aus den stärkehaltigen Knöllchen „gebratene Feigen“. Natürlich sammelten wir im März, wie das vor allem im Saarland so üblich ist, den „Bettseicher“ (Löwenzahn). Jeden Morgen pünktlich um zehn Uhr kam sie zu meiner Mutter, um die Kartoffeln für den Mittagstisch zu schälen. Im Herbst schnitt sie Kartoffelscheiben, färbte sie und stellte für mich wundersame Muster mit Kartoffelstempel her.
Meine Urgroßmutter pflegte noch das „Brauchen“, wie das früher auf den Dörfern so üblich war. Hatte ich im Winter eine Erkältung, dann brachte mich meine Mutter zur „Stemmchemodder“. Das „fleißige Handauflegen“ bei Entzündungen im Kopfbereich war damals noch ein viel gepriesenes Mittel.
Ein Bett im Heustadel, eine Ruhestunde im Heuschwaden oder ein Schäferstündchen auf dem Heuboden ist heute nicht mehr romantisch. Früher roch das Heu stark nach Kumarin, was dem typischen Waldmeisterduft entspricht. Kumarin ist eine Zuckerverbindung, die erst beim Verwelken der Pflanzen frei wird und ihren unvergleichlichen Heuduft entfaltet, ist vornehmlich im Ruchgras („Riechgras“) der Wiese, im Waldmeister, im Steinklee, in der Weinraute und in vielen Wiesenblumen enthalten. Da diese ja häufig aus den Wiesen verschwunden sind oder man sie nicht mehr ausblühen lässt, mangelt es heute dem Heu am würzigen Duft.

