Von der Weisheit und vom Brauchtum unserer bäuerlichen Vorfahren
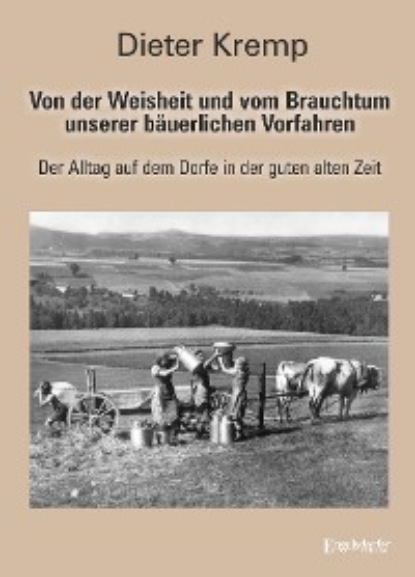
- -
- 100%
- +
„Heublumen“ aber sind keine Blumen. Es handelt sich um Pflanzenteile, die sich im Laufe der Zeit auf den Heuböden, häufig in einer mehrere Zentimeter dicken Schicht, ablagern. Diese Heublumen bestehen aus Blättchen, Samen, Blütenstaub und Blütchen der Gräser und Kräuter, die mit dem Heu eingebracht werden. Neben den eigentlichen Gräsern findet man Bestandteile des Löwenzahns, der Schafgarbe, des Eisenkrautes, des Ehrenpreises, des Kerbels, des Sauerampfers und anderer Kräuter. Heublumen sind vergleichsweise billig. Man kauft sie pfundweise in den Apotheken. Sie sollen gut getrocknet sein und nur bis zur nächsten Heuernte verwendet werden. Ältere Heublumen verlieren ihre Wirkung.
Die Behandlung mit Heublumen war für meine Urgroßmutter eine „Chefsache“. Vor allem Vollbäder mit Heublumen und der Gebrauch von Heublumensäckchen waren bei meiner Urgroßmutter dorfweit bekannt. Sie halfen bei rheumatischen Erkrankungen, Gicht, Hexenschuss, schmerzhaften Gelenkentzündungen und bei Erkältungskrankheiten. Für Vollbäder benötigte sie ein bis zwei Kilo Heublumen. Sie überbrühte mit fünf Liter Wasser, ließ zehn Minuten ziehen, seihte ab und setzte den Aufguss dem heißen Badewasser zu. Nach dem Bad gönnte man sich eine längere Bettruhe. Für Sitz- und Fußbäder nahm sie ¼ kg Heublumen.
Am bequemsten war für sie der Gebrauch von Heublumensäckchen. Dazu benutzte sie einen Leinenbeutel, den sie fast vollständig mit Heublumen füllte. Der Beutel wurde zugebunden und in kochendes Wasser gebracht. Bei zugedecktem Topf wurde er zehn Minuten ziehen gelassen. Der ausgedrückte Leinenbeutel wurde – so heiß wie nur möglich – auf die erkrankten Körperstellen gebracht. Die Heublumenauflage wurde mit wollenen Tüchern gut abgedeckt.
Als noch Fuhrleute und Kutscher auf den Dorfstraßen unterwegs waren
1945 gab es in unserem Dorf noch kein Auto. Doch den ganzen Tag über fuhren Fuhrwerke durch unsere Straßen, die ja noch nicht geteert waren. Da gab es Ortspolizeibeschlüsse, über die wir heute nur noch schmunzeln können.
Fuhrleute und Kutscher mussten linksseitig neben ihren Fuhrwerken hergehen, die Zugtiere führen oder an doppelten Leitseilen lenken. Im Innern des Dorfes durfte nur im Schritt oder kurzem Trabe gefahren oder geritten werden. Beim Bergabfahren sind Fuhrwerke durch Einlegen des Radschuhes oder mittels anderer Bremsvorrichtungen zu hemmen. Pferde, und zwar nicht mehr als je zwei zusammen, durften nur von erwachsenen Personen zur Tränke geführt oder geritten werden. Bei schneebedecktem Boden waren die Zugtiere mit Schellen oder Rosseln zu versehen. Das Peitschenknallen war nur insofern gestattet, als dasselbe bei Straßenwendungen und Kreuzungen nötig war. Während öffentlicher Bekanntmachungen durch den Gemeindebediensteten mittels der Schelle hatten Fuhren und Reiter in einer Entfernung von mindestens fünfzig Meter stille zu halten bis die Bekanntmachung zu Ende war. Ebenso waren störende Unterbrechungen durch Geschrei zu vermeiden.
Das Anhängen über drei Monate alter Pferde an Wagen sowie das Abschlachten des Viehes auf öffentlichen Straßen war verboten. Das Hetzen des Schlachtviehes durfte nicht geschehen. Schulpflichtiger Kinder waren bei eintretender Dunkelheit von der Straße fernzuhalten. Gänse waren an Sonn- und Feiertagen von öffentlichen Straßen und Plätzen fernzuhalten. Es war auch verboten, Vieh außerhalb geschlossener Höfe oder anderer umfriedeter Räume ohne gehörige Aufsicht umherlaufen zu lassen. Hausgeflügel, insbesondere Hühner, Enten und Gänse durften ohne Erlaubnis in fremde Gärten, auf Felder und Wiesen nie laufen gelassen werden. Tauben mussten während der Saat- und Erntezeit eingesperrt werden.
Es war verboten, Hunde in öffentliche Wirtschaften, Fleischbänke, auf Märkte oder zu öffentlichen Feierlichkeiten mitzunehmen oder dieselben zur Nachtzeit auf öffentlichen Straßen und Plätzen frei herumlaufen zu lassen. Das Mitnehmen von Hunden in öffentliche Wirtslokale und auf Märkte war ausnahmsweise nur dann gestattet, wenn diese mit einem Maulkorb versehen waren und an der Leine geführt wurden. Läufige Hündinnen hatte der Eigentümer „gehörig“ zu verwahren. Freilaufende Hunde größerer Gattung mit Ausnahme der Jagdhund, während sie sich auf der Jagd befanden, und der Hirten- und Schäferhunde, wenn sie bei der Herde waren, mussten mit einem wohlbefestigten Maulkorb versehen sein, der das Beißen verhinderte. Auch war es verboten, an offenen Stellen in der Nähe von Wohnungen oder öffentlichen Wegen zu baden.
Allerlei Aberglauben um die Rabenvögel
Noch meine Urgroßmutter war dem Aberglauben unserer Vorfahren verfallen und wusste zu berichten: „Wenn eine Schar Krähen am Abend auf dem Felde schreit, stirbt ein naher Verwandter.“ Das sagte man auch dem Kauz nach, wenn er in der Nacht „Kiwitt – Kiwitt“ („Komm mit – komm mit“) rief.
Im Volksmund machte man keine Unterschiede: Alle Rabenvögel, zu denen die verschiedenen krähenarten gehören, wurden „in einen Topf geworfen“. Es waren eben „Raben“. Dazu gehörten auch die „eigentlichen“ Raben, die Kolkraben. Selbst die „diebische Elster“ musste herhalten, um das schlechte Image unserer Rabenvögel zu erhalten.
„Sie klauen wie eine Atzel“. „Wie ein Rabe stehlen“ ist bis heute eine Redensart geblieben.
Bei den Bauernwaren insbesondere Saatkrähen gehasst. Fielen sie über Getreidesaaten, reifende Feld- und Gartenfrüchte her, verursachten sie großen Schaden. Die schwarze Farbe, dazu das Krächzen, das freche Heranflattern („frech wie ein Rabe“) und das scharenweise Auftauchen an grauen Novembertagen in der Nähe menschlicher Siedlungen haben bei unseren Vorfahren wohl einen so unheimlichen Eindruck erweckt, dass im Volksglauben und besonders im Märchen Rabenvögel als Unglücksvögel und Unglücksboten angesehen wurden: Ein „rabenschwarzer Tag“ war eben ein Unglückstag und ein „Unglücksrabe“ eben ein Pechvogel. Bei alledem mag der Rabe als „Galgenvogel“, der sich in der Nähe von Leichen aufhielt, eine Rolle gespielt haben. Auch sonst musste der Rabe als Symbol für Böses herhalten. „Rabeneltern“ („Rabenvater“ und „Rabenmutter“) kümmern sich nicht um ihre Kinder. Beides beruht auf der falschen Annahme, dass die Rabenvögel ihre Jungen im Stich ließen. In Wirklichkeit sind die Jungkrähen wie alle anderen Rabenvögel nach dem Schlüpfen Nesthocker, die erst nach einigen Wochen flügge werden. Eine ausgeprägte Brutpflege durch die Eltern ist damit wie bei allen Singvögeln instinktmäßig festgelegt. Nach der Brutzeit halten die Geschwister in engem Verband bis zur Verpaarung zusammen. Übrigens führen Raben eine Dauerehe.
Als die Dorfstraßen noch gekehrt wurden
Auch in den Nachkriegsjahren waren die Dorfstraßen vielfach noch nicht geteert. Den ganzen Tag über waren Fuhrwerke unterwegs, so dass die Wege immer wieder verschmutzt wurden. Da gab es Ortspolizeibeschlüsse über die „Straßenreinlichkeit“, an die sich jeder halten musste.
So war es strikt verboten, Küchenabfälle, übelriechende oder ekelerregende Stoffe und Flüssigkeiten wie Pfuhl, Spül- und Waschwasser auf Straßen, Wege und Plätzen oder in die Straßenrinnen abzuleiten, auszuschütten oder auszugießen. Es war auch verboten, auf den Straßen und Plätzen Drachen steigen zu lassen, Schlittschuhe zu laufen, Spiele zu machen, Schneebälle zu werfe n und mit Holzschlitten zu fahren. An das letzte Verbot hielten wir Kinder uns nicht. Hin und wieder aber kam der „Schitz“ und jagte uns fort.
Und weiter hieß es: „Es ist verboten, Unrat irgendwelcher Art, insbesondere Kehricht, Haus- und Küchenabfälle, Rasierschaum, Glasscherben, Gemüse- und Papierabfälle auf Straßen, Wege oder öffentliche Plätze zu werfen.“
Ganz wichtig für die Hauseigentümer waren die sogenannten „Kehrtage“. So war jeder Hof- und Grundstücksbesitzer verpflichtet, die Straße entlang seines Besitzes jeden Samstag und außerdem am Vorabend jedes Feiertages gehörig zu reinigen und zu säubern. Auch hier machte der Feldschütz am Samstagabend seine Kontrollen. Bei außergewöhnlichen Verunreinigungen der Straßen, Gassen und Plätze, wie durch Auf- und Abladen von Holz, Torf, Kohlen, Dünger, Heu und Stroh hatte die Straßenreinigung auch an anderen Tagen als an den Kehrtagen stattzufinden.
Bei trockener Witterung musste die Straße zur Vermeidung von Staub jedesmal vor dem Kehren mit reinem Wasser begossen werden, Kehricht und Kot mussten sofort entfernt werden. Auch mussten die Straßenrinnen vor den Häusern zur Sommerzeit an den Kehrtagen mit frischem Wasser ausgespült werden.
Das Waschen, insbesondere der Putz- und Scheuerlappen, der Kartoffeln und Futterartikeln, sowie das Reinigen der Kübel an den Gemeindebrunnen war untersagt. So war es auch verboten, Unrat, Eis oder Schnee dem Nachbarn zuzukehren. Kehricht, Asche und Abfälle durften nicht in die Bäche und Dohlen gebracht werden. Jede Verunreinigung der Straßen, Wege, Plätze, Anlagen und Häuserwinkel durch Verrichtung der Notdurft war untersagt, ebenso das Anlegen von Dunghaufen außerhalb der Höfe.
„Wo ein Schaf hingeht, da gehen sie alle hin“ - Vom Schafhirt im Bauerndorf
Rindvieh, Schafe, Schweine und Gänse, jede Gattung für sich, wurden von Hirten, die in dem Gemeindehirtenhaus wohnten, gehütet. Der Schafhirt, auch Schäfer genannt, hatte seine Weide auf allen begrasten Flächen mit Ausnahme des Dorfangers, wo die Kirmes war.
Von April bis November weidete der Schäfer. Die Stoppelweide nach der Ernte wurde der Reihe nach beweidet, zuerst durch den Kuhhirten. Dann kamen der Schweinehirt und der Gänsehirt, und als letztes kam dem Schafhirten vor Winteranfang der in den Stoppeln vorhandene Graswuchs noch zugute.
Der Schäfer zog mit den Schafen im Frühjahr so zeitig wie möglich hinaus. Dem Schäfer wurde nämlich das Futter knapp. Beim Hinaustreiben am frühen Morgen gab der Schäfer durch Pfeifen mit den Fingern ein besonderes Signal. Die Tiere wurden dann vom Hofe getrieben. Abends vor der Dunkelheit kam er mit der Schar wieder heim. Vor jedem Bauernhof hielt er an und teilte die entsprechenden Schafe wieder zu. Bei diesem Auseinandermarschieren gab es immer einen Höllenlärm. Das Geplärr der Mutterschafe nach ihren Lämmern, das Gebell des Hirtenhundes und das Fluchen des Schäfers mit den grässlichsten Ausdrücken kehrten jeden Abend wieder.
Das Schaf ist von allen Tieren wohl das „dümmste“ Geschöpf. So eilen doch das Pferd, die Kühe, die Schweine und die Ziegen beim Heraustreiben jedes nach seinem Gehöft und Stall. Selbst die „dumme“ Gans weiß ihr Heim zu finden. Dagegen sind die Schafe fast nicht von der Stelle zu bewegen. Will man sie aus dem Stalle haben, muss man eines ergreifen und wegschleppen. Erst dann folgen alle anderen eiligst nach. Daher das Sprichwort: „Wo ein Schaf hingeht, gehen sie alle hin.“
So ab Anfang Mai blieben die Schafe samt ihren Lämmern draußen. Es wurden dann Hürden aufgestellt und eine fahrbare Schäferhütte. Für die Nacht kroch der Schäfer im Krebsgang in die Hütte. Nachts um zwölf Uhr hatte der Schäfer die Hürden weiter zu schlagen. Dabei beanspruchte er die Hilfe des Hirtenhundes, der die Schafe beieinander hielt, bis sie in die neue Fläche eingetrieben wurden. Man nannte dieses den Morgenstall. Bei Tagesanbruch kam dann der Schäfer mit seinem Hunde nach Haus. Morgens gegen zehn Uhr zog der Schäfer wieder aus den Hürden zur Weide, nachdem er die Hürden für den nächsten Abend geschlagen hatte.
Bauerntracht – Selbstgemacht
Wir kennen wunderschöne Bauerntrachten, die auf dem Lande teilweise auch heute noch als Sonntagsstaat getragen werden; früher wurden sie von Hand zusammengefädelt.
„Die schönste Bauerntracht
ist selbstgesponnen, selbstgemacht.“
Und damit haben wir einen weiteren Beruf der Bäuerin: Sie war auch Näherin und Schneiderin. In der Spinnstube sorgte sie mit den Dorfmädchen für Garn und Wolle, die dann auf dem Webstuhl zu Tuch verarbeitet wurde. Der schönste Stoff aber musste immer für die Tracht herhalten.
Wer sich beim Nähen ungeschickt anstellte, weit ausholend mit zu langem Faden abmühte, dem hielt man die alte Bauernweisheit vor, die zum Sprichwort wurde:
„Kleine Fädchen – fleißige Mädchen.
Große Faden – faule Maden.“
Natürlich wurde auch die Bettwäsche selbst hergestellt, wobei man sich nicht im Material vergreifen durfte:
„Wolle liegt sich zu Mist,
Flachs liegt sich zu Seide.“
In manchen Gegenden war blütenweißes Bettzeug ein Zeichen für die Reinlichkeit der Hausfrau, die sich aus manchen Sprüchen in Bauernkalendern Rat holen konnte:
„Im Märzenschnee die Wäsche bleichen,
da müssen alle Flecken weichen.“
Obwohl die Tätigkeit in Feld und Garten eine rechte Drecksarbeit ist, war für die Hausfrau, die etwas auf sich hielt, Reinlichkeit in den Wohnstuben oberstes Gebot. Deshalb hielt sie ihren Mägden manchmal vor:
„Auch in der Eck’ muss es rein sein.“
Und wenn sich dann die Magd entschuldigte, sie habe auf des Pfarrers Geheiß erst den Rosenkranz beten müssen und darüber fast die Arbeit vergessen, musste sie den alten Spruch hören:
„Ein Mädchen das gätet,
ist besser als ein Mädchen, das betet.“
Auf jedem Gebiet musste die Bauersfrau Höchstleistungen erbringen und durfte noch nicht gegen ihren Mann, den Patriarchen, aufmucken, der ihr möglicherweise immer wieder vorhielt:
„Eine gute Hausfrau mehrt das Haus,
die schlechte trägt’ s zur Türe raus.“
Ihr gab man auch die Schuld, wenn die Wintervorräte zur Neige gingen und vielleicht Schmalhans Küchenmeister wurde. Deshalb heißt es in einem Spruch:
„Eine gute Hausfrau
kennt man an der Vorratskammer.“
Die Rezepte der Bauersfrau, der halben Doktorin
Wahrscheinlich hat man alle Zeit zuviel von einer Bauersfrau verlangt.
Sie durfte ihre Hände nie in den Schoß legen:
„Eine gute Hausmutter darf nie ledig gehen.“
Sie musste auch einfach alles können, wie zum Beispiel:
„Eine jede Hausmutter
Sollt’ eine halbe Doktorin sein.“
Sie kannte viele Hausmittel, mit denen sie ihre Kinder, ihren Mann und auch das Gesinde gesund pflegen konnte. Die Kräuter im Weihbuschen waren Hausmittel gegen viele Krankheiten. Darüber hinaus wurde aus Kräutern mancher Trank hergestellt, der bei passender Gelegenheit den Kranken gesund machen sollte.
Vor dem Schlafengehen kocht man zum Beispiel einen Tee aus Johanniskraut, um Schlafstörungen zu beseitigen. Der sollte auch bei Nachtwandeln und Bettnässen helfen. Heute wissen wir, dass Johanniskraut-Tee bei nervösen Störungen helfen kann.
Die Schafgarbe galt bei der Bauersfrau als Bauchwehkraut, auch von ihr goss man einen Sud auf, der Verkrampfungen der Bauchorgane lösen sollte. Schon vor einigen hundert Jahren wusste man aber, dass ein Zuviel dieser Medizin eher schaden kann.
So war das nicht nur beim Schafgarben-Tee, sondern auch bei dem, den man aus dem Wermut zauberte, der nicht nur Blähungen abtrieb, sondern auch gleichzeitig den Appetit anregte.
Über die heilende Wirkung der Pfefferminze ist man sich heute noch einig. Die Pfefferminzblätter werden von Mai bis August gesammelt und dann getrocknet. Der Tee wurde im Mittelalter nicht nur zur Behandlung von Krämpfen im Unterleib und bei Erkältungskrankheiten getrunken, sondern er galt als potenzsteigerndes Mittel. Diese Wirkung schrieb man damals auch dem Maggikraut und der Petersilie zu:
„Petersilie, Suppenkraut,
wächst in unserm Garten,
unser Ännchen ist die Braut,
kann nicht länger warten.“
Das gallig-bittere Tausendgüldenkraut ist eine der ältesten Heilpflanzen überhaupt. Es hilft bei Stoffwechselerkrankungen, Leber- und Gallenleiden und beseitig Darmträgheit. Man behandelte auch manche Hautausschläge, sogar Wunden und Geschwüre mit Umschlägen und Waschungen. Dazu kocht man einen dicken Sud aus diesem Kraut.
Ein Aufguss der getrockneten Blüten der Königskerze wurde ebenfalls für Umschläge und Waschungen gegen Flechten, Geschwüre und Hämorrhoiden genommen. Der Tee dieser Blüten hilft auch bei Bronchitis und Erkältungskrankheiten.
Die Wunderwirkung der Kamille wird bis in unsere Zeit gerühmt. Der Kamillentee wirkt entzündungshemmend und krampflindernd bei Hals- und Mandelentzündungen. Kamillendampf ist ein bewährtes Hausmittel gegen Schnupfen und Entzündungen im Nasenbereich. Ein Kamillendampfbad galt schon vor einigen hundert Jahren auch als Schönheitsmittel.
Als Fliedertee kennt man das Getränk, das aus den Blüten des Holunders aufgegossen wird und ein vortreffliches Grippemittel ist. Ein Tee aus abgekochter, getrockneter Rinde hilft bei Nierenentzündungen und Stuhlverstopfung. Holunderbeerensaft konnte Nervenschmerzen und Verdauungsstörungen lindern und wurde auch bei Gicht und Rheuma angewandt. Übrigens fanden die Bäuerinnen den Holunder direkt vor dem Haus. Denn seit alten Zeiten stehen die Sträucher als Begrenzungen von Gärten und Feldern hoch im Kurs, schützten sie doch vor bösen Geistern und das Haus vor Blitz und Donnerschlag. Wer sich zum Beispiel unter einen Holunderstrauch schlafen legte, der war vor jeder Hexe sicher. Das ist ein Aberglaube, den mancher Bursche ausnutzte, indem er sein Schäferstündchen unter einem Holunderstrauch hielt, wohlwissend, dass das Mädel, wenn es mitging, ganz gewiss keine Hexe sein konnte.
Ein Aufguss von Arnika, das man vor allem auf feuchten Wiesen und auf den Almen des Hochgebirges findet, hilft- äußerlich angewendet – bei Bluterguss, Quetschungen und Entzündungen.
Noch viele andere heilende Kräuter kannte die Bauersfrau. Auch im eigenen Bauerngarten hatte sie eine Menge von Heilkräutern und Gewürzkräutern angebaut, so zum Beispiel auch das Mutterkraut, den Lavendel und die Melisse. Das Mutterkraut durfte in keinem Bauerngarten fehlen, wehrte es doch im Schlafzimmer die Motten ab; deswegen auch Mottenkraut genannt. Auf jeden Fall war die Bäuerin eine „Doktorin“, half sie doch ihrer Familie und dem Gesinde.
Eigener Herd ist Goldes Wert
Es gibt auch heute noch wunderschöne Bauernhäuser und Gehöfte, die teilweise noch so gebaut werden wie vor einigen hundert Jahren. In manchen sind Wohnung, Scheune und Ställe unter einem Dach – wie im Schwarzwaldhaus, das in Form eines Walmdaches mit Schindeln und Platten bedeckt ist. Ganz früher waren sie mit Stroh bedeckt. Oft stehen die Bauernhäuser an einem Hang. Von seinem Wohnteil aus sieht der Bauer hinunter ins Tal, und dem Hang zu kann er gleich in die Scheune einfahren und das Vieh in die Ställe treiben.
Es gab auch oberbayrische Bauernhäuser mit recht flachen Satteldächern und größtenteils aus Holz gebaut, und in Friesland gab es Ziegelhäuser, die mit Reet, mit Riedgräsern gedeckt waren.
Ein reines Fachwerkhaus, also ein mit Balken verstrebter Ziegelbau, war das Niedersachsenhaus, dessen First mit gekreuzten Pferdeköpfen geziert war. Diese Holzsymbole weisen auf eine alte Tradition der Bauern hin, die Pferdezucht. Gleichzeitig aber sollten sie, nach einem alten Aberglauben, böse Geister von der Türschwelle fernhalten.
Ob es sich nun um Häuser handelt, in denen alles unter Dach und Fach gebracht werden konnte – das Bauen ist nicht erst in unserer Zeit teuer geworden. Davon zeugen viele alte Bauernsprüche, die oft auch den Sparsinn der Landbevölkerung widerspiegeln:
„Man muss so bauen, dass man sich nicht aus dem Haus hinausbaut.“
„Maurerschweiß – steht hoch im Preis.“
„Die Zimmerleut’ und Maurer,
das sind die rechten Laurer;
eine Stunde tun sie essen,
eine Stunde tun sie messen,
eine Stunde rauchen sie Tabak,
damit vergeht der halbe Tag.“
Man schätzte sich glücklich, ein Haus zu besitzen, auch wenn man von dem Ertrag der Äcker und Wiesen und der Viehzucht oft mehr als den Zehnten an den Landes- oder Grundherrn abliefern musste.
„In seinem eigenen Haus ist jeder ein König.“
„Meine Haus ist meine Burg.“
Freilich wusste man auch von der Gastrolle, die man auf Erden in seinem eigenen Haus spielt.
„Ein jeder baut nach seinem Sinn,
und nachher wohnt ein andrer drin.“
Ein Tiroler Hausspruch stellt dazu eine Frage, die niemand beantworten kann:
„Das Haus ist mein und doch nicht mein;
Der nach mir kommt, ist auch nicht sein;
und wird’s dem dritten übergeben,
so wird’s ihm ebenso ergehen;
den vierten trägt man auch hinaus –
nun sagt mir doch, wes ist das Haus?“
Hier klingt die immerwährende Erbfolge an, aus dem Vergehen erwächst stets ein neues Werden:
„Wenn ein alter Bauer stirbt,
so lacht das Geld
und weint das Feld.“
Wer sich auf das Erben verließ, dem wurde entgegengehalten:
„Wer sich verlässt aufs Erben,
ist ein Narr bis zum Sterben.“
Da war es besser, man arbeitete und lebte für den Augenblick.
Die vielen Berufe der Bauersfrau
Früher musste die Bäuerin eine Landwirtschaftsschule besuchen und hat nebenbei oft bei ihrer Schwiegermutter oder einer anderen Bäuerin eine gute Hauswirtschaftslehre durchgemacht. Das kam dem Hof zugute, denn schon eine alte Bauernregel besagt:
„Wer eine gute Hausfrau hat,
der hält das Haus instand.“
Von jeher war die Arbeit auf dem Bauernhof so eingeteilt:
„Wenn die Hausfrau in Küche,
Stall und Keller,
und der Herr in Scheune und Feld,
so ist die Wirtschaft wohl bestellt.“
Eine rechte Bäuerin hat noch mehr Berufe als eine städtische Hausfrau:
„Hauskehren und Windelwaschen
und sudeln und prudeln in der Aschen
und Hausarbeit durch die Wochen
und Schüsseln spülen und Essen kochen
und viel am Webstuhl wirken und nichts gewinnen
und Kühe melken und Garne spinnen
und des Nachts am Rücken liegen –
die Arbeit ist all der Bäuerin gediegen.“
Mit anderen Worten: Schon vor vielen hundert Jahren werkelte die Bauersfrau vom ersten Hahnenschrei am frühen Morgen bis tief in die Nacht, und trotz häufigem Kindersegen ging die Arbeit weiter auf Hochtouren.
„Ist die Frau mal nicht munter,
geht’s bald drüber und drunter.“
Mutterschutz war noch Anfang des 20.Jahrhunderts auf dem Lande kein Gesprächsstoff. Die Bauersfrau arbeitete hart bis zum Beginn der ersten Wehen und oft schon nach ein oder zwei Tagen stand sie wieder am Herd, kochte für die Familie und versorgte so ganz nebenbei ihr Jüngstes:
„Je länger im Bette, desto ärmer die Küche.“
Wie sich im Mittelalter ein Bauer seine Bäuerin vorstellte, besagt dieser alte Spruch:
„Was soll ein Mägdlein hübsch und zart
Einem groben dicken Bauern hart?
Einem Bauern gehört eine Bäuerin stark,
die ihm macht Butter, Käs und Quark.“
Der Bauer- der Patriarch auf dem Hof
So ganz ohne Erbschaft ging es nicht ab. Manch einer, dessen ältester Bruder den Hof des Vaters übernahm, sah sich nach einem Mädel um, das mangels männlichen Nachwuchses die Landwirtschaft des Vaters erben würde. Durch Hochzeitmachen vergrößerte so mancher Landwirt seinen eigenen Grund und Boten:
„Weiber bringen mehr, als sie mitnehmen.“
Man war trotz dieser wirtschaftlichen Gesichtspunkte noch wählerisch dazu. Eine Frau musste zupacken können und durfte sich nicht stundenlang mit Schönheitspflege beschäftigen:
„Zwei Dingen nimmer trau:
Dem Gras im Februar
und einer geschminkten Frau.“
Ein Bauer regierte auf seinem Hof wie ein Patriarch. Er hielt nichts von der Gleichberechtigung, was einige derbe Sprüche wiedergeben:
„Das Weibersterben
ist kein Verderben,
aber’s Rosseverrecken,
das bringt Schrecken.“
„Weibertod und Pferdeleben
einem Hause Reichtum geben.“

