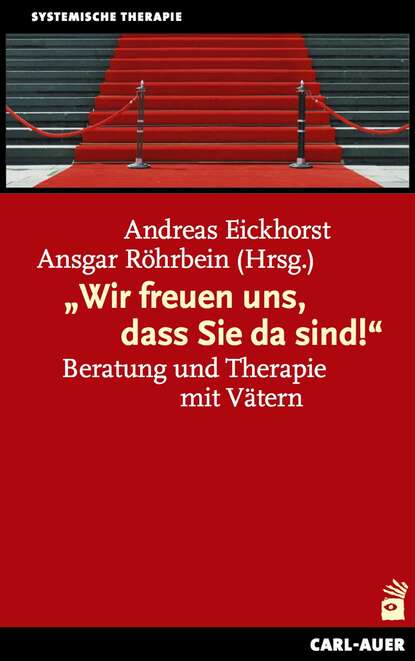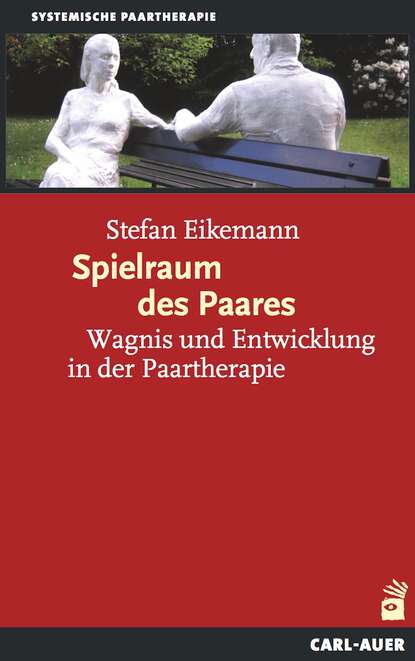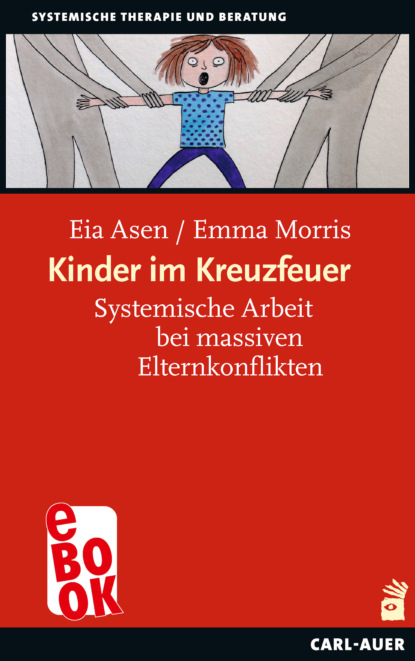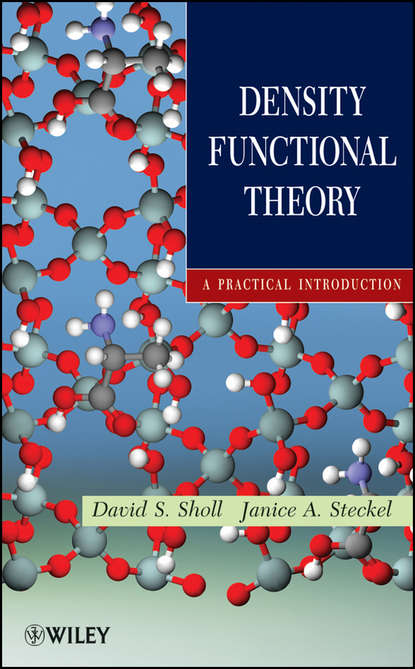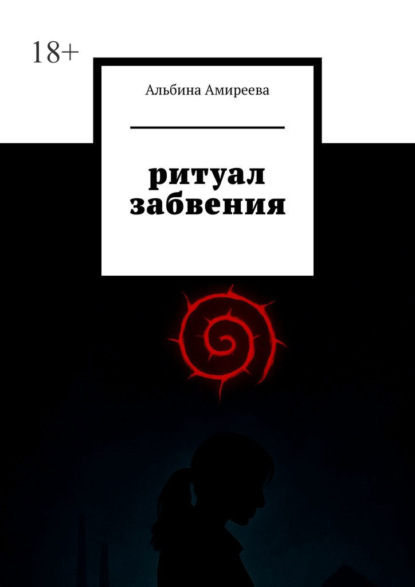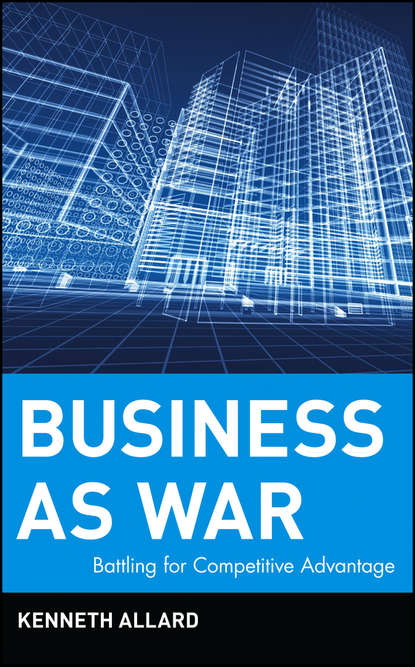Natur-Dialoge
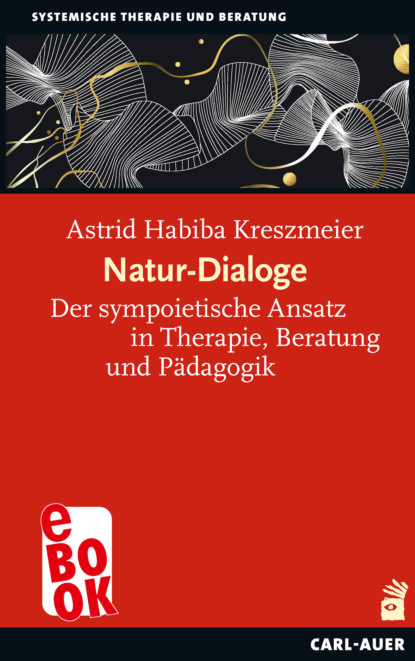
- -
- 100%
- +
Wie antwortest du?
All diese Ausflüge rund um meinen aktuellen Schreibort unternehme ich nicht aus erzählfreudiger Laune heraus, sondern weil alles zu systemisch-ökologischen Perspektiven gehört: genau genommen ja zum Leben an sich, zumindest zu einem situiert-leiblichen, sinnlich-wirklichen Leben. Das Wetter, die Geografie, die Landschaft, ihre Steine, Pflanzen und Tiere, die Luft und ihr Lied. Und natürlich die Menschen, ihre Geschichten und Kulturen und ihre Räume der Erinnerung.
Das alles gehört dazu.
Dieses Nachdenken und Erzählen lädt dazu ein, unseren irdischen Lebenskontext samt seinen biologischen und kulturellen Historien in unsere professionellen Begegnungen, Gespräche, Hypothesen, Reflexionen und Interaktionen aufzunehmen. Es geht darum, menschliche Angelegenheiten in ihrer systemischen Verortung als Erd-Mitbewohner:innen mitzudenken, mitzufühlen und in unsere Kommunikation einfließen zu lassen. Es geht darum, der fortschreitenden »Erddemenz«, die leider schon vor ein paar Jahrtausenden langsam ihren Anfang genommen hat und seit gut 200 Jahren exponentiell gestiegen ist, auch im Bereich von Bildung und Beratung ein paar Körper-Denkübungen oder auch Kopf-Herz-Hand-Wege entgegenzuhalten.
Bekanntlich wird nichts von einem objektiven Niemand im relativen Nirgendwo geschrieben, auch wenn viele ganz geschickt sind darin, so zu tun als ob, oder vermutlich tatsächlich an solch objektive Standpunkte und ihre Wahrhaftigkeit glauben. Ich schreibe also nicht nur in einem spezifischen Orts-Raum, sondern auch in einer spezifischen kulturellen Zeit, und ich bin als in Sprache lebendes weibliches menschliches Wesen mit all dem im wechselseitigen Austausch und in bedingender Verwobenheit.
Der kulturelle Moment, in dem dieser Text entstanden sein wird, ist geprägt von der oben kurz erwähnten Covid-19-Pandemie, deren Wellen, Nach- oder Nebenwellen hier im mitteleuropäischen Raum und in allen anderen Teilen der Welt gerade Wirklichkeiten gestalten. Corona »erschien« in einer Zeit, in der Klimaerwärmung, System-Change, from Ego to Eco, Kreislaufwirtschaftsmodelle aber auch konservative Nationalismen, Fremdenfeindlichkeit und potenziell totalitäre Populismen den gesellschaftlichen Diskurs prägten. Diese Gegenwärtigkeiten werden da und dort in den Fluss der Gedanken hineinschwappen. Auch wenn natur-dialogische Blickwinkel weder von der Pandemie noch von ihren Auswirkungen sonderlich überrascht sind, so gewinnen sie inmitten dessen doch an Dringlichkeit.
Ist die Welt noch von Belang?
Bist du bei Sinnen?
Bislang war ich der Meinung, dass es primär wichtig sei, die verschüttete Beziehung zu den uns umgebenden Naturräumen und den Dingen im Allgemeinen zu thematisieren. Nach den letzten Monaten der digitalen Aufrüstung in Bildung und Psychotherapie scheint jedoch neben der Erddemenz eine weitere Krankheit um sich zu greifen: nämlich eine gehörige Ent-Körperung unseres sozialen menschlichen Daseins. Wir gewöhnen uns gerade daran, dass wirklich körperliche Begegnungen nicht nur potenziell gefährlich, sondern auch mehrheitlich unnötig sind. Zumindest in den wohlhabenden Ländern, die körperliche Notwendigkeiten an billige ausländische Arbeitskräfte delegieren und darüber hinaus über so viel Raum verfügen, dass Distanzgeschäfte funktionieren.
So werden gerade Beratungs- und Therapie-Apps im großen Stil entwickelt. Viele Kollegen halten Online-Beratung für mindestens so wirkungsvoll wie Präsenz-Beratung, und selbst körperorientierte Verfahren wie die Aufstellungsarbeit scheinen mittels Splitscreen und Face-Tracing so gut zu funktionieren, dass nicht einmal Klienten und Stellvertreter im selben Raum sein müssen.2
Es bahnt sich an: In Zukunft wird es mehr und mehr digitale Beratungen geben. Der selbstbestimmte Kunde oder Klient wird frei wählen, was für ihn gut ist. Das ist auch angemessen. Er (oder sie) wird sich vermutlich für eine Therapie-App entscheiden, die er sich zunächst gratis downloaden kann. Ab einer gewissen Bedarfskomplexität kann er ja jederzeit auf Standard Pro, Premium light oder gar Goldmaster aufstocken. Von seiner individualisierten, automatisierten Therapie-App wird er in klug berechneter Taktung Nachrichten erhalten. Sie werden ihn glücklicher machen, auf andere Ideen bringen, und sie werden Möglichkeiten erweitern! Mit jeder Interaktion wird der Computer mehr lernen, und da er ohnedies »mitschaut«, wo sich der Klient den ganzen Tag virtuell und analog bewegt, können die Nachrichten immer gezielter, gewitzter und klüger werden. Und ich bin überzeugt, dass mit dieser Technik auch viel Schlimmes verhindert werden kann. Kein Witz.
Nun, andere werden sich für eine analoge Beratung entscheiden, weil ihnen eine wirklich gute Freundin das im wirklich guten Moment empfiehlt. Nehmen wir an, diesmal sei es eine Klientin: Sie wird sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auf den Weg machen, vermutlich im Verkehr steckenbleiben. Sie wird schon vor dem eigentlichen Ereignis einiges riechen, schmecken und fühlen; es wird, je nachdem, von wo nach wo sie unterwegs ist, mehr oder weniger anstrengend sein. Ich erspare uns jegliche Details. Sie wird aber irgendwann den vereinbarten Treffpunkt erreichen, vermutlich ein Haus. Die Atmosphäre der Tür, die Gerüche im Gang, der Ton der Glocke, der Empfang und dann die Begegnung mit diesem Menschen, der ihre Therapeutin, ihr Berater ist. Ein Blick, ein kurzes Lächeln, eine kleine Unsicherheit, vielleicht sogar Scham oder aber Freude, spontane Geneigtheit, gewisse ritualisierte Handlungen, Händewaschen, ein Glas Wasser.
Selbst wenn alles schon bekannt ist: Dieser Moment der Begegnung wird immer etwas Aufregendes sein, weil er eine in Echtzeit stattfindende Erfahrung ist. Wir treten miteinander in einen gemeinsamen Handlungsraum, und bei allem Bemühen, eine solche Begegnung abzusichern, bleibt sie, was Leben derweilen noch ist: ein unvorhersehbares, unberechenbares Aufeinanderbezogensein, das jederzeit spontan Stimmungen, Gefühle, Ideen und Bewegungen hervorbringen kann. Dieser Unverfügbarkeit des lebendigen Raumes ist nicht gänzlich beizukommen. Wir bleiben ewige Schüler:innen in Sachen Vertrauen und Kompetenz, wenn es ums Lebendige geht. Jede leiblich-situierte Begegnung ist bei genauer Betrachtung ein Lernraum für den Umgang mit lebendigen Dingen.
Unentwegt mittendrin
So unfassbar es klingt: Der Umgang mit lebendigen Dingen, ja überhaupt die Erinnerung daran, dass Leben mit Lebendigkeit zu tun hat, macht konsequent allerlei Risikoberechnungen und Produktivitätssteigerungsmodellen Platz, deren Ergebnisse nur dann treffend sind, wenn spontane Erscheinungen durch Absicherung unwahrscheinlich gemacht werden.
Eine langjährige Freundin ist Großmutter geworden. Während der Schwangerschaft war sie irritiert darüber, dass ihre Tochter von einem digitalen Schwangerschaftsprogramm regelrecht unter Kontrolle gehalten wurde. Ihre »Mama-Werden«-App wurde zur Autorität und Orientierung Nummer eins. Auch wenn wir die »großmütterliche Übertreibung« abziehen und auch die mögliche Kränkung, als Mutter weniger Stimme zu haben als ein programmierter Ratgeber, so teile ich dennoch ihre Besorgnis: »Meine Tochter verliert ihr natürliches Gefühl zu sich selbst, das Vertrauen in ihre Wahrnehmungen und den Dialog mit dem Kind, den Menschen und der Welt rundum.«
Es ist ein Weltverlust, ein Verlust des vertieften, sinnlichen, leiblichen und direkten Handelns in einer mehrdimensionalen wirklichen Welt, den wir vorantreiben, der uns vorantreibt. Das wirkt unmittelbar in alle beruflichen Felder hinein.
Umso überraschender ist, dass die menschlichen Beziehungen zur Welt in Psychotherapie und Beratung kaum Aufmerksamkeit erhalten, während sie in der Soziologie, der politischen Philosophie und alternativen Bewegungen intensiv diskutiert werden. Selbst in systemischen Schulen, die für eine kontextbewusste Schau von Kommunikationsnetzwerken stehen, ist die Frage nach den Beziehungen mit der äußeren Welt – sei sie selbst-lebendig oder von Menschen gemacht – aktuell kaum im Bewusstsein. Die ökologische Verwobenheit hat mitunter dem rein mensch-orientierten oder ganz abstrakten Systemdenken Platz gemacht. Fast könnte man meinen, dem systemischen Netzwerk seien einige Welten-Fäden entglitten, die in seinem Entstehen noch durchaus prominent mitgedacht wurden.3
Hier mache ich mich daran, einige dieser ökologischen Fäden wieder aufzugreifen, ihre Textur in meinen weiblichen Händen zu fühlen, sie mit anderen Fäden aus älterer und jüngerer Zeit zu verknüpfen und neu ins Spiel zu bringen. Wie schön, dass ich dabei nicht alleine war und bin. Durch die kollegialen Gespräche, die Begegnungen mit Klienten und Klientinnen und die Gegenwart meiner menschlichen und anders-als-menschlichen Freunde und Freundinnen ist herzhaftes, lebendiges Miteinander entstanden. All das webt in wiederkehrenden Erzählsträngen mit.
So geht es um Beiträge zum Weltlichen, zur Erinnerung an das sagenhaft Selbstverständliche, nämlich daran, dass sich das Leben ganz leiblich auf der Erde abspielt. Auch wenn darin viel vom Lebendigen, ja mitunter vom Beseelten oder gar Wunderbaren die Rede sein wird: All diese Gedanken sind tief »gottlos«, ganz und gar an Immanenz orientiert. Das Erdlingsdasein ist ausreichend unberechenbar und einfallsreich. So voller Wunder und Kraft, dass es eine Freude ist und es sich lohnt, mit offenen Augen durch Land und Leben zu ziehen.
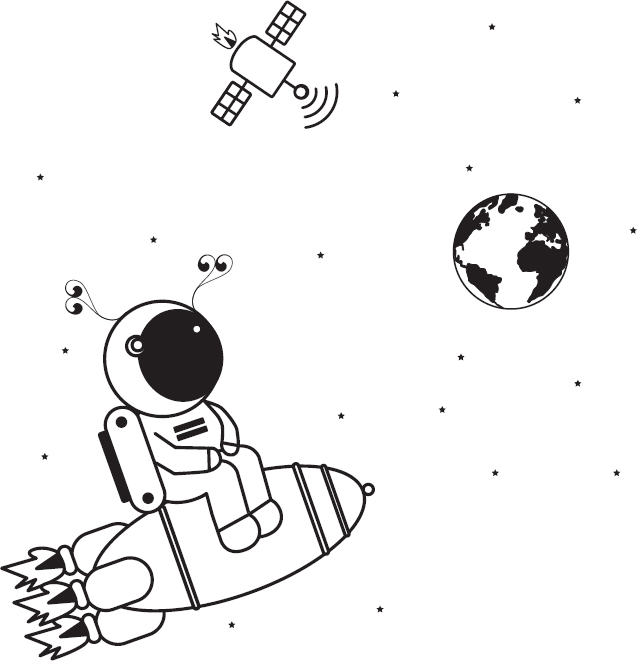
1 Mit dem Begriff der Erddemenz will ich jene »Welt- und Erd-Entfremdung« ansprechen, die seit der Entwicklung der Schriftkulturen und ihrer dokumentierten Geistesgeschichte die Mehrzahl der menschlichen Kulturen prägt. Mit diesem Phänomen setzen sich viele Menschen in Theorie und Praxis auseinander. Meine Gedanken stützen sich unter anderem auf die theoretischen Analysen von Hannah Arendt sowie auf die Auseinandersetzungen des französischen Soziologen Bruno Latour und auf die Gedankenwelt der Ökofeministin Donna Haraway.
2 Eine schweizerische Fachzeitschrift für Beratungspersonen, das BSO Journal, widmet ihre Ausgabe 2/2020 der boomenden Frage der Online-Beratungen und ist sich sicher: Die neue Zeit ist digital. Matthias Varga von Kibéd erklärt darin im Gespräch mit Sandra Küng »Wie systemische Strukturaufstellung online geht« und stellt fest: »Systemische Strukturaufstellungen lassen sich sogar dann online durchführen, wenn der Klient und die Repräsentanten alle an verschiedenen Orten sind.« Split-Screen und Facetracking sind hier seine technischen Helfer.
3 Hier beziehe ich mich vor allem auf drei bekannte Namen: Gregory Bateson, der als wesentlicher Wegbereiter des systemischen Denkens gilt, hat in seinen gesellschaftskritischen und erkenntnistheoretischen Überlegungen, die Natur, also die nicht-menschliche Welt, noch an Bord. Zwar ist auch er, wie viele Männer seiner und schon geraumer Zeit, auf der Suche nach dem »einenden Muster«, das die Verschränkung von Materie und Geist zu erklären vermag, und tendiert letztlich dazu, dem Geist den Vorrang zu geben, aber immerhin ist er in fürsorglicher Hinwendung zur Frage: Welches Muster wirkt zwischen dem Einzelnen? In Geist und Natur schreibt er auf Seite 22: »In Wahrheit ist die richtige Weise anzufangen, über das Muster, das verbindet, nachzudenken, es primär (was immer das bedeuten mag) als einen Tanz ineinandergreifender Teile aufzufassen, und erst sekundär als festgelegt durch verschiedenartige physikalische Grenzen …«
Ilya Prigogine, der als Physiker, Chemiker und Philosoph rund um seine Thesen der Selbstorganisation und dissipativer Strukturen die Systemtheorie stark inspirierte, hatte gemeinsam mit der Philosophin Isabelle Stengers unter dem Titel Im Dialog mit der Natur eine wissenschaftskritische und philosophiekritische Auseinandersetzung der »alten« Trennung von Natur und Kultur angeregt. Isabelle Stengers ist als Wissenschaftsphilosophin bis zum heutigen Tag in ihrem Werk daran, eine kritische Auseinandersetzung von Wissenschaft, Politik, Ökologie und Kosmologie zu wagen (vgl. Stengers 2008).
Humberto Maturana, der gemeinsam mit Franzisco Varela die Idee der Autopoiese als Muss in den systemischen Diskurs einbrachte, lehrte bis zu seinem Tod im Frühjahr 2021 noch gemeinsam mit Ximena Dávila im Institut Matriztica in Chile ihren Ansatz der »Cultural Biology«, »Biologia Cultural«. Seine unermüdliche Forschung rund um das, wie Leben und menschliches Leben beschrieben und gestaltet werden kann, wird im Laufe dieser Arbeit immer wieder einfließen.
2Praxis des Streunens
»Lebende Systeme sind wunderbar spontan.«
Humberto Maturana
»Nichts ist mit allem verbunden. Alles ist mit etwas verbunden.«
Donna Haraway, Unruhig bleiben, S. 48

Seit dreißig Jahren arbeite ich mit Menschen in beratender und psychotherapeutischer Praxis. Gemeinsam mit meinem Partner und Kollegen und Kolleginnen erfinden wir Ausbildungen, zetteln wir Netzwerke an, halten da und dort Vorträge und schreiben. Es grenzt an viele Wunder, dass das, was wir am Rande einer scheinbar völlig anders tickenden Lebensumwelt tun, nicht nur funktioniert, sondern uns ernährt und erfüllt und in all den Jahren nie langweilig geworden ist. Seit zwanzig Jahren ist der Rosenhof unser Seminarhaus und Praxisraum in einem ländlichen Gebiet, am Rande eines appenzellischen Dorfes. Der Westhang hinter dem Haus lässt zwar die Sonne früher untergehen, aber er schützt uns vor kalten Winden. So gedeihen hier allerlei prächtige Blumen, Sträucher, Kräuter und Bäume, ehe sich ein wildes Wald-Tobel hinunter zu einem kleinen, aber frei fließenden Fluss namens Sitter neigt. Scherzhaft sagen wir manchmal, unser Esalen4 liegt eben nicht an der Klippe zum Pazifik, sondern an einer Klippe zum Fluss.
Die Menschen, die uns aufsuchen, sind so vielfältig wie der Garten. Jünger, älter, männlich, weiblich, arm und reich und aus allerlei beruflichen und sozialen Umfeldern. Sie kommen aus den Nachbardörfern und aus den Städten, von nah und fern. Sie kommen mit Krankheiten, Anliegen, mit Interesse oder einfach aus Freude.
Und auch wenn sich unsere Arbeitsweisen verschiedentlich beschreiben lassen, so sind sie doch alle von einer markanten Qualität geprägt: von der Praxis des Streunens. Ja, es ist fast ein bisschen simpel und doch offensichtlich: Das Streunen wurde zum Herzstück unseres Wirkens. Es gibt kaum eine andere Art von Weltenbezug, dem wir so viel an Geschenken und Einsichten, Möglichkeiten und Dialogen verdanken. Man darf annehmen, dass es sich mittlerweile herumgesprochen hat: Bei uns kann man das Streunen lernen.
Zwischen häuslichem Schutz und wildem Raum 5

Streunen ist eine sehr eigenwillige Weise, in der Welt zu sein. Für gewöhnlich wird das Streunen Tieren zugesprochen. Katzen sind hierzulande vermutlich die bekanntesten »Streunerwesen«. Sie bewegen sich – sofern sie nicht absolute Wohnungs- oder Hauskatzen sind – sozusagen nach Lust und Laune nach draußen, sie streifen durch das Gebiet, ohne ersichtliches Ziel; halten inne, setzen sich, laufen weiter. Sie erkunden den Raum, nahezu belanglos, ohne von ihm etwas zu wollen, nur um sich in ihm zu bewegen. Eine Katze am Streungang ist nicht auf der Jagd, zumindest so lange nicht, bis ihr etwas ganz interessant Erscheinendes über den Weg läuft, das sie daran erinnert, dass sie auch eine Jägerin ist. Und selbst dann ist nicht sicher, ob unsere Katze das genüssliche Streunen zugunsten des erregenden Jagens aufgibt.
Ich verstehe nichts von Katzen, bin ihnen weder besonders zunoch abgeneigt, aber in Sachen Streunen können wir von ihnen lernen. Ihre Mischung aus häuslicher Anhänglichkeit und wildnisorientiertem Bewegungsverhalten ermöglicht, dass wir sie relativ häufig und gefahrenfrei wahrnehmen, ja sogar beobachten können. Ich vermute, dass auch Wildschweine, Feuersalamander, Rehe und Dachse, ja vielleicht sogar alle Vierbeiner streunen, und wahrscheinlich streunen auch Vögel. Milane zum Beispiel sind sehr elegante Luftstreuner. Der Unterschied liegt wohl nur darin, dass all diese »Wildtiere« entweder sagenhaft schnell verschwinden oder uns gar als Beute oder Feind ausmachen, wenn wir ihnen im Nahbereich begegnen. Dann ist es mit ihrem Streunen vorbei – und damit auch mit unserem Zuschauen.
Hier noch eine wichtige Unterscheidung, ehe wir weiterziehen: Eine Katze, die ihre Streunschlaufen zieht, ist nicht mit einer ständig streunenden Katze zu verwechseln. Eine ständig streunende Katze hat – weshalb auch immer – kein »Haus«, in das sie durch ein Katzenklapptürchen gelangt, wann immer es ihr beliebt. Die ständig streunende Katze beginnt einen Verwilderungsprozess, der durch die viele Jahrtausende währende Koexistenz von menschlicher und kätzlicher Spezies gar nicht so einfach ist und meist doch dadurch unterbrochen wird, dass die betroffene Katze sich eine neue Wohnung samt deren Bewohner:in sucht. Wer kennt nicht jemanden, der von einer zugelaufenen Katze regelrecht erobert wurde? Das funktioniert freilich nur bei einem ausgewogenen Verhältnis von Häusern und Katzen. Andernfalls kann es schon zu hauslosen Katzenhorden kommen, die mit Vorliebe Restaurant-Viertel überfallen. Übrigens oft zeitgleich mit den Touristenhorden, aber das ist ein anderes Thema.
Nun aber zurück zu jenem Streunen, das sich im speziellen Zusammenspiel aus häuslichem Schutzort und offenem Wildraum entwickeln kann. Es ist auch für uns Menschen möglich, zumindest für jene, die einen häuslichen Schutzort und einen offenen Wildraum einigermaßen in Reichweite haben. Leider ist das jedoch nicht selbstverständlich, und so ist auch die Kunst des Streunens – so wie viele Erbschaften aus frühen Zeiten der Menschgeschichte – vom Aussterben bedroht.
Streunen ist jene Bewegung im Raum, die keinem Ziel folgt und vor nichts flüchten muss. Die nichts wollen muss und ganz bestimmt nichts vermessen, erkennen, vergleichen. Sie muss nichts nehmen und nichts geben, auch wenn wir, solange wir atmen, gar nicht anders können als fortwährend zu nehmen und zu geben. Wir können beim Streunen den Raum und seine Dinge ganz einfach in ihrem Zusammenwirken belassen und müssen nichts (können aber, wenn es sich einstellt) aus ihm herauszoomen, herausextrahieren oder gar isolieren. Wir können das Zusammenleben sinnlich wahrnehmen, uns in und mit diesem Gewebe erkunden und ein wenig vom ständigen Werden überrascht werden. Das ist herrlich!
Ohne Ziel, jedoch nicht ohne Halt
Das Streunen erlaubt also jenen Modus, in der unsere Aufmerksamkeit, die ja immer auch eine leibliche Aufmerksamkeit ist, nicht von Werbesignalen raffiniert eingefangen, von Rechenmaschinen gelenkt oder von Marktinteressen bespielt wird. In ihm darf unsere Aufmerksamkeit einfach da sein, inmitten einer Umgebung, die auch einfach da sein darf. Wir bewegen uns in einer Aufmerksamkeitsallmende, einem Raum, in dem alle das Recht auf ihre Aufmerksamkeit haben.6
Wir müssen hier nichts voneinander wollen, nur atmend den Sinnen folgen, so wie wir eben biologisch ausgestattet sind. Nur atmend den Spuren folgen, die uns unsere Geschichten zuspielen, so wie wir Menschen das eben tun. Nur atmend uns im Raum bewegen und allein dadurch in ihm handeln, gemeinsam mit allen anderen Handelnden im Raum.
Beim Streunen lenken wir unsere Aufmerksamkeit dorthin, wohin wir sie lenken (wollen), und zugleich wird sie dorthin gelenkt, wohin sie gelenkt werden will. Hier sitzt weder ein innerer Chauffeur am Lenkrad, der weiß wohin es gehen muss, noch regelt ein Polizist unsere Bewegung. Außer wir behandeln uns selbst so, als gäbe es Chauffeur und Polizist, was leider kulturell bedingt oft der Fall ist.
Wenn das »reine Streunen« gelingt, dann folgen wir den sinnlichen Impulsen und richten uns nach ihnen aus. Hier greifen der uns umgebende Raum und wir als Individuen fortwährend ineinander, aufeinander bezugnehmend bilden wir uns miteinander aus. So sind wir zwar ohne vorbestimmtes Ziel auf dem Weg, jedoch nicht ohne Halt. Im Gegenteil: In diesem Aufmerksamkeitsdreh, der hier geschieht, fühlen sich Menschen in hohem Maß gesammelt, führend und geführt und zugleich gesehen und gemeint.

»Das ist doch wirklich verrückt«, erzählt Irina nach einer Zeit des Streunens und schüttelt noch immer den Kopf. »Ich war froh, ein bisschen Zeit für mich zu haben, und ich wollte an den Fluss, ganz im Dorthin-gehe-ich-dorthin-will-ich-Modus. Und nach ein paar Schritten bin ich ausgerutscht und sanft auf dem Hinterteil gelandet. Dort blieb ich, weil es einfach der beste Ort war zum Sein und ich ja auch nicht wirklich zum Fluss musste. Irgendwann hat mich ein Rascheln aufgeschreckt, dem bin ich gefolgt. Es war gar nichts Besonderes, einfach ein Folgen, das mich zu einem großen bemoosten Stein geführt hat. So, als würde er sagen: Sei willkommen! Kaum hatte ich mich auf ihm niedergelassen, sah ich erst, dass er so einen schönen Ausblick auf den Fluss bot, der dort unten silbern glitzerte. All das war so unmittelbar und so schön. Ich begann zu weinen, es begann mich zu weinen, der Fluss, der Stein, das Licht, meine Güte, ich wusste nicht mehr, wer wen anschaute, wer zu wem sprach – das war eine höchst lebendige Begegnung. Wenn das Streunen ist, dann habe ich jetzt eine Ahnung, wovon ich in Zukunft mehr machen werde!«
Gesunde Verstörungen
Irinas Erfahrung erzählt beispielhaft, was Streunen alles kann. Es kann uns, sofern wir uns auf einen Weg oder ein Vorhaben ausrichten, davon abbringen. Streunen ist einfach nicht im klassischen Sinn effizient, sondern eher eine Verstörung. Genauer gesagt, es macht die im Leben ständig stattfindenden Verstörungen sichtbar und erlaubt, ihnen zu folgen. Wäre Irina auf dem Weg zu einem Termin gewesen, hätte dieser »Ausrutscher« nicht zu einer innigen Begegnung mit der Welt geführt, hier in Form eines Steines, eines Blicks, eines Flusses und wer oder was sonst noch immer beteiligt war. Vermutlich hätte sie sich geärgert, wäre aufgestanden und hätte den Weg mit erhöhter Vorsicht weiter beschritten. So geschieht es leider meist: Unser geplantes Leben, das uns durch eine mehr oder minder kontrollierte Welt führt, kann sich »Ausrutscher« nicht leisten. Sie sind nicht vorgesehen. Weil sie trotzdem geschehen, müssen wir die Kontrolle erhöhen.

Das macht viel Druck und ist zudem eine einseitige und anstrengende Geschichte, weil alle dafür sorgen müssen, dass ihnen nichts Außerplanmäßiges geschieht bzw. dass sich die lebendige Interaktion, die allenfalls mit dem Raum stattfinden könnte, auf ein unbedingt nötiges Minimum reduziert. Der Raum wird kaltgestellt, seine Eigenlebendigkeit verneint bzw. in dafür vorgesehenen Zeitfenstern kultiviert. Am Feierabend, am Wochenende oder in den Ferien wäre es schön, würde die Welt wieder lebendig sein. Nur leider bleibt sie dann oft stumm, weil sie eben nur zu uns spricht, wenn sie will. Ihr Wollen, also ihre unberechenbare, nicht steuerbare und unkontrollierbare Bereitschaft, sich zu zeigen, ist unmittelbar an unsere Wahrnehmung, unser Handeln geknüpft. Das eine kann ohne das andere nicht sein. Wir Menschen bewegen uns gemeinsam mit allen anderen abgegrenzten Organismen in einer fortwährenden wechselseitigen, ja sogar zirkulären Bedingtheit in und mit dem Raum, der uns umgibt. Humberto Maturana und Ximena Dávila sprechen hier von einer »organism-niche-unity«, einer Organismus-Nische-Einheit: