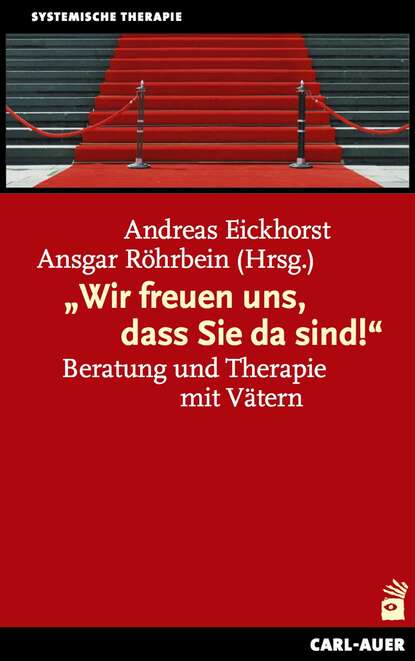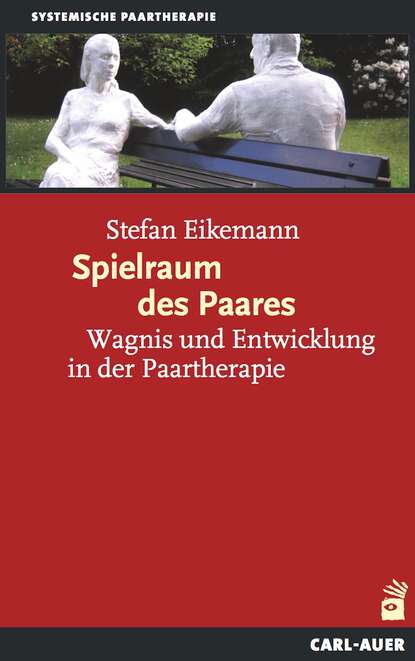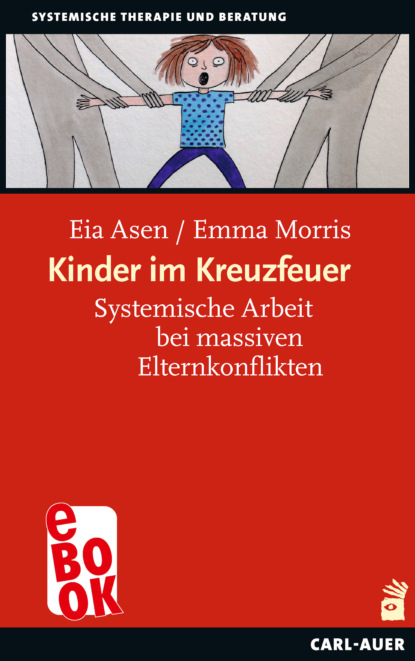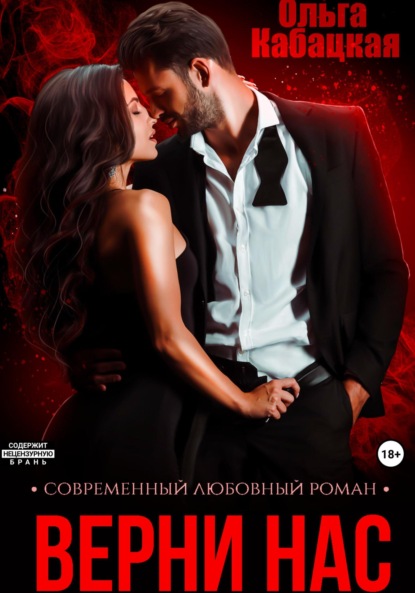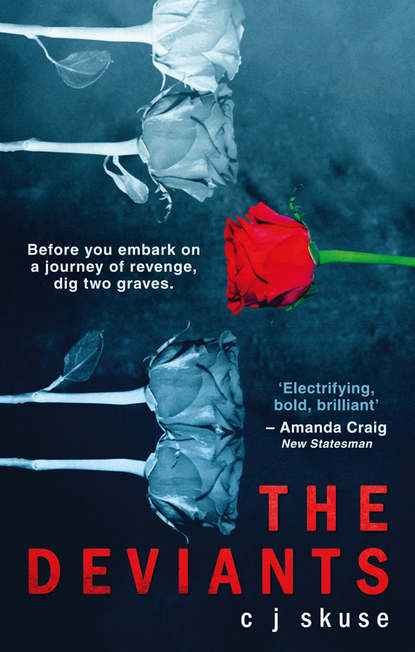Natur-Dialoge
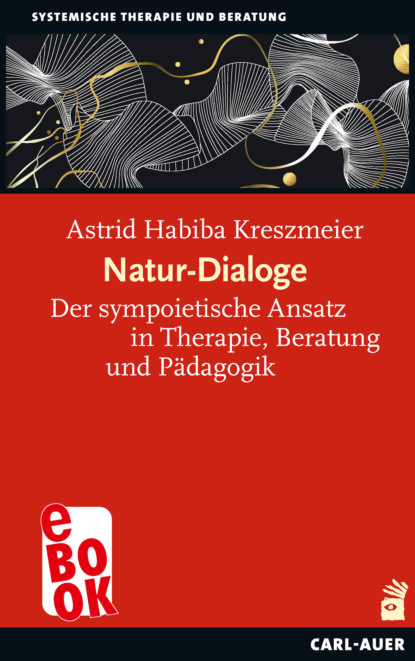
- -
- 100%
- +
»Wir sehen also: Wenn ein lebendes Wesen auftaucht, bildet sich eine ökologische Organismus-Nische-Einheit. Was also wann auch immer auf der Erde erscheint, ist kein einzelnes Lebewesen, nicht ein isolierter Organismus. Vielmehr entsteht zeitgleich mit dem Organismus die Umwelt, die ihn möglich macht. Sie erscheinen miteinander in einer dynamischen Organismus-Nischen Einheit. Die ökologische Nische ist nicht statisch. Sie wandelt sich.«7

Wechselseitige Begegnungen
Diese ständig stattfindende Wechselseitigkeit können wir mehr oder weniger bewusst wahrnehmen, reflektieren und im Umlauf halten.
In den »modernen« Denkkulturen und ihrer mittlerweile nahezu globalen Verbreitung sind jedoch der Fokus und die Erfahrung der Wechselseitigkeit einer zunehmend trennenden Einseitigkeit gewichen. Das heißt, wir sind daran gewöhnt, uns von einem belebten Innen heraus in einem objektiven Draußen zu bewegen. Wir sind daran gewöhnt, sowohl dem Innen als auch dem Außen als getrennte Einheiten Aufmerksamkeit zu schenken. Mit systemischen Perspektiven, welche selbst ja noch lange nicht in unsere soziale, politische, institutionelle oder ökonomische Wirklichkeiten Einzug gehalten haben, ist unsere Aufmerksamkeit zwar mehr auf die kommunikativen Dynamiken und Muster zwischen den einzelnen Einheiten gelenkt, aber für ko-kreative eigenlebendige Wechselseitigkeit, die Maturana u. Dávila als unsere biologische Verfasstheit annehmen, gibt es in der psychologischen, bildenden, pädagogischen Sprache und Praxis nach wie vor wenig Platz.
Wir sind nicht geübt darin, auf dieses Dazwischen zu schauen und ihm Ausdruck zu verleihen. Unmessbare, unkontrollierbare, unberechenbare, unsteuerbare Kräfte, die Beziehungen wechselseitiger Lebendigkeit ausmachen, werden in der breiten Öffentlichkeit wenig zur Sprache gebracht. Gut beobachtbar wurde das bei der Auseinandersetzung mit sowie der Information rund um Covid-19. Hier prägten Zahlen, Kurven, Tabellen die tägliche Berichterstattung. Das natürliche Zusammenspiel von Milieu und Viren kam darin marginal zu Wort.
Wer sich in Psychotherapie und Beratung dem Lebendigen zuwenden will, wird sich Erfahrungen, Denkweisen und vor allem Praktiken aus anderen gesellschaftlichen Bereichen zuwenden müssen. Als besonders anschlussfähig, vermutlich nicht zuletzt aufgrund ihrer Transzendenzorientierung, die auch unsere Denkkultur durchdringt, erweisen sich Anleihen aus östlichen Kulturräumen. Unterschiedliche Formen von Achtsamkeitspraxis, der allgemeine Yoga-Boom, das beachtliche Netzwerk der Theorie-U-Bewegung oder der Integralen Schulen erzählen davon. Ihnen allen liegt eine Verwurzelung in oder Verbindung mit buddhistischen oder hinduistischen Traditionen zugrunde.8
Zirkularität erfahren

Das Streunen, von dem ich hier gerade erzähle, ist jedenfalls kein Streunen im Geiste, sondern ein Streunen auf der Erde. Es ist kein Streunen im Licht, sondern ein Streunen an der frischen Luft. Es ist ein ganz und gar materielles, körperliches, konkretes Streunen. Nichts geringeres. Wenn Irina ausrutscht, könnte sie sich auch verletzen oder zumindest ihre Hose schmutzig machen. Und selbst wenn sie so sanft landet, garantiert nichts, dass ihr Streifzug zu irgendwelchen besonders nährenden, stärkenden, ermutigenden Begegnungen führt. Streunen verspricht keinerlei Ergebnisse, das macht es heutzutage schon sehr besonders. Wer kann es sich denn schon leisten, keine Ergebnisse zu erzielen?
Hartmut Rosa, der das Prinzip oder die Fähigkeit der Resonanz ins Zentrum seiner soziologischen Thesen stellt, erläutert ausführlich, dass Ergebnisoffenheit in unserer gegenwärtigen Weltbeziehung, die auf Verfügbarkeit und Reichweitenerweiterung ausgerichtet ist, keinen Platz haben kann. Zugleich betont er mehrfach, dass Ergebnisoffenheit zu jenen zentralen Kriterien gehört, welche eine resonante – also in meinen Worten eine wechselseitig eigenlebendige, eine schöne und gelingende – Weltenerfahrung ausmachen.9 Streunen ist also resonanzkompatibel.
Aber freilich, ich höre es schon, und es stimmt: Wir leben nicht vom Streunen allein. Nicht einmal unsere Katze. Nein, wir müssen auch jagen, sammeln, essen und schlafen. Wir müssen auch träumen, tanzen, singen, lieben und Geschichten austauschen. Wir müssen vielleicht sogar irgendwohin fahren, ganz bestimmt auch putzen und uns selbst und unsere Wäsche waschen. Wir müssen spielen, dann wieder Musik machen und Feste feiern. Wir müssen Rat halten, Entscheidungen treffen, vielleicht Freunden oder Angehörigen beistehen, sie vielleicht sogar begraben und verabschieden. Wir müssen Werkzeuge bauen oder töpfern oder nähen. Manchmal müssen wir auch krank sein oder im Haus etwas erneuern oder am Dorfplatz. Ach ja, wir müssen unbedingt zum Wasser: es trinken und der Welt, den Bäumen, den Tieren, den Blitzen und Winden begegnen, ihnen lauschen und sie schauen, wir müssen ihre Zeichen lesen oder eben auch Bücher, oder das Kunstvolle tun, das uns gegeben ist. All das und viel mehr, was wir wirklich zu tun haben, ist nicht streunen. Aber, und das ist unsere These: Wer immer wieder mal streunt, der lernt viel für all das andere.

Chancen auf Rückkoppelung
Die Magie des Streunens, das haben wir schon gesehen, kann uns von vorgespurten Wegen abbringen. Als eine Art potenzielle Pertubation oder Verstörung lässt sie uns Erfahrungen von Spontaneität im wechselseitigen Zusammenspiel mit unserer ökologischen Nische machen. Unerwartet folgen wir darin Bewegungs- oder Handlungsimpulsen in und mit einem Raum, der auf uns ebenso unerwartet und spontan einwirkt wie wir auf ihn. Um es etwas pathetischer zu formulieren: Wir oder Elemente oder Perspektiven von uns erscheinen dem Raum so wie Elemente oder Perspektiven des Raumes vor uns erscheinen. Sie erscheinen uns als Du, so wie wir als Du erscheinen. Es kann sein, dass diese Dus einander etwas zurufen und gar einander antworten. Es kann sein, dass diese spontan entstehende Bezogenheit diese Dus verwandelt und zum nächsten führt. Es kann aber auch einfach still sein. Es kann sein, dass wir einem plötzlichen Antrieb folgen, schnell zu laufen, Steine zu sammeln oder in den See zu springen. Es kann aber auch sein, dass wir uns niederlassen, alle Viere von uns strecken, oder langsam, ganz langsam von einem Baum zum nächsten gehen und unsere Hände an ihren Stämmen entlanggleiten lassen, und wir spüren die Struktur der Rinde und spüren die Rinde unsere Handflächen spüren. Streunen erlaubt einen Wechsel von Geschwindigkeit, von Bewegung und Ruhe im Raum. Der Aufmerksamkeitsmodus, der mit dem Streunen einhergeht, führt nie und nimmer zu einer in nur eine Richtung weisenden Linie, dazu ist er zu biologisch, zu wirklich, zu lebendig, anders gesprochen: Er ist schlicht und ergreifend zirkulär.
»In der Biologie gibt es keine monotonen Werte«, schreibt Bateson und führt weiter aus:
»Ein monotoner Wert ist ein solcher, der entweder nur zu- oder nur abnimmt … Begehrte Substanzen, Dinge, Muster oder Erfahrungssequenzen, die in gewissem Sinne gut für den Organismus sind – Nahrungsmittel, Lebensbedingungen, Temperatur, Unterhaltung, Sex und so fort –, sind niemals so beschaffen, dass mehr von der Sache stets besser ist als weniger davon. Vielmehr gibt es für alle Objekte und Erfahrungen eine Quantität, die einen optimalen Wert hat. Jenseits dieser Quantität wird die Variable toxisch. Unter diesen Wert zu fallen bedeutet Entbehrung« (Bateson 1987, S. 72).
Inspiriert von Batesons Perspektive wage ich zu behaupten, dass Streunen in einer kulturellen Umwelt, die mit linearem Denken und einem ebensolchen Handeln seit ein paar Jahrtausenden in toxischer Liaison zusammenlebt, nicht nur antitoxisch ist, sondern auch eine enorme Bildungschance für zirkuläres Denken, Empfinden und Handeln. Es enthält die Chance zur Rückkoppelung unserer biologischen und kulturellen Verfasstheiten. Wir können nicht wissen, was dabei herauskommt. Aber ich vermute, dass ein Mehr an zirkulären Erfahrungen mit unserer Nische zumindest Unterschiede im mehrheitlich linearen Selbst- und Weltempfinden generieren würde. Das Wagnis ist es allemal wert.
Jetzt aber wieder zurück zur Katze, unserer Mentorin. Das Streunen der Katze ist ja eben auch nicht monoton, sondern rhythmisch, zyklisch, zirkulär. Vom Haus aus betrachtet, kommt und geht sie, im Territorium selbst wird sie vermutlich als begnadete Streunerin immer wieder neue Wege und Bereiche erkunden. Auf diese Weise lernt die Katze den Raum kennen und der Raum die Katze. Selbst wenn unsere Katze keine große Abenteurerin ist und – angenommen – oft auf denselben Strecken streunt, wird sie doch jedes Mal einem anderen Raum begegnen, weil das Wetter, die Ameisen, die Büsche, die Gräser, die Autos, die Menschen, die anderen Katzen, die Vögel nie und nimmer zwei Mal in der genau selben Konstellation erscheinen. Hier ist alles einmalig gegenwärtig, unwiederholbar, ganz und gar nicht verallgemeinerbar. Man könnte sagen eine einmalige besondere Erfahrung, die eine spezielle Beziehungsqualität zwischen der Katze und ihrer Nische bildet. Streunen ist so gesehen für naturwissenschaftliche Erkenntnisse ziemlich ungeeignet, weil sich aus diesem speziellen Beziehungsgeflecht nichts isoliert untersuchen und schon gar nicht beliebig wiederholen und überprüfen lässt. Es ist daher auch höchst unwahrscheinlich, dass sich in nächster Zukunft Streunen als wirksame Methode per Krankenkasse abrechnen lassen wird, worüber ich – ehrlich gesagt – auch sehr froh bin.

Eigenlebendig, miteinander und spontan
Bleiben aber dennoch die vielen Erfahrungsgeschichten von Streunenden, die wir im Laufe der Jahre immer wieder hören können. So unterschiedlich sie auch sein mögen, es wiederholen sich folgende Wahrnehmungsstränge: Hier ist zum einen die sinnlich, leibliche Erfahrung von Eigenlebendigkeit. Wir atmen und werden geatmet, wir tun und werden getan, wir richten uns aus und werden ausgerichtet. Diese eigentümliche Doppelwahrnehmung von aktiv und passiv, von geben und nehmen, erleben viele Menschen als Erfahrung von Eingebundensein. Sie ist – so meine Annahme – die reflektierte Erfahrung unserer biologischen Verfasstheit, um in Maturanas Bildern zu sprechen: Wir erfahren uns in unserer Existenz als molekulare autopoietische Lebewesen. Fortwährend fließen uns Moleküle zu und andere ab, und unsere gegebene Struktur sorgt dafür, dass wir uns in all dieser Bewegung als Lebewesen am Leben erhalten. Nicht weil eine äußere Kraft, ein Geist, ein Gott uns lenkt, sondern weil das, was wir als Leben erkennen, so funktioniert, so in der Welt ist, in ihr so handelt. Streunend erleben wir uns eigenlebendig, erfahren unsere zirkuläre Verfasstheit als existenziellen Halt, und viele beschreiben diese Erfahrung als entlastend, berührend, nährend und bewegend.

Als eigenlebendige Lebewesen erschaffen wir Menschen uns gemeinsam mit unserer Mitwelt, unserer Nische, in einer zyklischen, selbst erneuernden und reflektierenden Art und Weise. Wir sind nicht, wie bislang noch unsere Maschinen, auf Wartung von außen angewiesen. Die strukturimmanente Kooperation und die Koexistenz mit der Umgebung erhalten uns so frisch und so lange am Leben, wie es eben geht. Wenn in dieser kooperativen Koexistenz etwas maßgeblich gestört wird, dann stellen sich Unfälle oder Krankheiten ein. Wenn es nicht gelingt, ein gutes Zusammenleben wiederherzustellen, löst sich diese Organismus-Nischen-Einheit früher oder später auf. Dasselbe gilt, wenn im Laufe unseres natürlichen Alterns unser Austausch mit dem Raum bis hin zum letzten Atemzug zurückgeht und wir sterben und mit uns unsere Nischen. Gut, derweilen leben wir noch, das freut mich sehr!
Diese eigenlebendige Grundausstattung ist in sich schon eine fantastische Angelegenheit. Dazu gesellen sich andere Großartigkeiten, ohne die das Leben und das Streunen gar nicht funktionieren würden: zum Beispiel die Spontaneität. Spontan, plötzlich, ungeplant, zufällig – das sind Wörter, die in den Berichten der Streunenden praktisch immer vorkommen. Viele berichten so, also wären sie in diversen Situationen von sich selbst überrascht worden, aber eben auch von der Umgebung, die ihnen ebenso spontan, plötzlich, ungeplant und zufällig entgegenkommt. Spontan heißt weder klug noch instinktiv, es garantiert auch keine angenehme Erfahrung. Dennoch trägt das Ausbleiben von spontaner Welt- und Selbsterfahrung ganz bestimmt zu einer traurigen, stereotypen, geschmacklosen oder aggressiven Stimmung bei. Vermutlich ahnen die Menschen, dass das Lebendige bis zu einem Grad unvorhersehbar ist, jederzeit spontan sein kann, ja spontan sein muss oder will. So, wie wir den Verlust des Spontanen betrauern oder uns gar darum betrogen fühlen können, so sehr inspiriert, ja animiert es Menschen, wenn sie der Spontaneität (wieder) begegnen: bei sich, in ihrer Nische und vor allem immer im fließenden Austausch von beidem.
Zur Erinnerung: Wir sprechen hier von einer Erfahrung spontaner Eigenlebendigkeit in Wildräumen, die ihrerseits auch voller Lebewesen mit spontaner Eigenlebendigkeit sind. Im Kapitel »Zwischen den Dingen« (S. 200 ff.) werde ich mich auch besonders der Welt der menschengemachten Dinge und ihren Möglichkeiten resonanter Kooperation zuwenden. Hier schenken wir zuerst dem Streunen in »natürlichen Räumen« Aufmerksamkeit. Zum einen, weil die Eigenlebendigkeit dieser Räume uns darin unterstützt, dieses Phänomen des Lebendigen zu erkennen. Aber noch aus einem weiteren triftigen Grund: Solange wir Luft atmen müssen, solange wir Wasser trinken müssen, solange unsere Nahrung aus tierischen oder irdisch-pflanzlichen Kreisläufen entsteht, solange wir als menschliche Gemeinschaften hier auf Erden leben und sterben, so lange müssen wir diese irdische, vor Eigenleben strotzende Mitwelt als die uns nächste und wesentlichste Nische ansehen. Daher scheint es zuallererst wichtig, das Streunen in Naturräumen wiederzuentdecken, als grundlegende Basis für alles Weitere.
Mit ihr erfahren wir die Spontaneität des Zusammenwirkens, die auf ungeheuer beständige Art an der Bewahrung dessen mitwirkt, was wir organisches Leben nennen. Hans-Peter Hufenus, mein Partner und beherzter Forscher von urgeschichtlichen Vorgängen, beschreibt den Beginn dieses seit ca. 3,8 Milliarden Jahren währenden Zusammenwirkens folgendermaßen:
»Die ersten Lebewesen auf unserem Planeten waren die Blaualgen, die noch nicht eigentliche Pflanzen waren, sondern Bakterien mit der Fähigkeit, mittels Photosynthese Sauerstoff aus dem Wasser freizusetzen. Damit wurde der Weg frei für eine der großen Kooperationen des Lebens auf der Erde, nämlich die zwischen jenen, die Sauerstoff einatmen, und jenen, die ihn abgeben« (Hufenus 2021, S. 21).
Diese und viele andere Formen von Kooperation haben bislang dafür gesorgt, dass dieser Lebensfaden in aller Spontaneität, aber auch der notwendigen wechselseitigen Fürsorge erhalten und weitergesponnen wurde. Hier sind wir, die wir heute leben, schon in ein dicht gewachsenes Lebensgewebe hineinverwickelt.
Unglückliche Verwechslungen

Wenn Irina hier stellvertretend für viele andere sagt: »Ich begann zu weinen, es begann mich zu weinen, der Fluss, der Stein, das Licht, meine Güte, ich wusste nicht mehr, wer wen anschaute, wer zu wem sprach – das war eine höchst lebendige Begegnung!«, dann geht es um eine sinnliche Erfahrung der Hineinverwickelung. Sie konnte für den Moment nicht mehr unterscheiden, wer zu wem sprach, aber ihre Erfahrung erzählt in keinem Wort von einer Erfahrung von Einheit, sondern von einer Begegnung, einer Bewegung mit einem bestimmten Gegenüber an einem bestimmten Ort. Das Ausrutschen, die Erde unter ihrem Hinterteil, das Innehalten, das Rascheln, dem sie folgte, der Stein, der sie lockte; all das sind Interaktionen jener eigenlebendigen Lebensgemeinschaft, die sich dort eingefunden hat. Hier kommen viele eigenständige Stimmen zusammen, nicht nur eine, die durch alles spricht. Hier begegnet sich vieles, das einander spontan gerufen, gesehen, aber sie ist deshalb weder mit allem verbunden noch geht sie in einer ozeanischen Erfahrung von Einheit oder Ganzheit auf. Sie erlebt verbundene, konkrete Vielfalt, die voreinander erscheint und miteinander lebt.
Streunen hat das Potenzial, die Magie des Lebendigen erfahrbar zu machen. Das kann eine sehr – ich verwende hier bewusst diese schöne, wenngleich missverständliche Vokabel – beseelende Erfahrung sein. Es eignet sich allerdings nicht dazu, eine Erfahrung des »Alles ist eins« anzuzetteln. Wenn alles eins wird, dann hört sich das Streunen auf. Dann ist hier nichts mehr, was gehört, gesehen, getan werden will, dann ist die Welt samt ihren Organismus-Nischen-Einheiten von dem »Eins«, dem All, vom großen Ganzen verschluckt. Dann sind wir nicht mehr Lebewesen in einer vielfältigen Welt. Wer soll sie dann noch gestalten?
Wir sind hier an einer delikaten und wichtigen Stelle in der Annäherung an den Natur-Dialog-Ansatz angekommen. Auch hier gilt: Es macht einen Unterschied, welche Unterscheidungen wir machen, welche Zusammenhänge wir beschreiben, welche Schlüsse wir ziehen und welches Handeln damit einhergeht.
Die Notwendigkeit eines Bewusstseinswandels, der die Menschen zu mehr Verbundenheitskompetenz führt, ist heute in vielen gesellschaftlichen Bereichen und Schichten unbestritten. Die Bemühungen, hier Beiträge zu leisten, sind schon lange aus dem sogenannten esoterischen Sektor in wohlsituierte Netzwerke und in den öffentlichen Diskurs gekommen.
Die Ideen des Getrenntseins zum Beispiel von Menschen und Natur, von Innen und Außen, von Gestern und Heute haben ihr kreatives und gleichermaßen gewalttätiges Potenzial verschiedentlich unter Beweis gestellt. Es ahnen oder wissen heute viele, dass es Zeit wird für andere Herangehensweisen. Dabei scheint es für viele – seien sie in elitären Kreisen, im mittleren Kader, in Basisschichten oder Randkulturen tätig – auf der Hand zu liegen: Die Schlucht, die uns vom Lebendigen trennt, kann durch ein Erkennen einer All-Einheit überbrückt werden. Wir sind eine Menschheit, in einer Welt, in der alles mit allem verbunden ist. Wir suchen nach universellen Lösungen, in denen kohärente und nachhaltige Weltökonomie möglich ist. Andere suchen die Matrix, die uns Menschen zu neuer Vernunft kommen lässt und mit unserem Herzen in Einklang ist. Es scheint, als hätten sich viele Menschen kulturell darauf eingeschwungen, dass das Gegenteil von Getrenntsein ein Einssein ist.
Hier werden Verschiedenheit mit Getrenntheit sowie Verbundenheit mit Einheit gleichgesetzt. Diese Schlüsse erscheinen mir unglücklich. Sie bringen uns um die wundervolle und wichtige Erfahrung, mit einer konkreten, vielfältigen Welt verbunden zu handeln. Es ist eine alte systemische Erkenntnis, die mir hier in den Sinn kommt: Die Aufhebung von Unterschieden macht keine Verbindung – im Gegenteil. Das gilt auch für all jene, die sich nach tieferer Beziehung mit der »Natur« sehnen, für jene, die ihre Bezogenheit zu unserem Planeten ändern wollen, und eben auch für Menschen wie mich, die das Verhältnis von Mensch und Raum als ein wesentliches Element von Gesundheit und Bildung erachten.
In dem hier beschriebenen Ansatz, der Denkimpulse und Handlungsformen zur Rückkopplung an unsere irdische Gebundenheit ermöglichen will, ist nicht die Suche nach der einen Idee, der einen Ordnung, der einen Formel, dem einen Geschichtsstrang von Belang, sondern die konkrete Orientierung am vielfältigen Miteinander. Es setzt aus Überzeugung und Erfahrung im nur scheinbar bescheidenen Raum konkreter Handlungsbezüge an.
»Nichts ist mit allem verbunden; alles ist mit etwas verbunden«, sagt Donna Haraway (2018, S. 48), Biologin und Wissenschaftshistorikerin und unermüdlich querdenkend Lehrende. Die Betonung der All-Verbundenheit holistischer und ökologischer Philosophien sei wenig hilfreich, führt sie in den Anmerkungen (ibid. S. 237) weiter aus:
»Es ist eher so, dass alles mit etwas verbunden ist, das wiederum mit etwas verbunden ist. Es kann sein, dass wir am Ende alle miteinander verbunden sind, aber die Spezifik und das Maß der Nähe von Verbindungen sind von Gewicht – mit wem wir verbunden sind und auf welche Art und Weise. Leben und Tod finden innerhalb dieser Verhältnisse statt.«
Sie spricht mir hier aus dem Herzen. Wie viele junge und ältere Menschen sind mir schon begegnet, die mit einer tiefen Gewissheit der All-Verbundenheit ausgerüstet, dennoch isoliert und verloren auf ihr konkretes Leben blickten? Wie, ach nur wie, dieses große Ganze in einen banalen Alltag packen und dem Anspruch an Selbst-Entwicklung in All-Verbundenheit gerecht werden? Nicht selten haben sich danach Geschichten der Erleichterung im Beforschen der konkreten Lebensumwelt, der menschlichen und auch der anders-als-menschlichen Weggefährten entsponnen. Auf diese Weise wurde dann, Schritt für Schritt, wirkungsvolles Handeln im eigenen Leben möglich.
Wege zur Mit-Sprache

Seit gestern beschäftigt mich das Wort »Streunen«, das uns hier so wiederkehrend begleitet. Was wird etymologisch darüber erzählt, und haben Wörter mit euner, wie zum Beispiel Zigeuner, auch damit zu tun? Rund um letztere Frage bin ich nicht weitergekommen, konnte jedoch herausfinden, dass »streunen« auf das westgermanische Verb striunen zurückgeführt wird, das von »erwerben, gewinnen« erzählt. Dann kennt man aus dem Mittelhochdeutschen ein striunen, das von interessiertem, schnupperndem, neugierigem jedoch ziellosem Herumziehen spricht. Es gibt jedoch auch eine Strüne, die wiederum ein liederliches Frauenzimmer meint. Das ist ein weiterer, interessanter Bedeutungsfächer, der unserer Praxis des Streunens vielfältig zuspielt.
Ja, beim Streunen, jenem Tun, in dem unsere atmende Bewegung nicht zielgerichtet ist, aber dennoch voll Interesse und Neugierde für das, was auftaucht, bei diesem Tun lässt sich viel gewinnen, ja sogar erwerben. Zugleich gibt es bei vielen Menschen, wenn sie vom Streunen hören, ein sattes Zögern. Man hört es in ihnen förmlich fragen: »Ist streunen erlaubt?«, »Geziemt sich ein ziellos neugieriges Herumstreifen?«, »Bringt das etwas?« Oder auch etwas philosophischer: »Wie kann Neugierde ohne Zielgerichtetheit in Bewegung außerhalb des Kloster- oder Zengartens funktionieren?«
Die Einladung zum Streunen wirft allerhand Fragen auf, und manche von uns bringt es sogar in Schwierigkeiten; wer will schon ein liederliches Frauenzimmer sein? Unser Ich muss sich über geltende Ideen von Vernunft und Tüchtigkeit hinwegsetzen, will es sich streunend in Bewegung bringen. Das gelingt nicht immer und einfach grade so. Hier ist mit Rückfällen und Hindernissen zu rechnen, aber wer einmal den Geschmack des Streunens in der Nase hat – und das passiert bei entsprechender Rahmengestaltung doch häufig –, der trägt ihn als süße Erinnerung latent in sich. Welch hervorragender Dünger für ein gutes Leben und Zusammenleben.
Fassen wir kurz zusammen: Für das Streunen verlassen wir unseren häuslichen Bezugsraum und ziehen neugierig, atmend, aufmerksamkeitsoffen durch die Welt. Diese ist erstens idealerweise nicht voller Werbeplakate, überlässt also unsere Aufmerksamkeit für eine gewisse Zeit sich selbst. Da dies heute fast nur mehr in wilden Räumen der Fall ist, findet es am besten dort statt. Zweitens ist es auch hilfreich, das Smartphone im Flugmodus mitzutragen oder es, noch besser, zu Hause zu lassen, was allerdings die wenigsten aus Risikoerwägungen und Verantwortungsbewusstsein noch tun werden – also Flugmodus. Gerade kommt mir ein schrecklicher Gedanke: Was, wenn wir weiterhin corona- oder anders bedingt so wenig fliegen und allenfalls sogar mehr streunen? Dann wird es nicht lange dauern, und wir finden auf unseren Minicomputern, die ja auch schon riechen können, einen Streunmodus. Oh du meine Güte, dann müssen wir uns eine Alternative einfallen lassen!